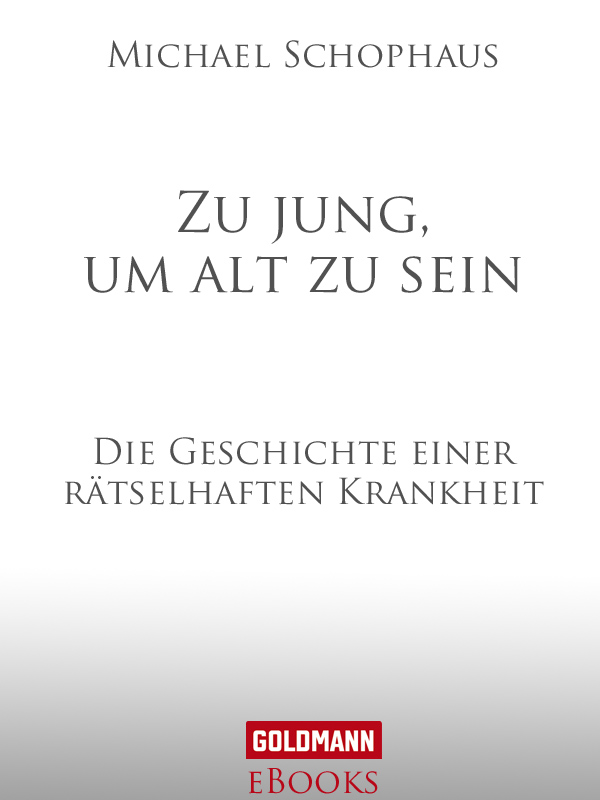
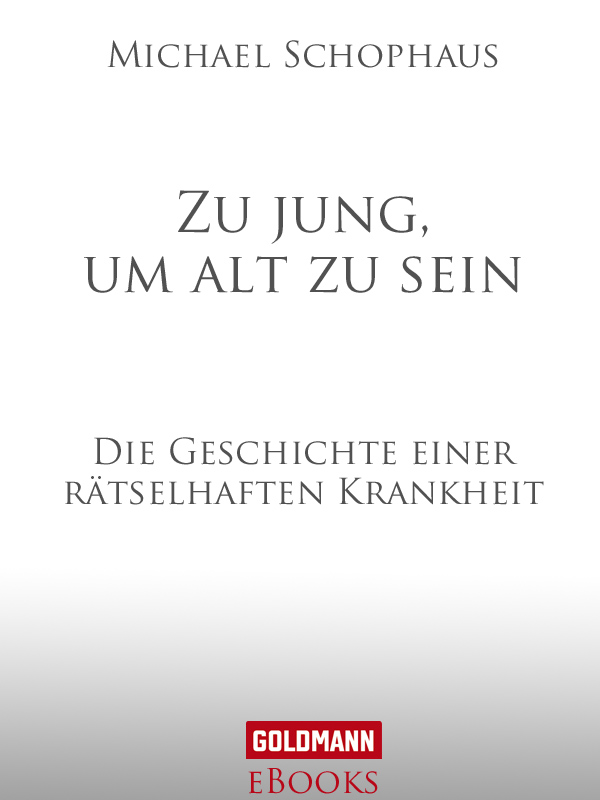
MICHAEL SCHOPHAUS
Zu jung, um alt zu sein
Buch
Die Krankheit ist bisher kaum erforscht und nur schwer zu begreifen: Progerie, so mutmaßen Wissenschaftler, ist ein winziger Buchstabierfehler im menschlichen Erbgut. Ein Fehler mit dramatischen Folgen: An Progerie erkrankte Kinder altern bereits in jungen Jahren, schon früh fallen ihnen die Haare aus, Falten durchfurchen ihr Gesicht, mit sechs leiden sie an Arthrosen, mit acht bekommen sie Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Bei Yasin wurde die Diagnose gestellt, als er kaum ein Jahr alt war. Der Journalist Michael Schophaus begleitete den kleinen Jungen im Kampf gegen eine Krankheit, die selbst Experten immer wieder neue Rätsel aufgibt. Michael Schophaus weiß, wie es sich anfühlt, das mutige Leben zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und er zeigt, wie engagierte Ärzte um höhere Erkenntnis und wissenschaftlichen Fortschritt ringen.
Autor
Michael Schophaus, geboren 1956 in Bottrop, studierte Sportwissenschaften in Köln. Nach der anschließenden Ausbildung an der Hamburger Journalistenschule ist er seit 1987 als freier Journalist tätig, u.a. für »Stern«, »taz« und große deutsche Magazine. Zur Zeit ist Schophaus Chefredakteur mehrerer Kundenzeitschriften. Er lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen im Rheinland.
Von Michael Schophaus ist im Goldmann Verlag
außerdem erschienen:
Im Himmel warten Bäume auf dich (15148)
Michael Schophaus
Zu jung,
um alt zu sein
Die Geschichte einer
rätselhaften Krankheit

Verlagsgruppe Random House FSC-DEU-0100
Das für dieses Buch verwendete FSC-zertifizierte Papier
München Super liefert Mochenwangen.
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
1. Auflage
Taschenbuchausgabe April 2006
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Wilhelm Goldman Verlag,
München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Regina Carstensen
KF · Herstellung: Str.
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-641-01 190-1
Für Meral, Cennet, Ahmet, Mehmet, Ali und Yasin,
besonders ihn. Bleib so stark, damit du deinen Frieden
findest und wie deine Mutter in den Träumen die
frische Erde deiner Heimat riechst.
Vorwort
Der Traum vom Feuer
Die Rache des Himmels
Schicksal braucht Trost
Eine Laune der Natur
Alter ist doch nur ein Wort
Was ist normal?
Hoffnung lebt von Liebe
Gott und das Gen
Jetzt erst recht!
Was bist du denn für einer?
Eine Reise ins Ungewisse
Von Leid und Neid
Der Blick ins Herz
Nachwort
Dank
Das Altern beginnt mit der Geburt als eine festgesetzte Änderung von Stoff, Form und Leistung der Zellen, Gewebe und Organe. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Altern die letzte Phase des Lebenszyklus.
(aus DBG Handlexikon)
Als für dieses Buch der Auftrag kam, war mir klar, das wird mehr als eine ganz normale Geschichte. Ich wusste, es wird die Auseinandersetzung mit dem Leben und Tod eines Kindes, mit den stillen Grausamkeiten der Natur, dem Schrei nach Hoffnung, dem stummen Entsetzen unserer Hilflosigkeit, und ich kann nur sagen, ich fürchtete mich schon sehr davor. Zu erleben, wie ein Kind alt wird, wie sich vor seine unschuldige Jugend eine kleine, greise Maske schiebt, wie sich tiefe Falten in einen Körper graben, der eigentlich glatt und frisch sein sollte, und ganz nah mitzubekommen, wie es in viel zu großen Schritten Richtung Endgültigkeit verschwindet. Ja, so etwas war mehr als nur ein Auftrag. Mehr als nur Schreiben und Geldverdienen. Es erschien mir wie eine Kriegsberichterstattung aus der Hölle der verbrannten Seelen dieser Welt.
Eigentlich war das für mich keine neue Erfahrung. Kinder leiden zu sehen, mit ihnen zwischen Elend, Mut und Trauer zu schwanken und sie zu begleiten auf ihrem schmalen Grat, den das Schicksal ihnen ließ. Ich habe Bilder vom Sterben im Kopf, die ich niemals mehr loswerde, weil es Bilder vom Sterben von Kindern sind, deren Leben erst anfangen sollte. Sie hatten Krebs, sie waren schwerkrank und lagen geschwächt auf dem Bett, sie kotzten, wenn ihnen übel wurde von der Chemotherapie, sie freuten sich, wenn ihnen wieder Haare wuchsen, und zum Glück blieben die meisten von ihnen tapfere Sieger im Kampf gegen den Feind. Es gab ja auch viele Möglichkeiten, ihn zu besiegen, und die Ärzte setzen alle Waffen ein, die ihnen zur Verfügung standen. Sie bestrahlten und spritzten, sie wetzten das Skalpell, sie mischten das Gift, sie wussten immer, was sie machen mussten, weil Krebs zwar heimtückisch und unberechenbar ist, aber gern auch in jede Falle gerät, die man ihm stellt. Nur manchmal eben frisst er sich hungrig durch einen Körper, bis er stirbt. So wie bei meinem kleinen Sohn.
Nun aber ging es um eine Krankheit, gegen die es keine Medizin gibt. Nun sollte ich über die Krankheit eines Kindes schreiben, die man noch weniger als Krebs versteht. Weil sie den Schrecken im Gesicht trägt, weil sie in eiliger Scheußlichkeit das Dasein überholt und es zur Zeit nichts, aber auch nichts gibt, was man dagegen tun könnte. Diese Krankheit heißt Progerie, und sie ist fast so selten wie die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Woche die Welt untergeht. Sie lässt sich nicht begreifen und schon gar nicht richtig erklären, weil kaum einer etwas weiß über sie. Ein Defekt in den Genen, ein paar Zellen, die durchgeknallt sind, die verrückt spielen und sich beeilen mit einem Leben, das an den Kindern im Zeitraffer vorüberzieht. Wer kann das schon begreifen? Sie macht junge Menschen zu Greisen, sie beschleunigt unaufhaltsam deren Zeit, und die Frage nach dem Warum ist so sinnlos wie bei jeder schlimmen Krankheit, die unsere Kinder betrifft. Warum das Warum kennen, wenn bis heute nicht einmal geklärt wurde, wie das Wie entstand?
Ich schaute mir Bilder an, nahm mir einige Artikel über die Progerie vor, und niemals während meiner Arbeit als Journalist habe ich derart viel über die Dramatik von Existenz gelesen. Niemals zuvor haben sich mir so sehr biologische Wichtigkeiten eingeprägt, die man erst dann bemerkt, wenn die Natur völlig irrsinnig wird. Ich las von großen Köpfen und schrumpfenden Rümpfen, vom Abbau des Unterhautfettgewebes, von steifen Gelenken, von spontanen dominanten Mutationen, von Schlaganfällen mit acht und Herzinfarkten mit zehn Jahren, und als ob das nicht alles schon genug wäre, gipfelte diese stille Verzweiflung, diese verdammte Wut und dieses fürchterliche Ausgeliefertsein in der Frage einiger betroffenen Eltern: »Warum kann unser Kind nicht einfach nur Krebs haben?«
Wie gesagt, es war kein normaler Auftrag, und sicher hätte ich diesen Eltern, deren traurige Entrüstung ich wirklich gut verstehen konnte, gern einiges darüber erzählt, wie verdammt aussichtslos auch Krebs sein kann. Wie sehr man bei jedem Tropfen Hoffnung in den Adern seiner Kinder an ihren Betten saß und weinte und den lieben Gott verfluchte – doch mit einem hatten diese Eltern natürlich Recht. Diese Krankheit, die täglich eine Woche älter macht, ist eine Unberechenbarkeit der Schöpfung, ein taktloser Vorwitz der Gene und eine Beschleunigung von Gefühlen, die dir irgendwann auch durch deinen eigenen Körper rast, wenn du auf ein Kind mit Progerie triffst. Dann guckst du zu ihnen herab, bückst dich ihnen entgegen, wenn du mutig bist, und denkst, du siehst dort ein kleines fremdes Wesen. Weil du nicht begreifst, was du da siehst. Weil du nicht begreifen kannst, was du da siehst. Einen freundlichen Zwerg mit langer, krummer Nase, runzeligen Falten im Gesicht, haarlosem Schädel, dünnen, zittrigen Fingern und einer gebückten Gleichgültigkeit, die dir zu sagen scheint: Denk doch über mich, was du willst! Lass mich zufrieden mit deinen blöden Vorurteilen! Hau doch ab oder hab mich gern! Sie schlürfen müde herum, weil sie schon ihre Arthrosen spüren oder die Gelenke sie plagen, und sie oft so schwach sind, dass sie keine Schultasche mehr tragen können, doch man merkt bei jedem ihrer schleppenden Schritte, nach jedem Ton ihrer piepsigen Stimme: Dahinter steckt Weisheit und Verstand, dahinter blitzen die Augen eines frischen, wachen Geistes. Hinter ihrer alten Fassade lauern die Wünsche, die Hoffnungen und Ängste eines ganz gewöhnlichen Kindes.
Aber natürlich wissen sie ganz genau, dass sie nicht gewöhnlich sind. Dass sie anders als die anderen sind und niemals ein Leben führen können wie ihre Freunde in der Schule, die herumtollen, ohne dass ihnen gleich die Knie wehtun oder die knochigen Füße schmerzen. Außerdem werden sie oft ausgestellt in einer Gesellschaft, die voll von dreister Neugier ist, und schaut man in die Zeitungen, bleibt bloß noch zorniges Unverständnis über die Darstellung einer Krankheit, die es nur vierzig-, fünfzigmal gibt auf der Welt. Da heißt es: Svenja, das Greisenkind! Das Rätsel des Verfalls! Alles Gute, alter Junge! Sie nannten ihn Marsmensch! Der Tod des Alien! Hilflose Schlagzeilen, die nur dumm und reißerisch klingen. Ich empfand sie als die Verniedlichung eines Leidens, das keiner von uns begreifen kann, ich sah darin eine große, menschliche Schwäche, das Verkitschen eines Phänomens, das uns Angst macht, weil es nicht passen will zu allem, was wir eigentlich über Kinder wissen wollen. Wie soll man auch verstehen, dass ein Kind so eilig älter wird und vor dir stirbt? Wer kann denn auch einem Jungen in sein Gesichtchen blicken, in dem die müden Augen in den Höhlen hängen, in dem man jede kleine Ader sieht, durch das ein kurzes Leben schimmert, und die welken Ohren wirken, als hätte man sie beim Schöpfen ganz vergessen? Wer zum Teufel soll verstehen, wenn ein altes Mädchen mit kurzem Atem vor dir steht, nur weil es nur mal sorglos durch die Kindheit hüpfen wollte? Wen lässt es ehrlich kalt, dieses fiese Spielchen der Natur?
Mir fiel es nicht gerade leicht, so kurz nach dem Tod meines eigenen Kindes wieder darüber zu schreiben, warum es einfach keine Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt. Warum es Kinder gibt, die gesund sind und heiter und einen Weg voller Glück gehen, und andere vom Schicksal aus der Bahn geworfen werden. Warum die einen nichts wissen von den Unregelmäßigkeiten eines Ablaufs, den sie im Werden und Vergehen Leben nennen, und andere schon dankbar sind, wenn man sie nicht mit Spritzen, Schmerzen oder Vorurteilen daran stört, Kind zu sein, einfach nur Kind zu sein, und sonst nichts. Die gute Sorglosigkeit zu spüren, sich auf die Freude seiner Spiele einzulassen und in der schönen Gewissheit älter zu werden, dass alles seinen Sinn und Platz hat in der Entwicklung eines Kindes. Aber wie nur soll man von Sinn sprechen bei einer Krankheit, in der die Zeit völlig außer Kontrolle geraten ist? Wie soll man den tröstlichen Rhythmus des Alltags aufnehmen können, wenn irgendjemand mit wilder Entschlossenheit an den Zeigern deiner Lebensuhr dreht? Wie soll das gehen, Kind zu sein, während es in großen Schritten über alle zeitlichen Schwellen springt?
Und dann kommt da noch etwas anderes hinzu. Diese Unheimlichkeit der Krankheit, diese dunkle Unberechenbarkeit und schleichende Angst davor, wie dein Kind am nächsten Morgen aussieht. Ob wieder eine Ader mehr hervortritt, ob sich ein Finger versteift hat in der Nacht oder die Haut so hart geworden ist, dass sich der kleine Körper wie gefangen fühlt in seinem ledernen Korsett. Ja, zugegeben, wenn auch nur unter traurigen Erinnerungen an mein geliebtes Kind: Krebs ist da viel leichter zu durchschauen, weil man ihn sichtbar machen kann mit Ultraschall und hellen Punkten auf den Bildschirmen hochmoderner Apparate in der Medizin. Man kann ihn ertasten unter dem Bäuchlein der Patienten, ihn auf Bildern zeigen, ihn mit der Bestrahlungspistole in glücklichen Fällen zur Aufgabe zwingen oder sein böses Wuchern mit dem Skalpell beenden. Aber was bleibt bei der Progerie? Es bleibt die Angst, die einem tief im Hals steckt, weil man kaum reden will über Kinder, die durchs Leben rasen, weil man nicht verstehen will, dass da eine Krankheit in irgendwelchen Genen schlummert und nicht besiegt werden kann. Gene sind nicht fassbar, sie setzen uns zusammen und prägen unseren Körper bis in alle Ewigkeit. Bei einer Progerie aber sind sie lockere Bausteine geworden, die umgestürzt sind zu einem hohen, wackligen Berg, unter dem die Hoffnung auf jegliche Normalität begraben wurde. Sie sind zerborsten, und keiner weiß, wie man sie wieder kitten kann.
Jedenfalls war ich mir bald sicher, dass es kaum einen Sinn machte, Krankheiten von Kindern nach ihrer Trostlosigkeit einzuteilen. Sie an ihrer Verzweiflung zu messen und dem Grad ihrer Aussichtslosigkeit. Aber so sehr ich mich in diesem Buch mit der Progerie beschäftigte, immer traf ich auf einen unheimlichen Verdacht, auf schlimme Befürchtungen, die nur allzu oft bestätigt wurden, und die zaghafte Unerfahrenheit, mit der sich Ärzte oder Eltern dieser so unglaublich seltenen Hinfälligkeit näherten. Progerie! Was wusste man schon darüber? Denn dass man nichts darüber weiß, bereitet Angst und Unbehagen vor dem genetischen Amoklauf eines kleinen Körpers, der schneller älter werden will, anstatt die Jahre seiner Jugend in aller Ruhe zu genießen. Was anderes als Furcht kann sich auch sonst daraus entwickeln?
Da hatte ich nun den Auftrag, er lag als kleiner Zettel auf dem Schreibtisch, ich hatte zugesagt und hasste mich dafür. Du spinnst, sagte ich mir, warum machst du das, so wenige Jahre nach dem Tod deines Kindes? Du weinst noch immer um ihn an seinem Grab, und jetzt willst du dich mit einer Krankheit beschäftigen, die deine Ängste nur mehr schüren und dich noch schlechter schlafen lassen wird? Keiner zwingt dich dazu, sagte ich mir, lass es sein, diese Geschichte können doch auch andere machen, und dabei schlich ich tagelang um meinen Schreibtisch herum, ohne den Zettel in die Hand zu nehmen, auf dem der Name eines Arztes stand. Zwei Jahre hatte ich Zeit, und so redete ich mir ein, dass die paar Tage nicht zählten, die mit meinem Zögern verstrichen. Aus den Tagen wurden Wochen, und irgendwann, als die ersten Nachfragen aus der Redaktion kamen, fasste ich mir ein Herz und begab mich auf die mühsame Suche nach einer Wahrheit, die nur ganz kleine Schritte zulassen sollte. Schritte, die schmerzten, Schritte, die sich zwischen Trauer und Hoffnung spreizten, Schritte über lange Wege voller Tränen, Schritte, die mich später immer aber auch neugieriger machten.
Irgendwann rief ich Thomas Brune an. Das war der Arzt, dessen Nummer auf dem Zettel stand, und schon an seiner Stimme glaubte ich zu erkennen, wie wichtig er die Angelegenheit nahm. Wie außergewöhnlich für ihn die Entdeckung einer Krankheit war, die er bisher auch nur aus Büchern kannte. Er klang beinahe begeistert, als er mir von dem kleinen türkischen Jungen erzählte, über den ich demnächst schreiben wollte, aber er klang auch sehr besorgt, wenn er von dem Leid der Familie sprach. Ich merkte gleich, er ist ein Arzt, der nicht nur die Tummelplätze seiner Eitelkeiten kennt, der nicht hilft und forscht, um sich selbst zu gefallen. So wie er redete, hatte er wohl auch immer die Dinge des Lebens im Blick, die sich nicht mit dem Skalpell regeln lassen.
Er sprach von Glaube, Ohnmacht und Vertrauen, und als sein Ton ernster wurde, sprach er von Schlaganfällen, Herzinfarkten und verkrümmten Fingern. Ich muss diese Krankheit erst begreifen, sagte er, bevor ich sie bekämpfen kann. Das tut gut, dachte ich, kein Gott in Weiß, der sich in der Allmacht seines Wissens gefällt, er steht dazu, dass ihm die Progerie unheimlich ist, und zieht es vor, sich in einer glaubhaften Bescheidenheit zu wähnen. Wie oft hatte ich Ärzte am Krankenbett meines Sohnes kennen gelernt, die immer alles besser wussten und Hoffnungen vor sich herschoben, die sie so lange gewissenlos verbreiteten, bis sie sich feige aus den Zimmern stahlen, wenn der Tod vor den Türen der Kinder stand. Dann gingen sie und kamen nicht wieder. Doch was sagte mir Herr Brune? Ich muss erst begreifen, bevor ich etwas unternehmen kann. Das war eine kluge Einsicht, die mir gefiel, und daran änderte sich auch nichts, als wir zum ersten Mal aufeinander trafen.
An einem heißen Juninachmittag im Sommer 2002 fuhren wir gemeinsam mit dem Auto in eine kleine Stadt bei Dortmund, um die Familie des kranken Kindes zu besuchen. Auf dem Weg dorthin erzählte mir Thomas Brune, wie alles angefangen und sich ihm ganz langsam eine Krankheit ins Bewusstsein geschlichen hatte, die stets weit weg war, so weit weg und nicht vorhanden in dem Alltag eines Arztes, dass er fast erschrak, als er die Diagnose eines Tages in den Händen hielt. Ein paar Wochen vorher war die Mutter des kleinen Jungen zu ihm in die Uniklinik Münster gekommen, und wenn er ehrlich ist, bemerkte er sie nur, weil sie auf einem Flur mit anderen, wartenden Eltern so eindringlich nach ihm verlangte, dass es keiner wagte, sich ihr in den Weg zu stellen. Sie war sehr aufgeregt und wollte sich nicht vertrösten lassen, zu lange schon wurde sie getrieben von einem scheuen Verdacht, dass irgendetwas mit ihrem zehn Monate alten Sohn nicht stimmte. Seine Haut war hart und ledern, sie hatte große, verhornte Flecken, und beim Wickeln fielen ihr immer diese dünnen, steifen Beine auf, die sich nicht so strecken ließen, wie er wollte. Außerdem blieben seine Haare in der Bürste hängen, er aß und wuchs nicht richtig und klammerte sich hilflos mit krummen Fingern an ihre Brust.
Sie hatte Angst, als sie ins Krankenhaus kam, sie zitterte am ganzen Körper, sie konnte nicht schlafen, und sie fürchtete sich davor, verrückt zu werden, weil man sie für eine hysterische Mutter halten könnte, die wegen jedem kleinen Schnupfen gleich zum Doktor rennt. Doch sie wusste, mit meinem Kind stimmt was nicht, es war ein unheilvolles Gefühl, das sich nicht richtig erklären ließ, ein Instinkt brannte ihr auf der Seele, den wohl nur Mütter wahrnehmen können. Sie wollte die Wahrheit, jetzt und gleich, sie wollte wissen, warum ihr Sohn so viele Runzeln hatte und eine lange, spitze Nase, und nichts hasste sie mehr als taube Ohren und grinsende Überheblichkeiten. Sie hatte Tränen in den Augen vor Verzweiflung, und als man sie im Krankenhaus doch wieder abweisen wollte, rief sie angeblich so laut, dass es jeder hören konnte: »Auch Türken haben kranke Kinder!«
Thomas Brune bat sie herein, kommen Sie nur, sagte er, bleiben Sie ruhig, aber schon während er bei dem kleinen Jungen die ersten Untersuchungen anstellte, kam ihm ein erster, leiser Verdacht. Er wollte es selbst nicht glauben, alles sträubte sich in ihm, und eine seltsame Erregung stieg in ihm hoch, als habe er gerade eine neue medizinische Entdeckung gemacht. Sein Wissen sprudelte ihm im Hirn, seine Gedanken tobten, aber noch weigerte sich sein Verstand, das anzunehmen, was er vermutete. Er schaute dem kleinen Jungen in den Mund, befühlte Arme und Beine, tastete ihm den ausgezehrten Körper ab, bemerkte sein verändertes Schlüsselbein und suchte nach weiteren Hinweisen für seine schlimme Befürchtung. Doch je länger er suchte, desto mehr bestätigte sich seine Vermutung: Er hatte einige typische Merkmale der Krankheit Progerie entdeckt.
Bisher kannte Thomas Brune diese Krankheit nur von Bildern, er hatte noch nie ein Kind damit gesehen, weil sie so unglaublich selten ist. Progerie! Er fühlte sofort die Dramatik dieses außerordentlichen Augenblickes, sie kribbelte ihm bis in die Fingerkuppen, und obwohl er sich noch nicht sicher war, empfand er eine große Erregung für seine vorsichtige Mutmaßung. Das hier war kein Keuchhusten, kein Scharlach, keine Lungenentzündung oder womit man es sonst so oft zu tun hatte. Nein, das hier war wahrscheinlich die Tragik einer körperlichen Kümmernis, wie er sie nicht oft erlebte. Er war zwar ein sehr erfahrener Arzt, der mit seinem Kollegen Thorsten Marquardt schon schwere Störungen des Stoffwechsels erforscht und erfolgreich behandelt hatte. Sie hatten Kindern geholfen, wieder Kinder zu sein und nicht bewegungslos im Bettchen zu siechen. Sie hatten jungem Leben wieder Mut und sich in Deutschland einen großen Namen gemacht. Doch das hier, wussten sie, das hier könnte auch für sie der Anfang für ein neues medizinisches Denken werden. Für die Erkenntnis, wie scheußlich eilig es das Dasein manchmal hat und wie wenige Mittel es dabei aufhalten konnten.
Natürlich musste sich der Verdacht aber zuerst bestätigen. Thomas Brune röntgte den kleinen Jungen, machte Fotos und nahm ihm Blut ab, beriet sich lange mit Torsten Marquardt und schickte eine Gen-Probe zu einem befreundeten Fachmann nach München. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, sie kam kurz, mitleidlos, und sie klang fast ein wenig begeistert, Progerie, schrieb der Experte, Progerie, wie sie eindeutiger nicht sein konnte, und Thomas Brune lief es kalt den Rücken herunter. Ich habe schon viel Leid gesehen, sagte er mir während der Autofahrt, es regt mich immer wieder auf, ich will helfen, soweit es in meiner Macht steht, doch bei dieser grausamen Krankheit muss ich nicht nur an das Kind, sondern auch an die große Not der Familie denken. Nach langem Zögern zeigte er Meral Sancar, wie die Mutter des Jungen hieß, ein paar Tage später Bilder von Kindern mit Progerie. Dort sah sie Kinder mit Glatzen, Kinder mit riesigen Köpfen auf erbärmlich winzigen Körpern, Kinder mit traurigen, wimpernlosen Augen, Kinder mit tiefen Wangen- höhlen und krummen Nasen, Kinder, vor deren unschuldige Gesichter sich eine greise Maske schob, Kinder, an denen das Leben im Zeitraffer vorüberzog.
Lieber Gott, rief sie beim Betrachten der Bilder, was für Kinder! Niemals wird mein hübscher Sohn so aussehen wie sie! Diese verschrumpelten Rümpfe auf schwachen, steifen Beinen, diese haarlosen Schädel, durch die der Tod lächelte, diese breiten Runzeln, die sich in ihre schlaffen Backen gruben, diese schleppende, gebückte Gleichgültigkeit, die sie beschwor: Ertrage mich oder verschwinde wieder! Sie alle erlebten den Amoklauf ihrer Zellen, sie trugen den Schrecken von Vergänglichkeit auf ihren müden Mienen und waren der lebende Beweis dafür, wie unberechenbar die Schöpfung sein kann. Meral Sancar wischte sich die Tränen weg, sie weinte, weil ihr die Bilder so grausam erschienen, Bilder, die sie noch gar nicht begriff und wohl auch niemals begreifen würde. Sie weinte aus Angst vor der Zukunft, wegen dieser Brutalität von Natur, die sich nicht beherrschen ließ, weil ein paar Gene durchgeknallt waren. Aber sie konnte die Augen nicht verschließen und musste der Wahrheit ins Gesicht sehen, so sehr es auch schmerzte. Kinder mit Progerie können Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Gicht bekommen, wenn die Spielgefährten gerade zum ersten Mal zur Schule gehen. Sie haben Schmerzen in ihren Gelenken, sie schlurfen erschöpft durch eine Kindheit, die niemals beginnt, sie werden erbarmungslos vom Alter gejagt und wenn sie zehn sind, ist ihr Körper siebzig, weil sie dem Alter nicht entkommen können. Thomas Brune hatte versucht, der Mutter das Grauen dieser Bilder zu nehmen, er wollte sie mit ihrer Angst vor der Zukunft versöhnen, aber er wusste auch, dass er die Pflicht hatte, ihr nichts zu verschweigen.
Als wir vor der Haustür standen und klingelten, wurden wir sehr freundlich empfangen und ich hatte sofort das Gefühl, auf eine Ehrlichkeit zu treffen, die dir tief in dein Herz stößt. Meral Sancar stand dort mit einem Gesicht, das gleichzeitig lachen und weinen konnte, sie breitete ihre Arme aus, und wenn ich ein Kind gewesen wäre, hätte ich mich bestimmt gleich an sie gepresst. Es war eine gemütliche Enge, in die wir hineingezogen wurden, ich konnte ihr nicht widerstehen, und obwohl ich eher ein abwartender, scheuer Mensch bin, taute ich bei so viel menschlicher Wärme schneller auf, als mir lieb war. Sie ging auf mich zu, ich konnte ihr gar nicht ausweichen, sie trug eine Haut wie dunkle Seide, an Hals und Fuß glitzerten Ketten, und sie zeigte mit strenger Miene auf ein Schriftstück aus dem Koran, das vor Gästen mit schlechten Absichten warnte und ein wenig schief über dem Türeingang hing. Irgendwie glaubte ich mich wie in einem Märchen, in dem du alle Vorsicht aufgibst und dich von den Geschichten treiben lässt, es war etwas an dieser ersten Begegnung, das dem Drama seiner kommenden Bedeutung gerecht werden sollte, aber noch wollte ich nicht daran denken, dass dieses Märchen eines Tages schlecht ausgehen würde.
Diese Nähe, diese Wärme, dieses mutige Vertrauen überraschte mich sehr, ich hatte es nicht erwartet bei einer türkischen Familie, die in Deutschland lebt und sich bei so großem Leid eigentlich auch im stillen Trotz zurückziehen könnte. Schließlich kam ich hier als jemand, der sich von nun an in ihr Leben einmischen musste, um ihre Ängste zu verstehen, der sie mit traurigen Fragen stören würde und dann ihren Schmerz heraustragen wollte aus ihrer Vierzimmerwohnung im dritten Stock, damit dort draußen Menschen teilhaben konnten an ihrem Stolz, ihrer Ehre und ihrem starken Willen. Ich kam als Freund und ging als Freund, daran sollte sich auch in den nächsten zwei Jahren nicht viel ändern, und als ich nach meinem ersten Besuch aufbrach, kannte ich sogar ihre Träume. Das heißt, einen ganz bestimmten Traum, den Meral Sancar geträumt hatte, einen Traum, der ihr im Hals brannte, dessen böse Ahnung ihr die Kehle zuschnürte, der ihr im Bewusstsein stecken blieb und sich, so sehr sie sich auch mühte, nicht herunterwürgen lassen konnte. Es war ein Traum, in dem sie die fürchterliche Krankheit ihres Kindes zwar gesehen hatte, aber nicht begreifen konnte. Sie wusste nur, eine schlimme Endgültigkeit schleicht sich unter meine Kissen, und bald würde nichts mehr so wie früher sein. Das alles wollte sie mir erzählen, sie glaubte wie so viele Türken an die Bedeutung ihrer Träume, aber bevor wir dazu kamen, stellte sie mir ihren kleinen, kranken Jungen vor.
Die ganze Zeit schon hatte ich erwartet, dass mir ein junger Greis entgegenwankt, eine zittrige Laune der Natur, die sich an meine Hosenbeine klammern würde, weil die Kraft zum Stehen fehlte. In meinem Kopf spuckten wirre Bilder von Kindern herum, die durch die Zeit rasten, es drängten sich kleine, traurige Gestalten auf, die mir ihre müden Gesichter zeigten, wenn ich nur die Augen schloss, und ich glaube, es war ein großer Fehler, dass ich vorher so viel über Progerie gelesen hatte. Dass ich mich anstecken ließ von dem menschlichen Schrecken über diese Krankheit, von dieser schleichenden Befürchtung, dass Logik nicht mehr funktioniert, wenn dir das Alter verächtlich ins Gesicht blickt.
Doch dann kam alles anders. Ich sah den Jungen und wusste nicht, warum ich ernsthaft daran zweifeln sollte, dass in dieser Welt nicht doch alles mit rechten Dingen zugeht. Ich sah ihn, wie er mit einem sanften Grinsen um die Ecke blickte, während sich der Rest seines winzigen Körpers noch hinter einer Tür befand. Ich schaute auf einen Kopf mit strenger, faltiger Stirn, aus der ganz oben schwarze Haarbüschel wuchsen, und ich dachte nur: Was für ein hübsches Kind! Was für ein Liebreiz seiner braunen Augen, mit denen er zu sprechen schien. Die Pupillen rollten friedlich in den Augenhöhlen, zwei große, geheimnisvolle Kugeln, die sich mit großer Neugier drehten, in denen sich seine Wünsche spiegeln konnten, aber bestimmt auch seine Vorsicht vor allem, was ihm fremd vorkam. Nie wieder werde ich diesen Moment vergessen. Diesen dunklen Kopf ohne Körper hinter der weißen Tür. Das ließ die konzentrierte Sicht auf eine Miene zu, die mich sofort in ihren Bann zog, sie wirkte eindringlich und verletzlich und nahm mich für die fast komisch wirkende Ansicht ein, dass hier ein krankes Kind versuchte, das Entsetzen seiner Zukunft zu verjagen, indem es mich mit einem stillen Lächeln für die Gegenwart gewinnen wollte.
Bei mir schaffte er es sofort, als er endlich vollständig zum Vorschein kam und in seinem Laufstuhl vor uns stehen blieb. Hier bin ich! Ich mochte ihn gleich, diesen traurigen Blick, der sich sekundenschnell mit Heiterkeit vermischen konnte, diese unberechenbaren Züge, die alle Stimmungen nach außen trugen, und während er dort stand mit seinen dreizehn Monaten, hatte ich das Gefühl, dass dieses Kind nichts, aber auch wirklich nichts mit einer Krankheit zu tun haben konnte, über die ich bisher so schreckliche Dinge erfahren hatte. Natürlich sah er krank aus. Natürlich war er anders. Er hatte die typische Nase, die spitz und knöchern ist, er schwitzte wegen seiner harten Haut so stark, dass seine Mutter ihm dreimal am Tag die Kleidung wechseln musste, wie sie uns sagte. Außerdem schlug ihm die Zunge gegen den Gaumen, und in der Nacht schnarchte er so laut, erfuhren wir, dass kaum einer schlafen konnte.
Wir alle also huldigten diesem dürren Kerl, im warmen, weichen Sonnenlicht des Wohnzimmers, wir näherten uns vorsichtig und ließen ihm seinen Trotz, er schwitzte im erschöpften Glück und spielte genüsslich mit unserer großen Neugier. Er lief von einem zum anderen, freudig, ernst und nachdenklich, er berührte uns mit dem rauen Schorf seiner Hände, und fast glaubte ich, dass er mit unseren Hemmungen kokettieren wollte. Jedenfalls blieb er der kleine, kranke König, die wichtige Mitte einer gefassten Runde, die sich von seinen Launen leiten ließ, und ich war nur froh, dass er nicht das Schicksal einer Frau kannte, die in der Zwischenzeit zu uns gestoßen war, weil Thomas Brune sie gebeten hatte, vorbei zu kommen. Sie wohnte nicht sehr weit entfernt, hieß Kerstin Wiechers und hatte eine Tochter, die mit elf Jahren an Progerie gestorben war. Kann das Zufall sein?, hatte Thomas Brune mich gefragt, bei einer so seltenen Krankheit, doch schon während er mich fragte, wusste ich, dass ich ihm darauf keine sinnvolle Antwort geben konnte.
Am Abend des Geburtstages ihres Großvaters klagte Svenja über Unwohlsein, sie legte sich müde hin und hörte einfach auf zu atmen. Sie hatte keine Furcht vor dem Sterben gehabt, sagte Frau Wiechers, und hat ihr kurzes Dasein mit Würde ertragen. Sie war ein starkes Mädchen, das sich von ihrem Aussehen niemals einschüchtern ließ, und schon gar nicht von der Gemeinheit böser Vorurteile. In der Schule hatte sie so ein blöder Typ auf dem Weg zur Klasse angeschrien: »Alte Kuh, du bist ja doch bald tot! « Aber auch das ertrug sie mit der Kraft ihres großen, unumstößlichen Mutes, und eines Tages erzählte Svenja ihrer Mutter, dass sie an die Wiedergeburt glauben würde. Deshalb wollte sie schön sein für ihren neuen Start ins Leben und wünschte sich, in einem weißen Sarg zu liegen, mit schwarzen Lackschuhen und langem Kleid. Ich habe es so gemacht, wie meine Tochter es wollte, sagte Frau Wiechers, und wir alle schauten uns betroffen an. Keiner wollte mehr sprechen, ich erst recht nicht, weil ich an meinen Sohn dachte, an seine geliebten Spielsachen, die wir ihm mit unter die Erde gaben, und dann sagte Thomas Brune in die befremdliche Stille hinein: »Frau Wiechers ist gekommen, um zu helfen. Sie können sie fragen, wenn Sie Hilfe brauchen, sie hat alles erlebt, was Ihnen noch bevorsteht.« Aber heute wollte Meral Sancar nichts mehr wissen, sie weinte und nahm ihr Kind zum Stillen an die Brust.
Es gab noch viele, prägende Eindrücke an diesem Tag unserer ersten Begegnung, Eindrücke, die haften blieben und sich nicht abschütteln ließen, so sehr ich mich bemühte. Aber warum auch, dachte ich, sie gehören ja zu der Geschichte, zur Dramatik dieser Krankheit, und als Meral Sancar mir am Ende unseres Treffens auch noch ihren Traum erzählte, war ich erstaunt über ihre offene Art und Weise, mit jemandem über das Innerste ihrer Gefühle, über das Private ihrer Gedanken zu reden, den sie vor ein paar Stunden nicht einmal kannte. Ich merkte, es musste aus ihr heraus! Sie konnte nicht vor etwas davonlaufen, das sie doch immer wieder einholte, und so zogen wir uns zurück, saßen auf einer Bettkante im Kinderzimmer und sprachen über einen Traum, der ihr Leben vor zwölf Wochen so nachhaltig verändern sollte.
Doch hier und heute hatte ich den Eindruck, einen kleinen Prinzen in einem Laufstuhl vor mir zu haben, er saß auf einem quietschenden Thron mit Rädern und hatte sein Volk um sich versammelt. Seine Brüder Mehmet und Ahmet waren da, sie folgten ihm ergeben auf Schritt und Tritt in seinem Gefährt, strichen ihm über seine mageren Wangen und küssten ihm von oben auf die kahlen Stellen seines Schädels. Sie müssen ihn sehr lieben, dachte ich, bestimmt nicht nur, weil er krank ist. Seine Schwester Cennet war da, sie hob ihm das Spielzeug auf, das ihm aus seinen krummen Fingern glitt, und sorgte sich mit der friedlichen Geduld eines kleinen Engels um ihn, sodass sie zumindest an diesem Nachmittag ihrem Namen alle Ehre machte, der auf Deutsch das Paradies bedeutet. Und seine Mutter war da, das schien ihm wohl das wichtigste zu sein, er klebte an ihr wie eine Klette, während sein Vater Ali nicht zu Hause war, weil er kurz zuvor die Wohnung im Streit mit seiner Frau verlassen hatte. Auch er liebte den Jungen sehr, wie ich später selbst erfuhr, aber die Vorstellung, ein Kind zu haben, das nicht dem türkischen, männlichen Stolz von Kraft und Ehre entsprach, brachte ihn fast um und ließ ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. Seit die Krankheit feststand, war er oft weg.
Sie hatte von einem brennenden Tier in einer dunklen Höhle geträumt. Das Tier brannte ganz langsam, es hüllte sich in eine gefräßige Brunst und starb entsetzlich brüllend von unten nach oben. Die Flammen züngelten sich unaufhörlich an den Kopf heran, und je höher sie kamen, desto deutlicher konnte sie das hübsche Gesicht ihres Sohnes erkennen. Kurz darauf sah sie ihn in der Glut verschwinden, er lächelte ihr zum Abschied tapfer zu, und seine wunderschönen Augen waren das letzte, was sie von ihm wahrnehmen konnte. Dann war er wieder verschwunden, verschluckt vom dichten Rauch und vom Erwachen seiner Mutter. Er sah so aus, sagte Meral Sancar, als würde er glücklich in den Himmel schweben, während sie sich aufsetzte und zitterte. Das war zu viel für sie! Ein Traum von einem Feuer, das ihr das Kind nehmen wollte. Was konnte das nur bedeuten? Lieber Gott, lass es nicht wahr werden, betete sie, aber noch wusste sie damals nicht, wovor sie sich eigentlich fürchtete.
Sie schilderte es mir so anschaulich, als hätte ich es selbst geträumt. Die Bilder waren grell, sie blendeten und schrien mich an und wirkten wie mit Blut gemalt. Niemals zuvor hatte ich von einem Traum gehört, an den man sich so genau erinnern konnte. Jetzt aber war ich eingeweiht in ihre Angst, ich hatte ihr Vertrauen und wollte sie nicht enttäuschen. Denn so leicht hatte mir in meinem Beruf noch niemals ein Mensch das Vertrauen geschenkt, du hast nun eine moralische Verpflichtung, sagte ich mir, du bist ein Besucher ihrer
Seele, und ich fühlte schon dort, an jenem Nachmittag auf
der Bettkante, dass ich mich diesem Vertrauen stellen wollte.