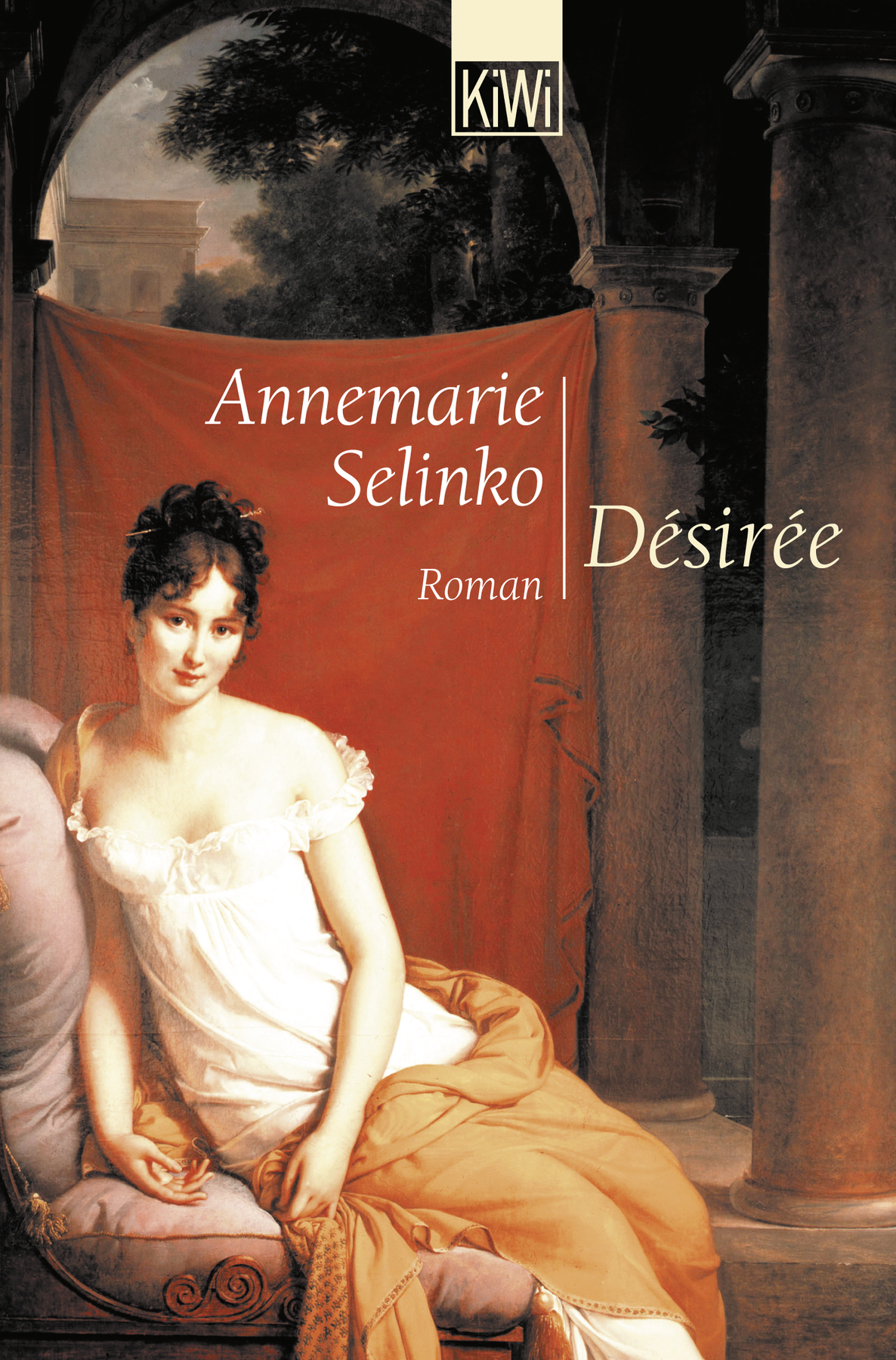
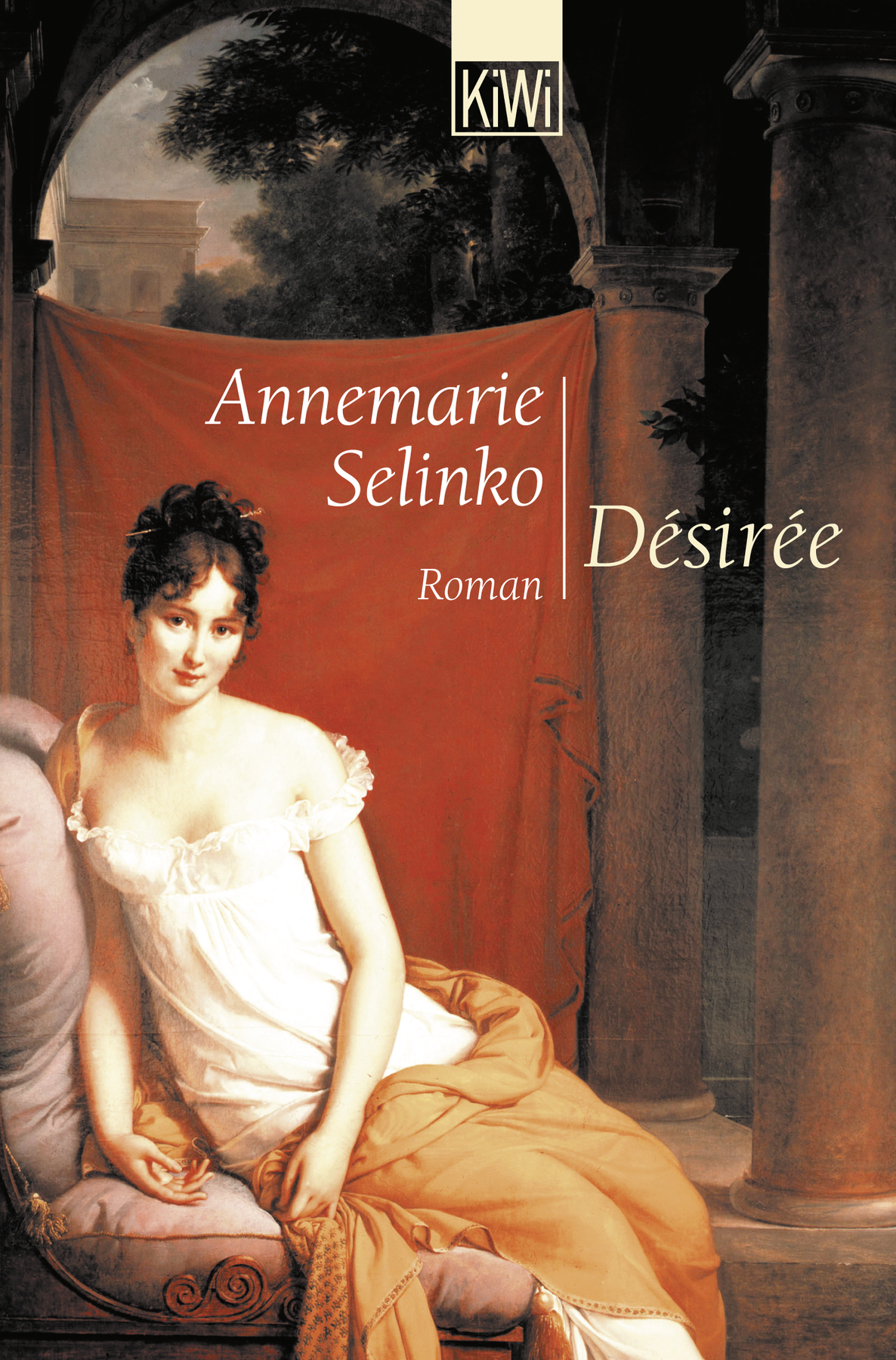
Dem Andenken meiner Schwester Liselotte, ihres Frohsinns und ihrer Herzensgüte, in tiefem Leid gewidmet.
Ich glaube, eine Frau kann viel leichter bei einem Mann etwas durchsetzen, wenn sie einen runden Busen hat. Deshalb habe ich mir vorgenommen, mir morgen vier Taschentücher in den Ausschnitt zu stopfen, um wirklich erwachsen auszusehen. In Wirklichkeit bin ich natürlich schon ganz erwachsen, aber das weiß nur ich, und man sieht es mir noch nicht richtig an.
Letzten November wurde ich vierzehn Jahre alt, und Papa schenkte mir zum Geburtstag dieses schöne Tagebuch. Es ist natürlich schade, diese feinen weißen Seiten voll zu schreiben. Das Buch hat auch ein kleines Schloss, und ich kann es absperren. Nicht einmal meine Schwester Julie wird wissen, was darin steht. Es ist das letzte Geschenk von meinem guten Papa. Mein Papa war der Seidenhändler François Clary in Marseille, er ist vor zwei Monaten an Lungenentzündung gestorben. »Was soll ich denn in das Buch hineinschreiben?«, fragte ich ratlos, als ich es auf dem Geburtstagstisch fand. Papa lächelte und küsste mich auf die Stirn: »Die Geschichte der französischen Bürgerin Eugénie Désirée Clary«, sagte er und bekam plötzlich ein gerührtes Gesicht. Ich beginne heute Nacht meine zukünftige Geschichte aufzuschreiben, weil ich so aufgeregt bin, dass ich nicht einschlafen kann. Deshalb bin ich leise aus dem Bett gekrochen, hoffentlich wacht Julie, die im selben Zimmer schläft, nicht durch das Flackern der Kerze auf. Julie würde mir nämlich einen schrecklichen Krach machen. Und aufgeregt bin ich, weil ich morgen mit meiner Schwägerin Suzanne zum Volksrepräsentanten Albitte gehen soll, um ihn zu bitten, Etienne zu helfen. Etienne ist mein großer Bruder, und es geht um seinen Kopf. Vor zwei Tagen kam plötzlich die Polizei und verhaftete ihn. Wir wissen nicht, warum. Aber so etwas kann leicht in diesen Zeiten passieren, es ist ja noch nicht einmal fünf Jahre her, seitdem wir die große Revolution hatten, und manche Leute behaupten, sie sei noch gar nicht zu Ende. Jedenfalls werden jeden Tag viele Leute vor dem Rathaus guillotiniert, und es ist lebensgefährlich, mit Aristokraten verwandt zu sein. Aber wir sind Gott sei Dank nicht mit feinen Leuten verwandt. Papa hat sich selbst hinaufgearbeitet und den winzigen Kaufmannsladen seines Vaters in eines der größten Seidenwarengeschäfte von Marseille verwandelt. Und Papa war sehr froh über den Beginn der Revolution, obwohl er knapp vorher Hoflieferant geworden war und der Königin blauen Seidensamt schickte. Der Stoff ist nie bezahlt worden, sagt Etienne. Papa hatte feuchte Augen, als er uns das Flugblatt, in dem zum ersten Mal die Menschenrechte abgedruckt waren, vorgelesen hat.
Seit Papas Tod führt Etienne das Geschäft. Nach Etiennes Verhaftung nahm mich unsere Köchin Marie, die früher meine Amme war, beiseite und sagte: »Eugénie, ich habe gehört, dass Albitte in die Stadt kommt! Deine Schwägerin muss zu ihm gehen und versuchen, Bürger Etienne Clary freizubekommen.« Marie weiß immer alles, was in der Stadt vorgeht. Beim Abendessen waren alle sehr traurig. Zwei Plätze waren leer. Papas Stuhl neben Mama und Etiennes neben Suzanne. Mama erlaubt nicht, dass sich jemand auf Papas Platz setzt. Ich dachte fortwährend an Albitte und drehte Brotkügelchen. Worauf Julie – sie ist nur vier Jahre älter als ich, aber sie will mich fortwährend bemuttern, und das macht mich manchmal ganz krank vor Wut –, worauf also Julie sofort sagte: »Eugénie, es ist ungezogen, Brotkügelchen zu drehen.« Da hörte ich auf und sagte: »Albitte ist in der Stadt!« – Es machte keinen Eindruck. Wenn ich etwas sage, macht es nie Eindruck. Deshalb wiederholte ich: »Albitte ist in der Stadt!« Endlich fragte Mama: »Wer ist Albitte, Eugénie?« Suzanne hörte gar nicht zu, sondern schluchzte in die Suppe.
»Albitte ist der jakobinische Abgeordnete von Marseille«, sagte ich, stolz über mein Wissen. »Er bleibt eine Woche hier und hält sich tagsüber im Maison Commune auf. Und Suzanne muss morgen zu ihm gehen und ihn fragen, warum Etienne verhaftet worden ist. Und dann muss sie ihm erklären, dass es sich nur um ein Missverständnis handeln kann.«
Suzanne sah auf und schluchzte: »Aber er wird mich nicht empfangen!«
»Ich glaube – ich glaube, es ist besser, wenn Suzanne unseren Advokaten bittet, mit Albitte zu sprechen«, meinte Mama zögernd. Ich muss mich oft über meine Familie ärgern, Mama würde nicht zulassen, dass auch nur ein Glas Marmelade bei uns gekocht wird, ohne zumindest einmal selbst im Topf herumzurühren. Aber lebenswichtige Dinge überlässt sie unserem altersschwachen Advokaten! Ich glaube, viele Erwachsene sind so.
»Man muss selbst mit Albitte sprechen«, sagte ich. »Und Suzanne als Etiennes Frau sollte hingehen. Wenn du Angst hast, Suzanne, werde ich es versuchen und von Albitte verlangen, dass mein großer Bruder freigelassen wird.«
»Untersteh dich, ins Maison Commune zu gehen!«, sagte Mama sofort. Dann nahm sie wieder den Suppenlöffel.
»Mama, ich finde, dass –«
»Ich möchte nicht weiter über die Angelegenheit sprechen«, sagte Mama. Suzanne schluchzte wieder in die Suppe.
Nach dem Essen lief ich in die Mansarde hinauf, um zu sehen, ob Persson zu Hause war. Persson lernt nämlich abends bei mir Französisch. Er hat das liebste Pferdegesicht, das man sich vorstellen kann. Er ist sehr hoch gewachsen, schrecklich mager und der einzige blonde Mann, den ich kenne. Dafür ist er auch ein Schwede. Weiß der Himmel, wo Schweden liegt, irgendwo in der Nähe vom Nordpol glaube ich. Persson hat es mir zwar einmal auf einer Landkarte gezeigt, aber ich habe es vergessen. Perssons Papa hat ein Seidengeschäft in Stockholm, das in Verbindung mit unserer Firma steht. Und so kam der junge Persson auf ein Jahr nach Marseille, um bei Papa zu volontieren. Seidenhandel kann man nämlich nur in Marseille lernen, behaupten alle. Eines Tages erschien Persson bei uns. Zuerst konnten wir ihn gar nicht verstehen, obwohl er behauptete, mit uns Französisch zu sprechen. Es klang nämlich nicht wie Französisch. Mama räumte ihm ein Zimmer in der Mansarde ein und sagte, Persson solle in diesen unruhigen Zeiten bei uns wohnen.
Ich fand Persson zu Hause, er ist ja ein solider junger Mann, und wir setzten uns ins Wohnzimmer. Meistens muss er mir aus den Zeitungen vorlesen, und ich verbessere seine Aussprache. Und wie so oft holte ich das alte Flugblatt mit den Menschenrechten, das Papa seinerzeit nach Hause gebracht hatte, und wir hörten uns gegenseitig ab, weil wir den Wortlaut auswendig lernen wollen. Perssons Pferdegesicht wurde ganz ernst dabei, und er sagte, dass er mich beneide, weil ich zu jener Nation gehöre, die der Welt diese großen Gedanken geschenkt hat. »Freiheit – Gleichheit – Volkssouveränität«, deklamierte er neben mir. Und dann sagte er: »Es ist viel Blut geflossen, um diese neuen Gesetze durchzuführen. Und so viel unschuldiges Blut. Es darf nicht vergeblich gewesen sein, Mademoiselle.«
Persson ist ja Ausländer und sagt immer »Madame Clary« zu Mama und »Mademoiselle Eugénie« zu mir, obwohl das verboten ist, wir sind einfach die »Bürgerinnen Clary«.
Plötzlich erschien Julie im Wohnzimmer. »Bitte komm einen Augenblick, Eugénie!«, sagte sie und führte mich in Suzannes Zimmer.
Suzanne kauerte auf dem Sofa und nippte Portwein. Portwein stärkt angeblich, aber ich bekomme nie ein Glas, weil sich junge Mädchen noch nicht stärken müssen, sagt Mama. Mama saß neben Suzanne, und ich konnte ihr ansehen, dass sie versuchte, energisch zu sein. In solchen Augenblicken wirkt sie besonders zart und hilflos, sie zieht die schmalen Schultern zusammen, und ihr Gesicht ist ganz klein unter dem schwarzen Witwenhäubchen, das sie seit zwei Monaten trägt. Meine arme Mama erinnert viel mehr an ein Waisenkind als an eine Witwe.
»Wir haben beschlossen, dass Suzanne morgen versuchen soll, zum Volksrepräsentanten Albitte durchzudringen. Und –« Sie räusperte sich: »Und du wirst sie begleiten, Eugénie!«
»Ich fürchte mich, allein zu gehen. All die vielen Menschen …«, murmelte Suzanne. Ich konstatierte, dass der Portwein sie nicht stärkte, sondern schläfrig machte. Und ich wunderte mich, warum ich mitgehen sollte und nicht Julie.
»Suzanne will Etienne zuliebe diesen Weg auf sich nehmen, und es ist ein Trost für sie, dich, mein liebes Kind, an ihrer Seite zu wissen«, sagte Mama.
»Du hast dort natürlich den Mund zu halten und Suzanne reden zu lassen«, fügte Julie hastig hinzu. Ich war froh, dass Suzanne zu Albitte gehen wollte. Der beste Weg. Der Einzige, meiner Ansicht nach. Aber da man mich immer als Kind behandelt, schwieg ich. »Der morgige Tag wird für uns alle große Aufregungen bringen«, sagte Mama und erhob sich. »Wir wollen deshalb zeitig schlafen gehen.« Ich lief ins Wohnzimmer zurück und sagte Persson, dass ich schon schlafen gehen müsse. Er packte die Zeitungen zusammen und verbeugte sich. »Dann will ich angenehme Ruhe wünschen, Mademoiselle Clary.« Ich war schon beinahe aus der Tür, als er plötzlich etwas murmelte.
Ich wandte mich um. »Haben Sie etwas gesagt, Monsieur Persson?« »Es ist nur –« Er stockte. Ich ging auf ihn zu und versuchte, in sein Gesicht zu blicken. Es war schon beinahe dunkel, und ich war zu faul, die Kerzen anzuzünden, wir waren ja im Begriff, schlafen zu gehen. Perssons blasses Gesicht verschwamm völlig in der Dämmerung. »Ich wollte nur sagen, Mademoiselle, dass ich – ja, dass ich bald nach Hause reisen werde.«
»Oh – das tut mir Leid, Monsieur. Warum?«
»Ich habe es Madame Clary noch nicht gesagt, ich wollte sie nicht gerade jetzt mit meinen Angelegenheiten bemühen. Aber sehen Sie, Mademoiselle – ich bin ja schon über ein Jahr hier, und man braucht mich wieder in unserem Laden in Stockholm. Und wenn Monsieur Etienne Clary zurückkehrt, dann ist bei Ihnen wieder alles in Ordnung – ich meine, auch im Geschäft –, und dann reise ich nach Stockholm zurück.« Es war die längste Rede, die ich jemals von Persson gehört hatte. Ich konnte auch nicht recht verstehen, warum er gerade mir zuerst von seiner Abreise erzählte. Bisher hatte ich geglaubt, dass Persson mich ebenso wie alle anderen nicht recht ernst nahm. Aber nun wollte ich natürlich die Konversation fortsetzen, kehrte zum Sofa zurück und deutete mit sehr damenhafter Handbewegung an, dass Persson sich neben mich setzen sollte. Kaum saß er, so klappte seine lange magere Gestalt wie ein Taschenmesser zusammen, und er stützte die Ellenbogen auf die Knie und wusste sichtlich nicht, was er sagen sollte. »Ist Stockholm eine schöne Stadt?«, fragte ich höflich. »Die schönste der Welt – für mich«, erklärte Persson. »Grüne Eisschollen treiben im Mälar, und der Himmel ist weiß wie eine frisch gewaschene Bettdecke. Im Winter nämlich, aber der Winter ist bei uns sehr lang.« Also – sehr schön schien mir Stockholm nach dieser Beschreibung nicht zu sein. Im Gegenteil. Auch war mir nicht ganz klar, wo die grünen Eisschollen herumschwammen. »Unser Laden liegt in der Västerlanggatan – das ist die modernste Geschäftsstraße von Stockholm, gleich hinter dem Schloss«, sagte Persson stolz. Aber ich hörte nicht richtig zu, sondern dachte an morgen, und dass ich mir Taschentücher in den Ausschnitt stopfen und – »Ich wollte Sie um etwas bitten, Mademoiselle Clary«, hörte ich jetzt Persson sagen. Ich muss so hübsch wie möglich aussehen, damit man zumindest mir zuliebe Etienne freilässt, dachte ich und fragte höflich: »Um was denn, Monsieur?«
»Ich möchte so gern das Blatt, auf dem die Menschenrechte gedruckt stehen und das Monsieur Clary einst nach Hause brachte, behalten«, kam es stockend. »Ich weiß, es ist eine unbescheidene Bitte, Mademoiselle.« Ja, es war unbescheiden. Papa ließ das Flugblatt immer auf dem Nachttisch liegen, und nach seinem Tod hatte ich es sofort an mich genommen. »Ich werde es stets in Ehren halten, Mademoiselle«, versicherte Persson. Da neckte ich ihn zum letzten Mal: »Sie sind also Republikaner geworden, Monsieur?«
Und zum letzten Mal antwortete er ausweichend: »Ich bin ja Schwede, Mademoiselle. Und Schweden ist eine Monarchie.«
»Sie können das Flugblatt behalten, Monsieur«, sagte ich. »Und zeigen Sie es Ihren Freunden in Schweden!« In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen, und Julies Stimme überschlug sich vor Ärger: »Wann kommst du endlich ins Bett, Eugénie? Oh – ich wusste nicht, dass du mit Monsieur Persson hier sitzt! Monsieur, das Kind hat schlafen zu gehen! Eugénie – komm doch!« Ich hatte schon beinahe alle Papilloten in meine Haare gesetzt und Julie lag bereits im Bett, da zankte sie noch immer mit mir. »Eugenie, du benimmst dich skandalös, Persson ist doch ein junger Mann – und man sitzt nicht mit einem jungen Mann im Dunkeln – und Mama hat sowieso so viel Kummer – und du vergisst, dass du die Tochter des Seidenhändlers Clary bist – Papa war ein so geachteter Bürger – und Persson kann nicht einmal anständig Französisch – du bringst Schande über die Familie – –« Blahblahblah … dachte ich und pustete die Kerze aus und kroch tief unter die Decke. Julie braucht einen Bräutigam, dann wird mein Leben leichter sein, konstatierte ich.
Ich versuchte einzuschlafen, aber der morgige Besuch im Maison Commune ging mir nicht aus dem Sinn. Und ich musste auch an die Guillotine denken. Ich sehe sie so oft vor mir, wenn ich einschlafen soll, und dann bohre ich den Kopf in die Kissen, um die Erinnerung zu vertreiben. Die Erinnerung an das Beil und an den abgeschnittenen Kopf. Vor zwei Jahren nahm mich nämlich heimlich unsere Köchin Marie auf den Platz vor dem Rathaus mit. Wir drängten uns durch die Menge, die dicht um das Blutgerüst stand, ich wollte ja alles genau sehen, und ich presste die Zähne zusammen, weil sie so schrecklich aneinander schlugen, und das war mir peinlich. Der rot bemalte Karren brachte zwanzig Männer und Frauen zum Schafott. Alle hatten vornehme Kleider an, aber schmutzige Strohhalme klebten an den seidenen Hosen der Männer und den Spitzenärmeln der Damen. Ihre Hände waren mit Stricken auf dem Rücken zusammengeschnürt. Auf der Brettertribüne rund um die Guillotine sind Sägespäne aufgeschüttet, die morgens und am späten Nachmittag, immer gleich nach den Hinrichtungen, erneuert werden. Trotzdem bilden sie einen abscheulichen rotgelben Schlamm. Der ganze Rathausplatz riecht nach gestocktem Blut und Sägespänen. Die Guillotine ist wie der Karren rot angestrichen, aber die Farbe ist bereits recht abgeblättert, sie steht ja seit Jahren hier. An jenem Nachmittag kam zuerst ein junger Mann aus der Umgebung, der angeblich in geheimer Postverbindung mit dem feindlichen Ausland stand, an die Reihe. Als ihn der Scharfrichter auf das Podium zerrte, bewegte er die Lippen, ich glaube, er betete. Dann kniete er nieder, und ich machte die Augen zu und hörte das Beil herabfallen. Als ich die Augen wieder aufmachte, hielt der Scharfrichter einen Kopf in der Hand. Der Kopf hatte ein kalkweißes Gesicht und weit aufgerissene Augen, die mich anstarrten. Mir blieb das Herz stehen. Der Mund in dem kalkigen Gesicht war offen, als wollte er schreien. Der stumme Schrei hörte nicht auf. Die Leute rund um uns redeten wirr durcheinander, jemand schluchzte, und eine hohe Frauenstimme kicherte, dann schien der Lärm nur noch aus weiter Ferne zu mir zu dringen, mir wurde schwarz vor den Augen und – ja, ich musste mich übergeben. Dann war mir besser, ich begriff, dass man mich anschrie, weil ich jemandem die Schuhe schmutzig gemacht hatte, und ich hielt die Augen geschlossen, um den blutigen Kopf nicht mehr zu sehen. Marie schämte sich sehr wegen mir und zog mich aus der Menge, und ich hörte, dass man uns höhnische Worte nachrief. Und seit damals kann ich oft nicht einschlafen, weil ich an die toten Augen und den stummen Schrei denken muss.
Als wir nach Hause kamen, weinte ich furchtbar. Papa legte den Arm um mich und sagte: »Frankreichs Volk hat jahrhundertelang in furchtbarem Leid gelebt. Und aus dem Leid der Unterdrückten stiegen zwei Flammen empor: die Flamme der Gerechtigkeit und die Flamme des Hasses. Die des Hasses wird sich verzehren und in Strömen von Blut erstickt werden. Aber die andere Flamme – die heilige –, meine kleine Tochter, kann niemals wieder völlig ausgelöscht werden.«
»Nicht wahr, die Menschenrechte können nie wieder ungültig werden, Papa?«, fragte ich. »Nein, ungültig können sie nicht werden. Aber abgeschafft, offen oder heimlich, und mit Füßen getreten. Jene jedoch, die sie mit Füßen treten, laden die größte Blutschuld der Geschichte auf sich. Wann immer und wo immer in späterer Zeit Menschen ihren Brüdern das Recht der Freiheit und Gleichheit nehmen – niemand wird von ihnen sagen: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Meine kleine Tochter, seit der Verkündigung der Menschenrechte wissen sie es nämlich genau.«
Während Papa das sagte, klang seine Stimme ganz anders als sonst. Es war wie – ja, wie ich mir eben die Stimme vom lieben Gott vorstelle. Je mehr Zeit seit jenem Gespräch vergeht, umso besser verstehe ich, was Papa eigentlich meinte. Und heute Nacht fühle ich mich ihm ganz besonders nahe. Ich habe große Angst um Etienne und auch Angst vor dem Besuch im Maison Commune. Nachts hat man immer größere Angst als bei Tag. Wenn ich nur wüsste, ob ich eine lustige oder traurige Geschichte haben werde. Ich möchte schrecklich gern irgendetwas Besonderes erleben. Aber zuerst möchte ich einen Bräutigam für Julie finden. Und vor allem muss Etienne aus dem Gefängnis herausgefischt werden.
Gute Nacht, Papa; ich habe also angefangen, meine Geschichte aufzuschreiben.