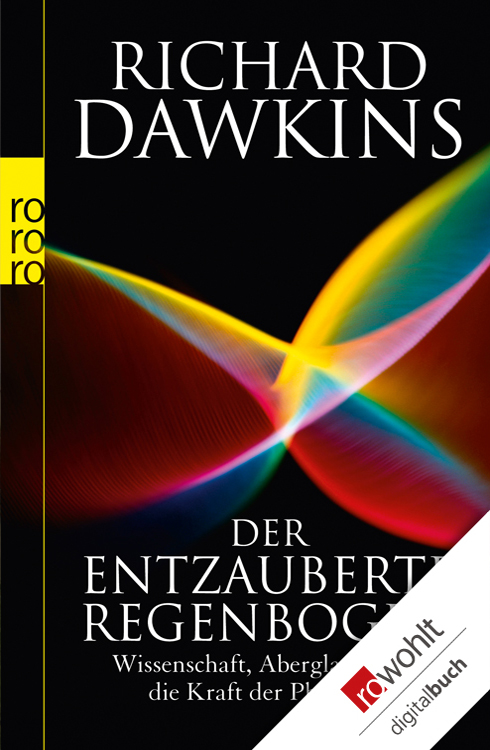
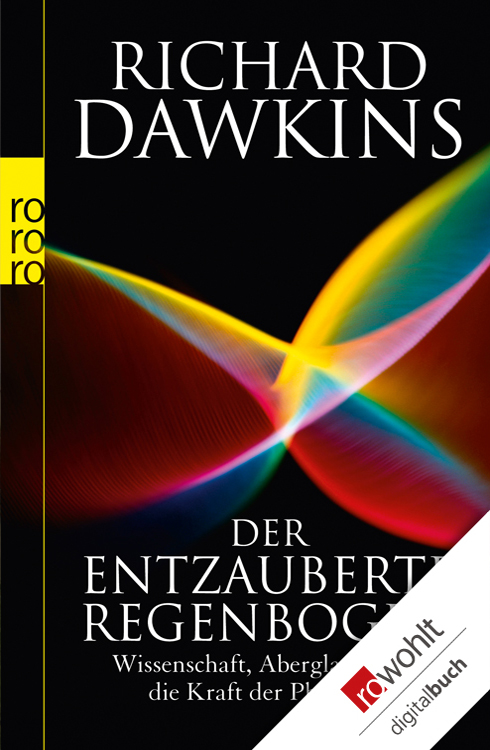
Der entzauberte Regenbogen
Wissenschaft, Aberglaube und die Kraft der Phantasie
Deutsch von Sebastian Vogel

Widmung
Vorwort
1. Die betäubende Wirkung des Vertrauten
2. Im Salon der Herzöge
3. Strichcodes in den Sternen
4. Strichcodes in der Luft
5. Strichcodes vor Gericht
6. Märchen, Geister, Sternendeuter
7. Berechnete Schauer
8. Wolkige Symbole von höchster Romantik
9. Der egoistische Kooperator
10. Das genetische Totenbuch
11. Die Welt wird neu verwoben
12. Ein Ballon zum Denken
Literatur
Register
Für Lalla
Ein ausländischer Verleger meines ersten Buches gestand mir einmal, er habe drei Nächte nicht geschlafen, nachdem er es gelesen hatte – weil ihm die Botschaft so kalt und düster vorgekommen sei. Andere fragten mich, wie ich es überhaupt fertig brächte, morgens noch aufzustehen. Ein Lehrer aus einem weit entfernten Land schrieb mir vorwurfsvoll, eine seiner Schülerinnen habe dasselbe Buch gelesen und sei dann in Tränen aufgelöst zu ihm gekommen, weil sie nun überzeugt war, ihr Leben sei leer und sinnlos. Er habe ihr geraten, das Buch nicht ihren Freundinnen zu zeigen, damit diese nicht vom gleichen nihilistischen Pessimismus angesteckt würden. Ähnliche Vorwürfe – öde Trostlosigkeit, trockene, freudlose Inhalte – werden oft ganz allgemein gegen die Naturwissenschaft erhoben, und die Naturwissenschaftler selbst tragen nur allzu leicht dazu bei. Zum Beispiel eröffnet mein Kollege Peter Atkins sein 1984 erschienenes Buch The Second Law:
Wir sind Kinder des Chaos, und Zerfall ist die Voraussetzung allen Wandels. Im Grunde gibt es nur die Auflösung und den unaufhaltsamen Sog des Chaos. Dahin ist jeder Zweck; was bleibt, ist nur die Richtung. Damit müssen wir uns abfinden, wenn wir leidenschaftslos immer tiefer ins Universum vorstoßen.
Aber diese völlig richtige Befreiung von süßlich-falschen Zielen, diese lobenswerte Seelenstärke bei der Entlarvung kosmischer Sentimentalität darf man nicht mit dem Aufgeben der eigenen, persönlichen Hoffnungen verwechseln. Hinter dem Schicksal des Kosmos steht letztlich wahrscheinlich tatsächlich kein Sinn, aber knüpft irgendjemand die Hoffnungen seines Lebens an das Schicksal des Kosmos? Natürlich nicht; das tut kein geistig gesunder Mensch. Unser Leben wird durch alle möglichen näher liegenden, gefühlvolleren, menschlichen Bestrebungen und Wahrnehmungen beherrscht. Der Naturwissenschaft vorzuwerfen, sie nehme dem Leben die Wärme, die es erst lebenswert macht, ist so grotesk falsch, meinem eigenen Empfinden und dem der meisten Naturwissenschaftler so diametral entgegengesetzt, dass mich fast schon die Verzweiflung packt, die man mir fälschlicherweise unterstellt. Mit diesem Buch möchte ich eine positivere Antwort geben und das Wunderbare in der Naturwissenschaft in den Mittelpunkt rücken, denn wenn ich daran denke, was die Kritiker und Nörgler verpassen, werde ich wirklich traurig. Solche Antworten waren eine Stärke des verstorbenen Carl Sagan, und er fehlt uns schon deswegen sehr. Das Gefühl des ehrfürchtigen Staunens, das uns die Naturwissenschaft vermitteln kann, gehört zu den erhabensten Erlebnissen, deren die menschliche Seele fähig ist. Es ist eine tiefe ästhetische Empfindung, gleichrangig mit dem Schönsten, das Dichtung und Musik uns geben können. Es gehört zu den Dingen, die das Leben lebenswert machen, und am meisten gilt das gerade dann, wenn es in uns die Überzeugung weckt, dass unsere Lebenszeit endlich ist.
Unweaving the Rainbow 1, der englische Titel des Buches, stammt von Keats, nach dessen Ansicht Newton die Poesie des Regenbogens zerstört hatte, weil er ihn in seine Spektralfarben zerlegte. Ein größerer Irrtum hätte Keats kaum unterlaufen können, und ich möchte alle, die zu ähnlichen Ansichten neigen, vom Gegenteil überzeugen. Naturwissenschaft ist eine Inspiration für große Dichtung oder sollte es zumindest sein, aber ich habe nicht die Begabung, selbst den Nachweis für diese Behauptung zu führen, und muss mich deshalb mit meiner Überzeugungsarbeit auf Prosa beschränken. Aber der aufmerksame Leser wird gewiss die eine oder andere Anspielung auf ihn (und andere) im Text wieder finden. Sie sollen ein Tribut an sein empfindsames Genie sein. Keats besaß eine liebenswürdigere Persönlichkeit als Newton, und sein Schatten sah mir beim Schreiben immer wieder kritisch über die Schulter.
Newtons Entwirrung des Regenbogens führte zur Spektroskopie, und die erwies sich als Schlüssel zu vielem, was wir heute über den Kosmos wissen. Und jedem Poeten, der die Bezeichnung «Romantiker» verdient, muss das Herz im Leibe hüpfen, wenn er das Universum eines Einstein, Hubble oder Hawking betrachtet. Über das Wesen des Universums erfahren wir etwas durch die Fraunhofer-Linien – den «Strichcode in den Sternen» – und ihre Verschiebung im Spektrum. Das Bild des Strichcodes führt uns weiter in die ganz andere, aber ebenso faszinierende Welt des Schalls («Strichcodes in der Luft») und dann zu den DNA-Fingerabdrücken («Strichcodes vor Gericht»), was mir die Gelegenheit verschafft, die Rolle der Naturwissenschaft in der Gesellschaft auch unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten.
Der nächste Teil des Buches handelt von Täuschungen. In den Kapiteln «Märchen, Geister, Sternendeuter» und «Berechnete Schauer» befasse ich mich mit jenen normalen Abergläubischen, die nicht als hehre Poeten den Regenbogen verteidigen, sondern sich im Rätselhaften aalen und sich verraten fühlen, wenn man ihnen eine Erklärung liefert. Solche Leute lesen gerne Gruselgeschichten und denken sofort an Poltergeister oder Wunder, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Sie lassen keine Gelegenheit aus, die berühmten Zeilen aus «Hamlet»
Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden,
Als eure Schulweisheit sich träumt
zu zitieren, und die Antwort des Naturwissenschaftlers («ja, aber wir arbeiten daran») lässt sie unbeirrt. Wer ein richtiges Geheimnis durch Erklären lüftet, ist in ihren Augen ebenso ein Spielverderber, wie Newton es mit seiner Erklärung des Regenbogens für manche Dichter der Romantik war.
Michael Sheermer, der Redakteur der Zeitschrift Skeptic, kann ein Lied davon singen. Er berichtet, wie er einmal einen berühmten Fernsehspiritisten öffentlich entlarvte. Der Mann zeigte ganz normale Zaubertricks und führte die Zuschauer dabei so an der Nase herum, dass sie glaubten, er trete mit Verstorbenen und Geistern in Kontakt. Aber anstatt sich gegen den entlarvten Scharlatan zu wenden, griff das Publikum den Aufklärer an und unterstützte eine Frau, die ihm «ungehöriges» Verhalten vorwarf, weil er den Leuten ihre Illusion genommen hatte. Eigentlich hätte sie ihm dankbar sein müssen, weil er ihr die Augen geöffnet hatte, aber die Dame zog es offensichtlich vor, sie fest geschlossen zu halten. Nach meiner Überzeugung ist ein geordnetes Universum, das unabhängig von den Vorlieben der Menschen existiert und in dem es für alles eine Erklärung gibt – auch wenn wir vielleicht noch lange brauchen, bis wir sie finden –, etwas viel Schöneres als ein Universum, das sich durch irgendwelchen Hokuspokus austricksen lässt.
In der Parapsychologie kann man einen Missbrauch des legitimen Gefühls des Staunens sehen, das eigentlich von echter Naturwissenschaft genährt werden sollte. Eine andere Gefahr lauert in dem, was man als «schlechte Poesie» bezeichnen könnte. Das Kapitel «Wolkige Symbole von höchster Romantik» warnt vor der Verführung durch schlechte Poesie in der Naturwissenschaft und irreführende Rhetorik. Anhand von Beispielen befasse ich mich schwerpunktmäßig mit den Beiträgen eines Autors aus meinem eigenen Fachgebiet, der mit seinen phantasievollen Schriften – vor allem, aber nicht nur in Amerika – einen unverhältnismäßig großen und, wie ich meine, unglückseligen Einfluss auf das Evolutionsverständnis vieler, nicht wissenschaftlich geschulter Leser gewonnen hat. Aber die wichtigste Stoßrichtung des Buches ist die Förderung guter naturwissenschaftlicher Poesie. Damit meine ich natürlich keine wissenschaftlichen Erkenntnisse in Versform, sondern eine Naturwissenschaft, die ihre Inspiration aus dem poetischen Gefühl des Staunens bezieht.
Die letzten vier Kapitel behandeln vier verschiedene, aber zusammenhängende Themen und geben einige Hinweise, was Naturwissenschaftler tun könnten, die poetisch begabter sind als ich. Gene, so egoistisch sie auch sein mögen, müssen auch «kooperativ» im Sinne von Adam Smith sein (deshalb beginnt das Kapitel «Der egoistische Kooperator» mit einem Zitat dieses Autors, das sich allerdings eigentlich nicht auf das hier behandelte Thema, sondern auf das Staunen als solches bezieht). In den Genen einer Spezies kann man eine Beschreibung früherer Welten sehen, ein «genetisches Totenbuch». Auf ganz ähnliche Weise fügt das Gehirn die Welt wieder zusammen: Es schafft im Kopf eine Art «virtuelle Realität», die ständig aktualisiert wird. In «Ein Ballon zum Denken» stelle ich Spekulationen über die Ursprünge der einzigartigen Eigenschaften unserer Spezies an, um dann schließlich zum poetischen Impuls als solchem und seiner mutmaßlichen Rolle in unserer Evolution zurückzukehren.
Die Computersoftware ist die Triebkraft einer neuen Renaissance, und einige ihrer kreativen Genies sind Wohltäter und gleichzeitig selbst Renaissancemenschen. Charles Simonyi von Microsoft stiftete der Universität Oxford 1995 einen Lehrstuhl für öffentliche Wissenschaft, und ich wurde zu seinem ersten Inhaber ernannt. Ich bin Dr. Simonyi sehr dankbar, zunächst einmal natürlich für seine weitsichtige Großzügigkeit gegenüber einer Universität, mit der er zuvor in keiner Verbindung gestanden hatte, aber auch für seine phantasievolle Vision von Naturwissenschaft und ihrer Vermittlung. Diese brachte er in seiner schriftlichen Erklärung an das Oxford der Zukunft wunderschön zum Ausdruck (seine Stiftung ist auf Dauer angelegt, aber wie es seine Art ist, vermeidet er die schmucklose und sich nach allen Seiten absichernde Ausdrucksweise der Juristen). Inzwischen sind wir Freunde geworden und diskutieren ab und zu über solche Themen. Das vorliegende Buch kann man als meinen Beitrag zu diesem Gedankenaustausch und meine Antrittsrede als Simonyi-Professor sehen. Und wenn «Antrittsrede» nach zwei Jahren auf diesem Posten unpassend erscheint, möchte ich mir die Freiheit nehmen und noch einmal Keats zitieren:
Hiermit, Freund Charles, ist dir wohl demonstriert
Warum ich keine Zeile an dich je adressiert:
Weil, was ich dachte, niemals frei und klar
Und für ein klassisch Ohr kaum wohlgefällig war.
Dennoch liegt es auch in der Natur der Sache, dass das Verfassen eines Buches länger dauert als das von Zeitungsartikeln oder Vorträgen. Bei der Entstehung dieses Buches sind einige Produkte beider Gattungen und auch Fernsehsendungen nebenher abgefallen. Diese muss ich benennen, falls ein Leser hier und da einen Absatz wieder erkennt. Den englischen Titel «Unweaving the Rainbow» und das Thema von Keats’ Respektlosigkeit gegenüber Newton verwendete ich zum ersten Mal öffentlich, als ich 1997 aufgefordert wurde, die C. P. Snow Lecture am Christ College in Cambridge zu halten, Snows alter Hochschule. Ich habe zwar nicht ausdrücklich sein Thema der «zwei Kulturen» aufgenommen, aber es ist natürlich von großer Bedeutung. Noch wichtiger war das Buch Die dritte Kultur von John Brockman, der mir auch in ganz anderer Funktion, nämlich als mein Literaturagent, große Dienste erwiesen hat. Der englische Untertitel «Science, Delusion and the Appetite for Wonder». (Wissenschaft, Täuschung und die Lust auf Wunder) war die Überschrift meiner Richard Dimbledey Lecture im Jahr 1996. In der BBC-Aufzeichnung dieses Vortrages kommen einige Absätze aus einem frühen Entwurf des Buches vor. Ebenfalls 1996 moderierte ich auf Channel Four eine einstündige Fernsehdokumentation mit dem Titel Breaking the Science Barrier. Ihr Thema war die Naturwissenschaft in der Kultur, und einige der Grundgedanken, die ich zusammen mit dem Produzenten John Gau und dem Regisseur Simon Raikes entwickelte, haben dieses Buch ebenfalls beeinflusst. Im Jahr 1998 nahm ich einige Passagen des Buches in meinen Vortrag in der Reihe Sounding the Century auf, den das Hörfunkprogramm BBC 3 aus der Londoner Elizabeth Hall übertrug. (Für den Titel des Vortrages, «Science and Sensibility», danke ich meiner Frau; was ich davon halten soll, dass er unter anderem bereits von einer Supermarktzeitschrift übernommen wurde, weiß ich allerdings nicht.) Außerdem habe ich Passagen des Buches in Artikeln verwendet, die ich im Auftrag der Zeitungen Independent, Sunday Times und Observer verfasste. Als man mich 1997 mit dem International Cosmos Prize ehrte, wählte ich den Titel «The Selfish Cooperator». (Der egoistische Kooperator) für meinen Preisvortrag, den ich sowohl in Tokio als auch in Osaka hielt. Teile des Vortrages finden sich in überarbeiteter und erweiterter Form im Kapitel 9, das den gleichen Titel trägt.
Von großem Nutzen für das Buch war die konstruktive Kritik, die Michael Rodgers, John Catalano und Lord Birkett an einem früheren Entwurf übten. Michael Birkett ist für mich der ideale interessierte Laie. Seine scharfsinnig-kritischen Kommentare zu lesen, stellt schon ein Vergnügen für sich dar. Michael Rodgers lektorierte meine ersten drei Bücher und spielte, auf meinen ausdrücklichen Wunsch und dank seiner Großzügigkeit, auch bei den drei letzten eine wichtige Rolle. Danken möchte ich außerdem John Catalano, nicht nur für seine nützlichen Anmerkungen zu dem Buch, sondern auch für die Website http://www.spacelab.net/~catalj/home.htm, deren hohe Qualität – mit der ich nicht das Geringste zu tun habe – jeder erkennen wird, der sie besucht. Stefan McGrath und John Radziewicz, die Lektoren bei den Verlagen Penguin und Houghton Mifflin, halfen mir mit geduldiger Ermutigung und literarischen Ratschlägen, die ich sehr zu schätzen wusste. Sally Holloway redigierte unermüdlich und fröhlich die endgültige Fassung des Manuskriptes. Dank gebührt außerdem Ingrid Thomas, Bridget Muskett, James Randi, Nicholas Davies, Daniel Dennett, Mark Ridley, Alan Grafen, Juliet Dawkins, Anthony Nuttall und John Batchelor.
Meine Frau Lalla Ward übte an den einzelnen Entwürfen jedes Kapitels ein Dutzend Mal Kritik, und bei jedem Lesen half mir ihr sensibles Schauspielergehör, auf die Sprache und ihren Klang zu achten. Wann immer mir Zweifel kamen, glaubte sie an das Buch. Ihre Vision hielt es zusammen, und ohne ihre Hilfe und Ermutigung hätte ich es nicht vollenden können. Ich widme es ihr.
Überhaupt zu leben, ist Wunder genug.
Mervyn Peake, The Glassblower (1950)
Wir alle müssen sterben, das heißt, wir haben Glück gehabt. Die meisten Menschen sterben nie, weil sie nie geboren werden. Die Männer und Frauen, die es rein theoretisch an meiner Statt geben könnte und die in Wirklichkeit nie das Licht der Welt erblicken werden, sind zahlreicher als die Sandkörner in der Sahara. Und unter diesen ungeborenen Geistwesen sind mit Sicherheit größere Dichter als Keats, größere Wissenschaftler als Newton. Das wissen wir, weil die Menge an Menschen, die aus unserer DNA entstehen könnten, bei weitem größer ist als die Menge der tatsächlichen Menschen. Und entgegen dieser gewaltigen Wahrscheinlichkeit gibt es gerade Sie und mich in all unserer Gewöhnlichkeit.
Moralphilosophen und Theologen messen dem Augenblick der Empfängnis großes Gewicht bei: Er ist in ihren Augen der Zeitpunkt, ab dem die Seele zu existieren beginnt. Und auch wer sich wie ich durch solches Gerede nicht rühren lässt, muss einen bestimmten Moment neun Monate vor der Geburt als das entscheidendste Ereignis seines persönlichen Schicksals betrachten. Es ist der Augenblick, in dem unser Bewusstsein plötzlich billionenmal genauer vorhersehbar wird als noch einen Sekundenbruchteil zuvor. Sicher, der embryonale Mensch, der nun existiert, hat noch viele Hürden zu überwinden. Die meisten Befruchtungsprodukte enden in einer frühen Fehlgeburt, bevor die Mutter überhaupt davon weiß, und wir alle haben Glück gehabt, dass es uns nicht so ergangen ist. Außerdem besteht die persönliche Identität nicht nur aus Genen – das erkennen wir an eineiigen Zwillingen (die sich nach dem Augenblick der Befruchtung trennen). Dennoch war der Moment, in dem eine bestimmte Samenzelle in eine bestimmte Eizelle eingedrungen ist, in unserem persönlichen Rückblick von Schwindel erregender Einzigartigkeit. Damals verschob sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu einem Menschen wurden, vom Astronomischen in den einstelligen Bereich.
Begonnen hat die Lotterie schon vor der Empfängnis. Unsere Eltern mussten sich kennen lernen, und ihre Empfängnis war ebenso unwahrscheinlich wie unsere eigene. Und so weiter rückwärts in die Vergangenheit über unsere vier Großeltern und acht Urgroßeltern bis in eine Zeit, an die wir nicht einmal denken mögen. Desmond Morris beginnt seine Autobiographie Mein Leben mit Tieren (1981) in seinem charakteristischen, fesselnden Tonfall so:
Mit Napoleon hat alles angefangen. Wenn er nicht gewesen wäre, säße ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, um dieses Buch zu schreiben … eine seiner Kanonenkugeln, abgefeuert im Spanischen Krieg von 1808 – 1814, hat meinem Ururgroßvater James Morris einen Arm weggerissen und dadurch der Geschichte meiner Familie eine ganz andere Richtung gegeben.
Dann berichtet Morris, wie der erzwungene Knick in der Berufslaufbahn seines Ahnen verschiedene Schneeballeffekte hatte, die schließlich in seinem eigenen Interesse für Naturgeschichte ihren Höhepunkt fanden. Aber eigentlich hätte Desmond nicht so vorsichtig sein müssen. An der Geschichte ist kein «wahrscheinlich». Natürlich verdankt er Napoleon schon sein Dasein als solches. Das Gleiche gilt für mich und jeden anderen. Napoleon brauchte James Morris nicht in den Arm zu schießen, um das Schicksal des kleinen Desmond – aber auch meines und Ihres – zu besiegeln. Nicht nur Napoleon, sondern auch der kleinste mittelalterliche Bauer brauchte nur zu niesen, um irgendetwas zu beeinflussen, das etwas anderes veränderte, das nach einer langen Kettenreaktion schließlich dazu führte, dass einer meiner potentiellen Vorfahren nicht mein Vorfahre, sondern der eines anderen Menschen wurde. Ich rede hier nicht von der «Chaostheorie» oder der ebenso modernen «Komplexitätstheorie», sondern nur von der schlichten Statistik der Kausalbeziehungen. Der Faden des historischen Geschehens, an dem unser Dasein hängt, ist erschreckend dünn.
Verglichen mit der Zeit, die wir nicht kennen, o König, ist unser Leben auf Erden wie der Flug eines Sperlings durch jenen Saal, wo Ihr im Winter mit Euren Heerführern und Dienstmannen sitzt. Der Sperling fliegt zur einen Tür herein und zur anderen hinaus, und solange er drinnen ist, ist er gefeit gegen die Winterstürme; doch diese kurze Ruhepause ist im Nu vorbei; er kehrt zurück in den Winter, aus dem er gekommen, und verschwindet aus Eurer Sicht. Mit dem menschlichen Leben ist es ebenso, und was danach sein wird oder davor war, entzieht sich unserer Kenntnis.
Beda Venerabilis,
A History of the English Church and People (731)
Auch in anderer Hinsicht haben wir Glück gehabt. Das Universum ist über 100 Millionen Jahrhunderte alt. Nach einem vergleichbar langen weiteren Zeitraum wird die Sonne zu einem roten Riesen angewachsen sein und die Erde verschlingen. Jedes dieser vielen hundert Millionen Jahrhunderte war zu seiner Zeit «das derzeitige Jahrhundert» oder wird es sein, wenn seine Zeit kommt. Interessanterweise können sich manche Physiker mit der Vorstellung von einer «wandernden Gegenwart» nicht anfreunden: Sie ist in ihren Augen ein subjektives Phänomen, für das sie in ihren Gleichungen keinen Platz finden. Aber ich argumentiere hier durchaus subjektiv. Für mich – und ich nehme an, auch für andere Menschen – fühlt es sich so an, als ob die Gegenwart aus der Vergangenheit in die Zukunft wandert, wie ein winziger Scheinwerferkegel, der an einem riesigen Zeitlineal entlangkriecht. Hinter dem Lichtkegel liegt alles im Dunkeln, in der Düsternis einer toten Vergangenheit. Und alles vor dem Lichtkegel liegt in der Dunkelheit der unbekannten Zukunft. Die Chance, dass unser Jahrhundert gerade dasjenige ist, auf dem der Scheinwerfer ruht, ist ebenso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig in die Luft geworfener Pfennig auf eine ganz bestimmte, auf der Straße von New York nach San Francisco krabbelnde Ameise trifft. Mit anderen Worten: Jeder von uns ist mit überwältigend großer Wahrscheinlichkeit tot.
Trotz dieser schlechten Chancen bemerken wir, dass wir in Wirklichkeit lebendig sind. Menschen, an denen der Scheinwerferkegel bereits vorübergegangen ist, und auch solche, die er noch nicht erreicht hat, können kein Buch lesen. Ebenso großes Glück habe ich, dass ich in der Lage bin, ein Buch zu schreiben – allerdings kann ich das vielleicht nicht mehr, wenn Sie diese Worte lesen. Eigentlich hoffe ich sogar, dass ich dann tot bin. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich liebe das Leben und wünsche mir, es möge noch lange dauern, aber jeder Autor möchte, dass seine Werke eine möglichst große Leserschaft erreichen. Und da die Gesamtbevölkerung der Zukunft wohl beträchtlich größer sein wird als die Zahl meiner Zeitgenossen, muss es einfach mein Bestreben sein, nicht mehr zu leben, wenn Sie diese Worte sehen. Nüchtern betrachtet, ist es schlicht die Hoffnung, dass mein Buch nicht so schnell aus dem Verlagsprogramm genommen wird. Aber beim Schreiben sehe ich nur eines: Ich habe Glück, dass ich am Leben bin, und das gilt auch für alle anderen.
Wir bewohnen einen Planeten, der für unsere Art von Leben fast ideal ist: nicht zu warm und nicht zu kalt, von freundlichem Sonnenlicht beschienen und sanft bewässert – ein gemächlich rotierendes, grün-goldenes Prachtstück von einem Planeten. Ja, und leider gibt es auch Wüsten und Slums, Hunger und quälendes Elend. Aber sehen wir uns einmal die Konkurrenz an. Im Vergleich zu den meisten Planeten ist unserer ein Paradies, und manche Teile der Erde sind paradiesisch, ganz gleich, welchen Maßstab man anlegt. Wie groß ist die Chance, dass ein zufällig ausgewählter Planet diese angenehmen Eigenschaften hat? Sie läge selbst bei noch so optimistischer Berechnung unter eins zu einer Million.
Stellen wir uns einmal ein Raumschiff mit schlafenden Entdeckern vor, tiefgefrorenen Siedlern in spe aus irgendeiner weit entfernten Welt. Vielleicht gehört das Schiff zu einer Verzweiflungsmission, mit der die Spezies gerettet werden soll, bevor ein unaufhaltsamer Komet auf ihrem Heimatplaneten einschlägt wie damals auf der Erde, als die Dinosaurier ausgelöscht wurden. Bevor sich die Raumfahrer in den Kälteschlaf versetzten, haben sie ganz nüchtern ausgerechnet, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr Schiff jemals durch Zufall auf einen lebensfreundlichen Planeten treffen wird. Wenn sich im besten Fall einer unter einer Million Planeten dafür eignet und wenn die Reise von einem Stern zum anderen mehrere Jahrhunderte dauert, ist es geradezu erschütternd unwahrscheinlich, dass das Raumschiff eine erträgliche oder gar sichere Zuflucht für seine schlafende Besatzung findet.
Aber malen wir uns nun einmal aus, der Steuerungscomputer des Schiffes hätte dieses unvorstellbare glückliche Händchen gehabt. Nach Jahrmillionen findet das Schiff einen Planeten, der Leben ermöglicht: mit gleichmäßiger Temperatur, ins warme Licht eines Gestirns getaucht, mit Sauerstoff und Wasser gesegnet. Die Passagiere, lauter Rip Van Winkles, stolpern schlaftrunken ans Licht. Nach einem Schlummer von einer Million Jahren finden sie einen neuen, fruchtbaren Globus, einen Planeten mit üppig-warmem Grün, mit glitzernden Bächen und Wasserfällen, voller Lebewesen, die pfeilschnell durch die fremde Pflanzenpracht schießen. Unsere Reisenden wandeln wie im Traum, überwältigt, unfähig, ihren aus der Übung geratenen Sinnen oder ihrem Glück zu glauben.
Wie gesagt: Diese Geschichte erfordert zu viel Glück; sie würde sich nie ereignen. Und ist nicht doch genau das jedem von uns widerfahren? Nachdem wir Hunderte von Millionen Jahren geschlafen hatten, sind wir aufgewacht und haben damit eine astronomische Wahrscheinlichkeit Lügen gestraft. Zugegeben: Wir sind nicht mit einem Raumschiff angekommen, sondern geboren worden, und wir sind nicht mit vollem Bewusstsein in diese Welt hineingeplatzt, sondern haben es während unserer frühen Kindheit nach und nach erworben. Aber die Tatsache, dass wir unsere Welt allmählich begreifen und nicht plötzlich entdecken, sollte unser Staunen nicht verringern.
Natürlich betreibe ich hier Taschenspielerei mit dem Begriff des Glückes, und ich zäume das Pferd von hinten auf. Dass sich unsere Art von Leben auf einem Planeten befindet, auf dem Temperatur, Regenmenge und alles andere genau stimmen, ist kein Zufall. Würde sich der Planet für eine andere Art von Leben eignen, hätte sich dort ebendiese andere Art von Leben entwickelt. Aber als Einzelne hatten wir dennoch gewaltiges Glück. Wir genießen ein Vorrecht, und dieses Vorrecht besteht nicht nur darin, die Erde zu genießen. Wir haben auch die Möglichkeit, zu verstehen, warum unsere Augen offen sind, warum sie in der kurzen Zeit, bevor sie sich für immer schließen, etwas sehen.
Hier liegt nach meiner Überzeugung die beste Antwort für die Kleingeister, die ständig nach dem Nutzen der Wissenschaft fragen. In einem jener berühmten Bonmots, deren Urheberschaft nicht gesichert ist, soll Michael Faraday auf eine solche Frage erwidert haben: «Guter Mann, welchen Nutzen hat ein neugeborenes Kind?» Damit spielte Faraday (oder Benjamin Franklin, oder wer es sonst war) auf etwas Offensichtliches an: Ein Baby ist vielleicht im Augenblick zu gar nichts nütze, aber es birgt ein großes Potential für die Zukunft. Ich stelle mir mittlerweile gerne vor, dass er auch noch etwas anderes meinte: Welchen Nutzen hat es, ein Kind in die Welt zu setzen, wenn es in seinem Leben nichts anderes tut, als sich um sein Weiterleben zu bemühen? Wenn man alles danach beurteilt, wie «nützlich» es ist – das heißt, nützlich für die Erhaltung unseres Lebens –, bleibt uns nur noch ein inhaltsleerer Zirkelschluss. Es muss noch einen zusätzlichen Wert geben. Zumindest ein Teil unseres Lebens muss dazu dienen, dieses Leben auch zu führen und nicht nur sein Ende zu verhindern. Damit begründen wir zu Recht, warum wir Steuergelder für Kunst ausgeben. Es ist eine der besten Rechtfertigungen für die Erhaltung seltener Tier- und Pflanzenarten und schöner Bauwerke. Es ist unsere Antwort für jene Barbaren, nach deren Ansicht man wilde Elefanten und historische Gebäude nur dann schützen sollte, wenn es «sich rechnet». Mit der Wissenschaft ist es genauso. Natürlich rechnet sich Wissenschaft. Natürlich ist sie nützlich. Aber sie ist mehr als das.
Nach einem Schlaf von vielen hundert Millionen Jahrhunderten schlagen wir endlich auf einem Planeten des Überflusses die Augen auf, auf einem Planeten voller leuchtender Farben und überschäumenden Lebens. Und in wenigen Jahrzehnten müssen wir sie wieder schließen. Ist es nicht eine edle, erleuchtete Art, unsere kurze Zeit unter der Sonne zu verbringen, wenn wir zu verstehen streben, was das Universum ist und wie es kommt, dass wir darin erwacht sind? Das ist meine Antwort, wenn ich – erstaunlich oft – gefragt werde, warum ich mir die Mühe mache, morgens aufzustehen. Oder anders herum ausgedrückt: Ist es nicht traurig, wenn man ins Grab sinkt, ohne sich jemals gefragt zu haben, warum man geboren wurde? Wer würde bei einem solchen Gedanken nicht aus dem Bett aufspringen, voller Eifer, mit der Erkundung der Welt fortzufahren und sich zu freuen, dass man dazugehört?
Ähnlichen Trost fand die Dichterin Kathleen Raine, die an der Universität Cambridge Naturwissenschaften lehrte und sich auf Biologie spezialisiert hatte, als sie in jungen Jahren Liebeskummer hatte und verzweifelt nach einer Linderung für ihren Herzschmerz suchte:
Da sprach der Himmel, sprach zu mir so klar
so herzvertraut, so innig-nah
zu meiner Seele: ‹Was du wünschst, ist da.›
‹Sieh, du bist eins mit aller Kreatur,
mit Wolken, Winden, dem Getier in Wald und Flur
mit Sternen, Meeren teilst du die Natur.›
‹Wirf ab von deinem Herzen Angst und Pein,
halt Grabesruh oder saug’ Leben ein,
die Welt hast mit der Blume und dem Tiger du gemein.›
«Passion». (1943)
Es gibt eine Betäubungswirkung des Vertrauten, einen Beruhigungseffekt des Normalen, das die Sinne einschläfert und das Wunder des Daseins verschleiert. Für uns, die wir nicht die Gabe der Dichtkunst besitzen, lohnt sich zumindest der Versuch, diese Betäubung von Zeit zu Zeit abzuschütteln. Wie wirkt man am besten der nachlässigen Gewöhnung entgegen, die sich einschleicht, während wir allmählich das Kleinkindalter verlassen? Wir können nicht buchstäblich zu einem anderen Planeten fliegen. Aber das Gefühl, wir seien gerade in einer neuen Welt ins Leben gestolpert, können wir noch einmal einfangen, wenn wir unsere eigene Welt auf ungewohnte Weise betrachten. Man ist versucht, ein einfaches Beispiel wie den Schmetterling oder die Rose zu bemühen, aber begeben wir uns doch gleich ans fremdartige Ende des Spektrums. Ich weiß noch, wie ich vor Jahren einmal den Vortrag eines Biologen hörte, der sich mit den Tintenfischen und ihren Verwandten, den Kraken, beschäftigte. Zu Beginn erklärte er, warum diese Tiere ihn so fesselten. «Wissen Sie», sagte er, «das sind die Marsbewohner.» Haben Sie schon einmal zugesehen, wie ein Tintenfisch die Farbe wechselt?
Fernsehbilder werden manchmal auf riesigen Wänden aus Leuchtdioden oder LEDs (LED = light emitting diode) wiedergegeben. Ein solches LED-Display ist kein Bildschirm, auf dem ein Elektronenstrahl Zeile für Zeile über einen Leuchtschirm läuft, sondern eine großflächige Anordnung aus winzigen glimmenden Lichtern, die sich einzeln steuern lassen. Jede Leuchtdiode wird gezielt heller oder dunkler eingestellt, sodass es aus größerer Entfernung aussieht, als bestünde die Fläche aus bewegten Bildern. Wie ein solches LED-Display verhält sich auch die Haut des Tintenfisches. Statt der Lichter enthält sie viele tausend winzige, mit Tinte gefüllte Hohlräume, und jeder davon kann von seinen eigenen kleinen Muskeln zusammengepresst werden. Da jeder Muskel mit einer Steuerungsleitung verbunden ist, kann das Nervensystem des Tintenfisches die Form und damit die Färbung der Tintenbeutel kontrollieren.
Würde man die Nerven, die zu diesen «Tintenpixeln» führen, über Drähte anzapfen und mit einem Computer stimulieren, könnte man theoretisch auf der Haut des Tieres Charlie-Chaplin-Filme ablaufen lassen. Das tut der Tintenfisch zwar nicht, aber sein Gehirn steuert die Leitungen ebenfalls sehr schnell und präzise, sodass die Haut ein Aufsehen erregendes Farbenspiel zeigt. Farbwellen jagen über die Oberfläche wie Wolken in Zeitrafferaufnahme; auf dem lebenden Bildschirm wechseln sich Streifen und Wirbel ab. Seine wechselnden Gefühle lässt das Tier im Schnelldurchlauf erkennen: In einer Sekunde ist es dunkelbraun, in der nächsten erbleicht es zu geisterhaftem Weiß, und ständig verändert es seine verschlungenen Flecken- oder Streifenmuster. Was den Farbwechsel angeht, ist das Chamäleon im Vergleich zum Tintenfisch ein Waisenknabe.
Zu denen, die sich heute heftig darüber Gedanken machen, was Denken eigentlich ist, gehört der amerikanische Neurobiologe William Calvin. Wie schon andere vor ihm legt er besonderen Wert auf die Vorstellung, dass Gedanken nicht an bestimmten Orten im Gehirn angesiedelt sind, sondern wechselnde Aktivitätsmuster auf seiner Oberfläche darstellen, wobei einzelne Einheiten benachbarte Einheiten «anwerben» und zu Populationen vereinen, die zu einem Gedanken werden und in Darwinscher Manier mit konkurrierenden Populationen, die andere Gedanken repräsentieren, in Wettbewerb treten. Diese Aktivitätsmuster sehen wir nicht, aber vermutlich wäre das der Fall, wenn aktive Nervenzellen aufleuchten würden. Dann sähe die Hirnrinde möglicherweise aus wie die Körperoberfläche eines Tintenfisches. Denkt ein Tintenfisch mit der Haut? Wenn sich sein Farbmuster plötzlich verändert, halten wir das für den Ausdruck eines Stimmungswandels, für ein Signal an andere Tintenfische. Der Farbwechsel zeigt an, dass das Tier beispielsweise nicht mehr in aggressiver, sondern in ängstlicher Stimmung ist. Natürlich nehmen wir an, dass sich der Stimmungswandel im Gehirn abspielt und den Farbwechsel hervorruft – als äußeren Ausdruck innerer Gedanken, als Mittel der Kommunikation. Ich füge dem die Phantasievorstellung hinzu, dass die Gedanken des Tintenfisches vielleicht nirgendwo anders angesiedelt sind als in der Haut. Wenn Tintenfische mit der Haut denken, sind sie noch viel mehr «Marsbewohner», als mein Kollege glaubte. Selbst wenn meine Spekulation zu weit hergeholt ist (und das ist sie sicher), ist das Schauspiel der wellenförmigen Farbveränderung so fremdartig, dass es uns aus unserer Betäubung des Vertrauten herausreißt.
Tintenfische sind nicht die einzigen «Marsbewohner» vor unserer Haustür. Man denke nur an die bizarren Gesichter der Tiefseefische; oder an die Staubmilben, die noch Furcht erregender aussähen, wenn sie nicht so winzig wären; oder an die mindestens ebenso schrecklichen Riesenhaie; oder an die Chamäleons mit ihrer katapultartig herausschießenden Zunge, ihren wie Geschütztürme drehbaren Augen und dem automatenhaft langsamen Gang. Eine ebenso «seltsam fremde Welt» tut sich auf, wenn wir in unser eigenes Inneres blicken und die Zellen betrachten, die unseren Körper ausmachen. Eine Zelle ist nicht nur ein Beutel voller Flüssigkeit. Sie ist voll gepackt mit festen Strukturen und enthält ein Labyrinth aus vielfach gefalteten Membranen. Der menschliche Organismus besteht aus etwa 100 Millionen Millionen von ihnen, und die Gesamtfläche der Membranstrukturen in einem einzigen Menschen liegt bei fast einem Quadratkilometer. Das ist die Größe eines ansehnlichen Landwirtschaftsbetriebes.
Was tun alle diese Membranen? Sie wirken wie Füllmaterial der Zelle, aber das ist nicht ihre einzige Aufgabe. Ein großer Teil der hektargroßen Flächen beherbergt chemische Fertigungsstraßen: Hier bewegen sich Förderbänder, und Hunderte von Arbeitsschritten sind kaskadenförmig angeordnet, sodass jeder davon in einer genau vorgegebenen Weise zum nächsten führt; angetrieben wird das Ganze von schnell rotierenden chemischen Zahnrädern. Der Citratzyklus, jenes Zahnrad mit neun Zähnen, das im Wesentlichen für die Energieproduktion verantwortlich ist, läuft mit über 100 Umdrehungen in der Sekunde, und es kommt in jeder Zelle mehrere tausendmal vor. Historisch besonders bedeutsame chemische Zahnräder liegen in den Mitochondrien, winzigen Körperchen, die sich in unseren Zellen nach Art der Bakterien vermehren. Wie wir noch sehen werden, sind die Mitochondrien und andere lebensnotwendige Strukturen in den Zellen – nach einer mittlerweile allgemein anerkannten Theorie – den Bakterien nicht nur ähnlich, sondern sie stammen sogar unmittelbar von Bakterien ab, die vor einer Milliarde Jahren ihre Freiheit aufgegeben haben. Jeder von uns ist eine Großstadt aus Zellen, jede Zelle eine Kleinstadt aus Bakterien, jeder Mensch eine gewaltige Bakterienmetropole. Schwindet da nicht das dumpfe Gefühl der Betäubung?
Das Mikroskop hilft uns, im Geist an Zellmembranen entlangzugleiten, und das Teleskop entführt uns in ferne Galaxien; ein dritter Weg, die Betäubung abzuschütteln, besteht darin, dass wir in unserer Phantasie durch die Erdzeitalter rückwärts reisen. Dabei macht uns das unvorstellbare Alter der Fossilien schwer zu schaffen. Wir heben einen Trilobiten auf, und das Lexikon sagt uns, er sei 500 Millionen Jahre alt. Aber leider können wir einen solchen Zeitraum absolut nicht begreifen, und jeder Versuch ist vergebliche Liebesmüh’. Unser Gehirn hat sich in der Evolution so entwickelt, dass es die zeitlichen Maßstäbe unserer eigenen Lebensdauer verstehen kann. Sekunden, Minuten, Stunden, Tage und Jahre – das fällt uns leicht. Auch mit Jahrhunderten kommen wir noch zurecht. Aber schon wenn es um Jahrtausende geht, läuft es uns kalt über den Rücken. Die Epen Homers, die Taten der griechischen Götter Zeus, Apollo und Artemis, die jüdischen Helden Abraham, Mose und David mit ihrem Furcht einflößenden Gott Jahwe, die Geschichte der alten Ägypter und des Sonnengottes Ra: Das alles inspiriert die Dichter und vermittelt uns den Schauer gewaltiger Zeiträume. Es scheint, als blickten wir durch einen unheimlichen Nebel auf die seltsamen Schatten der Antike. Aber nach dem zeitlichen Maßstab unseres Trilobiten hat sich diese viel gepriesene alte Zeit erst gestern ereignet.
Es gab schon viele Versuche, das Unfassbare anschaulich zu machen, und ich möchte es ein weiteres Mal probieren. Schreiben wir die Geschichte eines Jahres auf ein einziges Blatt Papier. Für Einzelheiten bleibt dabei nicht viel Platz. Es entspricht ungefähr der aufschlussreichen Seite «Das war …», mit der die Zeitungen am 31. Dezember aufwarten. Jeder Monat erhält ein paar Sätze. Auf ein weiteres Blatt schreiben wir die Geschichte des vergangenen Jahres. So arbeiten wir uns durch die Jahre rückwärts und skizzieren jeweils auf einer Seite, was in jedem Jahr geschehen ist. Die Blätter binden wir zu Büchern, die wir nummerieren. Das 1776 bis 1788 in englischer Sprache erschienene Werk Geschichte des Verfalls und Untergangs des Römischen Reiches von Gibbon erfasst in sechs Bänden von jeweils etwa 500 Seiten insgesamt 13 Jahrhunderte, das heißt, es arbeitet sich ungefähr mit der Geschwindigkeit, von der wir hier reden, durch die Vergangenheit.
Schon wieder so ein verdammtes, dickes, viereckiges Buch. Immer nur Gekritzel, Gekritzel, Gekritzel! He! Mr. Gibbon?
William Henry, Erster Duke von Gloucester (1829)
Das wunderbare Oxford Dictionary of Quotations (1992), aus dem ich diese Bemerkung gerade abgeschrieben habe, ist selbst ein verdammt dicker, viereckiger Klotz von einem Buch, und es hat ungefähr die richtige Größe, um uns bis in die Zeit der Königin Elisabeth I. zu führen. Damit haben wir einen ungefähren Maßstab für die Zeit: In zehn Zentimetern Buchdicke ist die Geschichte eines Jahrtausends aufgezeichnet. Mit diesem Maßstab können wir uns in die fremdartige Welt der Erdgeschichte vorarbeiten. Wir legen das Buch über die jüngste Vergangenheit flach auf den Boden und schichten dann die Bände über frühere Jahrhunderte darauf. Wir selbst stellen uns als lebender Maßstab neben den Bücherstapel. Wenn wir beispielsweise etwas über Jesus lesen wollen, müssen wir einen Band auswählen, der 20 Zentimeter über dem Boden liegt – etwas oberhalb unserer Fußknöchel.
Ein berühmter Archäologe grub einmal einen Krieger aus der Bronzezeit mit wunderschön erhaltener Gesichtsmaske aus und jubelte: «Ich habe Agamemnon ins Gesicht gesehen.» Dass er in die sagenumwobene Antike vorgedrungen war, erfüllte ihn mit poetischer Ehrfurcht. Um Agamemnon in unserem Bücherstapel zu finden, müssen wir uns ungefähr bis zur halben Höhe des Schienbeins bücken. Irgendwo nicht weit davon finden wir Petra («Eine rosenrote Stadt, halb so alt wie die Zeit»), Ozymandias, den Herrn der Herren («Schaut, was ich schuf, ihr Mächtigen, und verzagt»), und eines der sieben Weltwunder der Antike, die Hängenden Gärten von Babylon. Davor lagen das Ur der Chaldäer und Uruk, die Stadt des Sagenhelden Gilgamesch; auf die Geschichte ihrer Gründung stoßen wir ein wenig höher an unserem Bein. Glaubt man dem Erzbischof James Usher, beginnt dort die Zeitrechnung – er ermittelte im 17. Jahrhundert das Jahr 4004 vor Christus als Zeitpunkt der Schöpfung von Adam und Eva.
Ein Einschnitt in der Menschheitsgeschichte war die Zähmung des Feuers, denn ohne Feuer ist die Entwicklung von Technik kaum möglich. In welcher Höhe unseres Bücherstapels befindet sich die Seite, auf der diese bahnbrechende Erfindung aufgezeichnet ist? Die Antwort ist ziemlich überraschend angesichts der Tatsache, dass man auf dem Stapel, der die gesamte niedergeschriebene Geschichte enthält, bequem sitzen kann. Den archäologischen Spuren zufolge war Homo erectus der erste, der das Feuer beherrschte, aber ob diese Frühmenschen schon Feuer machen konnten oder es nur unterhielten und nutzten, wissen wir nicht. Jedenfalls besaßen sie das Feuer schon vor etwa einer halben Million Jahren, und um in unserem Vergleich den Band mit der zugehörigen Aufzeichnung zu finden, müssten wir ein wenig höher klettern als auf die Freiheitsstatue. Eine wahrlich Schwindel erregende Höhe, insbesondere wenn man bedenkt, dass Prometheus, der sagenhafte Überbringer des Feuers, in dem Bücherstapel knapp unterhalb des Knies zum ersten Mal erwähnt wird. Um etwas über Lucy und unsere afrikanischen Vorfahren, die Australopithecinen, zu lesen, müssten wir über das höchste Gebäude von Chicago hinaussteigen. Und die Biographie unseres letzten gemeinsamen Vorfahren mit den Schimpansen stünde in einem Buch, das noch einmal doppelt so hoch liegt.
Aber damit stehen wir auf unserer Reise zu den Trilobiten noch ganz am Anfang. Wie hoch müsste der Bücherstapel sein, damit er auch die Seite enthält, auf der Leben und Tod dieses Trilobiten in seinem seichten, kambrischen Meer gebührend gefeiert werden? Die Antwort: ungefähr 56 Kilometer. Uns solche Höhen vorzustellen, sind wir nicht gewohnt. Der Gipfel des Mount Everest liegt noch nicht einmal neun Kilometer über dem Meeresspiegel. Eine gewisse Vorstellung vom Alter des Trilobiten können wir uns machen, wenn wir den Stapel um 90 Grad kippen. Man stelle sich ein Bücherregal vor, dreimal so lang wie die Insel Manhattan, dicht gefüllt mit Bänden von der Größe des Untergangs des Römischen Reiches von Gibbon. Bis zur Zeit des Trilobiten alles zu lesen, wobei jedem Jahr nur eine Seite zugestanden wird, wäre mühsamer als das Durchackern aller 14 Millionen Bände der Library of Congress. Aber selbst der Trilobit ist noch jung im Vergleich zum Alter des Lebens selbst. Das Leben der ersten Organismen, der gemeinsamen Vorfahren von Trilobiten, Bakterien und Menschen, ist im Band 1 unseres Geschichtswerkes verzeichnet, und der Band 1 steht ganz am Ende des Mammut-Bücherregals. Insgesamt würde sich das Regal von London bis an die schottische Grenze erstrecken. Oder quer durch Griechenland von der Adria bis zur Ägäis.
Vielleicht sind auch solche Entfernungsangaben noch unwirklich. Wenn man sich Analogien für große Zahlen ausdenkt, besteht die Kunst darin, den für Menschen begreiflichen Maßstab nicht zu verlassen. Geschieht das, hilft uns die Analogie nicht weiter als die eigentliche Zahl. Ein Geschichtswerk durchzulesen, dessen Bände ein Regal von Rom nach Venedig füllen, ist eine unvorstellbare Aufgabe, fast ebenso unbegreiflich wie die nüchterne Zahl von vier Milliarden Jahren.
Hier noch ein Vergleich, diesmal einer, der schon früher benutzt wurde. Man breitet die Arme so weit wie möglich aus, sodass sie die Evolution von ihren Anfängen an der linken Fingerspitze bis zur Gegenwart an der rechten Fingerspitze umfassen. Die ganze Strecke über die Körpermitte hinweg bis weit über die rechte Schulter hinaus besteht das Leben ausschließlich aus Bakterien. Das vielzellige, wirbellose Leben blüht irgendwo in der Gegend des rechten Ellenbogens auf. Die Dinosaurier entstehen in der Mitte der rechten Handfläche und sterben ungefähr am letzten Fingergelenk wieder aus. Aber die gesamte Geschichte des Homo sapiens und seines Vorfahren, des Homo erectus, ist in der schmalen Hornsichel enthalten, die man vom Fingernagel abschneidet. Und was die aufgezeichnete Geschichte angeht – die Sumerer und Babylonier, die jüdischen Stammväter, die Dynastien der Pharaonen, die Legionen Roms, die christlichen Kirchenväter, die unabänderlichen Gesetze der Meder und Perser, Troja und die Griechen, Helena und Achilles und den toten Agamemnon, Napoleon und Hitler, die Beatles und Bill Clinton –, sie und alle, die sie gekannt haben, werden von einem einzigen leichten Strich mit der Nagelfeile als Staub hinweggetragen.
Die Armen sind rasch vergessen,
Ihre Zahl übersteigt die der Lebenden, doch wo sind ihre ganzen Gebeine?
Auf jeden Lebenden kommen eine Million Tote,
Ist ihr Staub im Erdboden verschwunden, daß man ihn gar nicht sieht?
Es dürfte keine Luft mehr zum Atmen da sein, bei so viel Staub,
Kein Raum für den Wind, für den Regen;
Die Erde müßte eine Wolke von Staub sein, ein Grund aus Knochen,
Kein Raum auch nur für unsere Skelette.
Sacheverell Sitwell, «Agamemnon’s Tomb». (1933)
Es spielt zwar eigentlich keine Rolle, aber Sitwells dritte Zeile ist ungenau. Schätzungen zufolge macht die heutige Weltbevölkerung einen beträchtlichen Anteil aller Menschen aus, die jemals gelebt haben. Aber darin spiegeln sich nur die Auswirkungen des exponentiellen Wachstums wider. Wenn wir nicht Körper, sondern Generationen zählen, und insbesondere wenn wir über die Geschichte der Menschheit hinaus bis zu den Anfängen des Lebens zurückgehen, bekommen Sacheverell Sitwells Überlegungen eine neue Bedeutung. Nehmen wir einmal an, in unserer unmittelbaren weiblichen Ahnenreihe seit dem ersten Aufblühen des vielzelligen Lebens vor wenig mehr als einer halben Milliarde Jahren habe sich jedes einzelne Wesen auf dem Grab seiner Mutter niedergelegt und wäre dort gestorben, um dann schließlich zu versteinern. Wie bei den aufeinander folgenden Schichten der untergegangenen Stadt Troja würde vieles zusammengedrückt und durcheinander gewürfelt, also nehmen wir außerdem an, dass jedes Fossil der Reihe nach wie ein Pfannkuchen auf eine Dicke von einem Zentimeter plattgedrückt würde. Welche Gesteinstiefe würden wir brauchen, um unsere ununterbrochen aufeinander folgenden Fossilien unterzubringen? Die Antwort: Der Felsen müsste etwa 1000 Kilometer dick sein, zehnmal so dick wie die Erdkruste.
Der Grand Canyon, dessen Gestein von den tiefsten bis zu den obersten Schichten einen großen Teil des fraglichen Zeitraums widerspiegelt, ist nur ungefähr eineinhalb Kilometer tief. Wären seine Schichten mit Fossilien voll gestopft, ohne dass anderes Gestein dazwischenliegt, wäre in seiner Tiefe nur Platz für etwa jede 600. der Generationen, die nacheinander gestorben sind. Diese Berechnung hilft uns, die Forderung der Fundamentalisten richtig einzuschätzen, die eine «ununterbrochene», sich allmählich wandelnde Fossilienreihe verlangen, bevor sie die Evolution als Tatsache anerkennen wollen. Im Gestein der Erde ist für solchen Luxus schlicht und einfach kein Platz – es ist um viele Zehnerpotenzen zu klein. Wie man es auch betrachtet: Nur ein äußerst kleiner Teil aller Lebewesen hat das Glück, zu Fossilien zu werden. Und wie ich schon sagte, sollte man das als Ehre betrachten.
Die Zahl der Toten übersteigt um ein Beträchtliches die Zahl all derer, die da leben werden. Die Nacht der Zeit ist weit länger als der Tag, und wer weiß, wann das Äquinoktium war? Jede Stunde mehrt dieses Rechenergebnis, das kaum einen Augenblick lang stille steht … Wer weiß, ob die Besten im Gedächtnis bleiben werden, oder ob nicht Bessere der Vergessenheit anheimfallen, als die bekannte Überlieferung bewahrt?
Sir Thomas Browne, Urne Buriall (1658)