

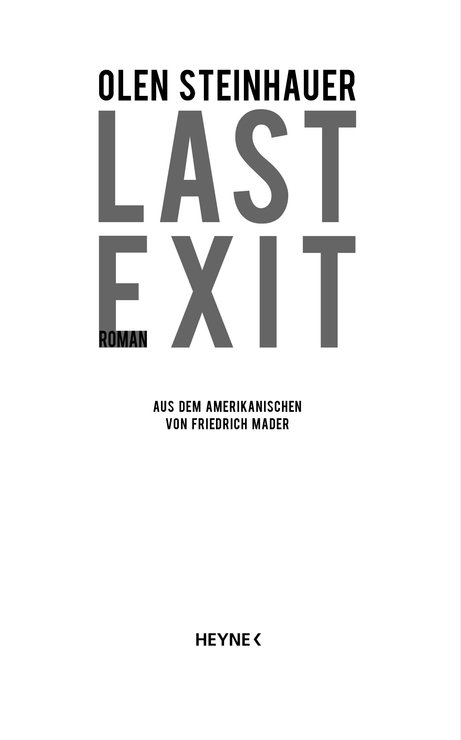
Er hatte das Gefühl, er müsste es nur benennen können, um es zu beherrschen. Transgressive Assoziation? Das klang einigermaßen richtig, war aber zu klinisch, um die Sache zu fassen zu kriegen. Vielleicht spielte das medizinische Etikett sowieso keine Rolle. Das Einzige, was zählte, war die Wirkung auf ihn und seine Arbeit.
Die schlichtesten Dinge konnten es auslösen – ein Takt Musik, ein Gesicht, ein Schweizer Hündchen, das auf die Straße kackte, oder der Geruch von Auspuffgasen. Nur Kinder nie, was sogar ihm seltsam vorkam. Bloß die indirekten Bruchstücke seines früheren Lebens versetzten ihm diesen Schlag in die Magengrube, und als er in einer eiskalten Züricher Telefonzelle stand und in Brooklyn anrief, hätte er nicht einmal sagen können, was diesmal der Auslöser war. Er wusste nur, dass er Glück hatte: Niemand meldete sich. Vielleicht waren sie in irgendeinem Café beim Frühstück. Dann schaltete sich die Maschine ein: ihre beiden Stimmen, ein Durcheinander weiblicher Töne, die ihn lachend aufforderten, bitte eine Nachricht zu hinterlassen.
Er hängte auf.
Wie er es auch nannte, es war ein riskanter Impuls. Für sich genommen eigentlich harmlos. Was konnte ein spontaner – vielleicht zwanghafter – Anruf in einem Zuhause, das keines mehr war, an einem grauen Sonntagnachmittag schon ausmachen? Doch als er durch die zerkratzte Scheibe auf den weißen Lieferwagen in der Bellerivestraße spähte, wurde er sich der Gefahr bewusst. In diesem Lieferwagen saßen drei Männer und wunderten sich, dass er hier hatte anhalten wollen, wo sie doch gerade auf dem Weg waren, ein Kunstmuseum auszurauben.
Manch einer hätte wohl nicht einmal daran gedacht, sich so eine Frage zu stellen, denn wenn sich das Leben so schnell verändert, wird die Rückschau zu einer verblüffenden Abfolge moralischer Entscheidungen. Und wären diese anders ausgefallen, säße man jetzt eventuell gar nicht hier. Sondern in Brooklyn vielleicht, mit der Sonntagszeitung und den Werbebeilagen, zerstreut zuhörend, wie die eigene Frau das Feuilleton zusammenfasste und die Tochter das Vormittagsprogramm des Fernsehens kritisierte. Doch die Frage kam wieder, wie so oft in den letzten drei Monaten: Wie bin ich hier gelandet?
Die erste Regel im Tourismus lautet, dass man sich nicht von ihm zerstören lassen darf – denn genau das kann passieren. Ohne weiteres. Die rastlose Existenz, die Notwendigkeit, den Überblick über mehrere Aufträge gleichzeitig zu behalten, das Unterdrücken von Empathie, wenn es der Job erfordert, und vor allem die unaufhaltsame Vorwärtsbewegung.
Doch diese tückische Eigenschaft des Tourismus, die Bewegung, ist auch ein Segen. Sie lässt keine Zeit für Fragen, die sich nicht unmittelbar um das eigene Überleben drehen. Auch der Augenblick jetzt war keine Ausnahme. Und so schob er sich aus der Telefonzelle, trabte durch die beißende Kälte und kletterte auf den Beifahrersitz. Giuseppe, der picklige, magere Italiener am Steuer, erfrischte mit seinem Orbit-Kaugummi die Luft im Wagen, während Radovan und Stefan, beides kräftige Kerle, hinten im Laderaum auf einer behelfsmäßigen Holzbank hockten und ihn anstarrten.
Die Lingua franca in diesem Kreis war Deutsch, daher sagte er: »Los.«
Giuseppe fuhr weiter.
Jeder Tourist entwickelt seine eigenen Methoden, um nicht unterzugehen: Rezitieren von Gedichten, Atemübungen, Selbstverletzung, mathematische Rätsel, Musik. Dieser Tourist hatte früher immer einen iPod bei sich gehabt, doch er hatte ihn seiner Frau als Versöhnungsgeschenk gegeben, und jetzt waren ihm nur seine musikalischen Erinnerungen geblieben. Als sie an den kahlen, knorrigen Winterbäumen und den Häusern von Seefeld vorbeirollten, dem südlichen Stadtteil am Zürichsee, summte er eine halb vergessene Melodie aus seiner Jugend in den Achtzigern und fragte sich, wie andere Touristen mit der quälenden Trennung von ihrer Familie fertig wurden. Ein blöder Gedanke: Er war der einzige Tourist mit Familie. Sie bogen um eine Ecke, und Radovan platzte mit einer knappen Aussage heraus: »Meine Mutter hat Krebs.«
Giuseppe lenkte den Wagen weiter in seiner sicheren Art, und Stefan wischte mit einem Lumpen Öl von der Beretta, die er letzte Woche in Hamburg gekauft hatte. Vom Beifahrersitz aus schielte der Mann, den sie als Mr. Winter kannten – er tourte unter dem Namen Sebastian Hall, war seiner Familie aber als Milo Weaver geläufig –, nach hinten zu dem breitschultrigen Serben, der die muskulösen, bleichen Arme über dem Bauch verschränkt hatte und die behandschuhten Fäuste gegen die Rippen drückte. »Das tut mir leid. Den anderen bestimmt auch.«
»Ich will kein Mitleid.« Radovan sprach mit starkem Belgrader Akzent. »Ich wollte es nur erwähnen, bevor wir das machen. Ihr wisst schon, falls ich hinterher keine Gelegenheit mehr dazu habe.«
»Klar, verstanden.«
Giuseppe und Stefan murmelten beifällig.
»Ist die Krankheit behandelbar?«, fragte Milo Weaver.
Radovan, der eingeklemmt zwischen Stefan und einem Haufen leerer Leinensäcke saß, wirkte betroffen. »Es ist im Magen. Schon zu weit fortgeschritten. Ich lasse sie in Wien untersuchen, aber der Arzt kennt sich anscheinend aus.«
»Das weiß man nie.« Giuseppe bog auf eine andere baumgesäumte Straße.
»Klar«, stimmte Stefan zu und wandte sich gleich wieder seiner Waffe zu, um nichts Falsches zu sagen.
»Aber du ziehst die Sache mit uns durch?« Es war Milos Aufgabe, solche Fragen zu stellen.
»Wenn ich wütend bin, kann ich mich besser konzentrieren. «
Milo ging noch einmal die Details durch. Es war ein ziemlich einfacher Plan, dessen Gelingen weniger vom Ablauf abhing als vom Überraschungselement. Jeder kannte seine Aufgabe, aber Radovan – war damit zu rechnen, dass er seinen Frust an einem armen Museumswachmann ausließ? Immerhin hatte er eine Waffe. »Vergesst nicht, wir wollen niemanden verletzen.«
Das war allen klar, da er es im Verlauf der letzten Woche ständig wiederholt hatte. Schon bald hatten sie gespottet, dass Mr. Winter ihre Tante war, die sie aus allen Scherereien heraushalten wollte. In Wirklichkeit hatte er in den letzten knapp drei Monaten ohne fremde Hilfe eine ganze Reihe von Aufträgen erledigt, von denen sie nichts wussten. Er wollte nicht, dass ihm seine Helfer die Glückssträhne verdarben.
Das hier war der achte Auftrag. Er war erst vor kurzem zum Tourismus zurückgekehrt und konnte daher noch Buch führen; andererseits spürte er bereits eine nagende Unruhe, weil all diese Jobs so verdammt einfach gewesen waren.
Nummer vier im Dezember 2007. Die weinerliche Stimme von Owen Mendel, dem geschäfsführenden Leiter der Abteilung Tourismus, erklang aus seinem Nokia: »Fahren Sie nach Istanbul und heben Sie unter dem Namen Charles Little fünfzehntausend Euro bei der Interbank ab. Pass und Kontonummer finden Sie im Hotel. Anschließend fliegen Sie nach London und eröffnen mit dieser Summe bei der Chase Manhattan Bank im 125 London Wall ein Konto. Gleicher Name. Sorgen Sie dafür, dass der Zoll das Geld nicht entdeckt. Meinen Sie, Sie schaffen das?«
Nach dem Warum fragt man als Tourist nicht. Man glaubt einfach, dass alles einer guten Sache dient und dass die weinerliche Stimme am anderen Ende die Stimme Gottes ist.
Zweiter Auftrag im November 2007: »Eine Frau in Stockholm. Sigrid Larsson. Doppel-S. Wohnt im Grand Hotel am Blasieholmshamnen. Sie erwartet Sie. Kaufen Sie Flugtickets nach Moskau und bringen Sie sie bis spätestens achtzehnten zur Trubnaja Uliza 12. Verstanden?«
Sigrid Larsson, eine sechzigjährige Professorin für Internationale Beziehungen, war schockiert, aber auch geschmeichelt wegen des Aufhebens, das um sie gemacht wurde.
Jobs für Kinder, für drittklassige Botschaftsangestellte.
Nummer fünf im Januar 2008: »Vorsicht, wirklich eine heikle Sache. Der Mann heißt Lorenzo Peroni, bedeutender Waffenschieber in Rom. Die Details schicke ich per SMS. Trifft sich in Montenegro mit einem südkoreanischen Käufer namens Park Jin Myung. Sie beschatten ihn ab dem achten, wenn er seine Wohnung verlässt, bis zu seiner Rückkehr am fünfzehnten. Nein, um Mikros müssen Sie sich nicht kümmern, das übernehmen wir. Sie machen die Kameraarbeit, wir brauchen gute Bilder.«
Wie sich herausstellte, war Park Jin Myung kein Waffenkäufer, sondern eine von Peronis zahlreichen Geliebten. Die Fotos hätten besser in eine englische Boulevardzeitung gepasst.
Und so weiter. Noch eine sinnlose Überwachung in Wien, der Befehl, von Berlin aus einen Brief an einen gewissen Theodor Wertmüller in München zu schicken, eine eintägige Beschattung in Paris und zu Beginn des Monats die einzige Liquidierung. Der Befehl dazu kam als SMS:
L: George Whitehead. Gefährlich. Ab Do.
eine Woche in Marseille.
George Whitehead, der Patriarch einer Londoner Verbrecherfamilie, sah ungefähr wie siebzig aus und war in Wirklichkeit fast achtzig. Keine Kugel war nötig, nur ein einziger Stoß im Dampfbad des Hotels. Sein Kopf knallte gegen die feuchten Wandbohlen, und die Gehirnerschütterung zog ihn für immer aus dem Verkehr.
Es fühlte sich nicht einmal an wie ein richtiger Mord.
Andere hätten sich vielleicht über diese mühelosen und belanglosen Aufgaben gefreut. Aber Milo Weaver – oder Sebastian Hall oder Mr. Winter – konnte sich nicht entspannen, weil die Mühelosigkeit und Belanglosigkeit nur einen Schluss zuließen: Sie hatten ihn im Visier. Sie wussten oder ahnten, dass er nicht hundertprozentig loyal war.
Und jetzt dieser Job, wieder ein Test. »Treiben Sie Geld auf. Im Idealfall zwanzig Millionen, aber wenn es nur fünf oder zehn werden, verstehen wir das.«
»Dollar?«
»Ja, Dollar. Haben Sie damit ein Problem?«
Möglicherweise aus Nervosität erzählte Stefan von einer schönen Frau in Monte Carlo, einer Tänzerin, die ihren komfortablen Lebensstil damit bestritt, dass sie Sex mit Tieren hatte, was Stefan für ein geheimes französisches Laster hielt. Auch das störte Milos inneren Soundtrack, und er forderte den Deutschen auf, den Mund zu halten. »Gib Radovan die Waffe.«
Stefan reichte sie dem Serben.
»Gleich da«, meldete Giuseppe.
Milo schielte auf die Uhr. Kurz vor halb fünf, in einer halben Stunde machten sie zu.
Giuseppe fuhr durch ein offenes Tor auf einen gekiesten Hof, wo drei Schweizer Autos vor dem Museum parkten, einer Villa aus dem neunzehnten Jahrhundert. Sie hatte einmal dem in Deutschland geborenen Industriellen Emil Georg Bührle gehört, der einen Teil seines Vermögens mit dem Verkauf von Waffen an das faschistische Spanien und das Dritte Reich verdient hatte. Der Italiener ließ den Motor laufen. Ein Paar mittleren Alters verließ das Museum, und auch jenseits der Mauer hinter ihrem Wagen waren Paare zu erkennen, die einen Sonntagsspaziergang unternahmen.
»Die vier ganz vorn, wie ausgemacht, okay? Wir können nicht lang rumtrödeln.«
»Ja, Tante«, antwortete Stefan, als sie sich schwarze Skimasken übers Gesicht zogen. Giuseppe blieb hinter dem Steuer, während die anderen ausstiegen. Radovan presste die Beretta an den Schenkel, und die drei Männer liefen mit knirschenden Schritten zum Eingang.
Beim Auskundschaften dieses und vier weiterer Museen in der vergangenen Woche hatte Milo festgestellt, dass es hier keine nennenswerten Sicherheitsvorkehrungen gab, ganz als wären die Verantwortlichen des Bührle-Museums noch nie auf die Idee gekommen, dass vielleicht jemand zu vernarrt in Kunst oder auf schnelles Geld aus sein könnte. Vorn befanden sich zwei Wachleute, pensionierte Polizisten, die nicht einmal Schusswaffen trugen. Radovan war dafür eingeteilt, sie außer Gefecht zu setzen, und er erledigte seine Aufgabe mit Gusto: In seinem starken Akzent brüllte er, dass sie sich auf den Boden legen sollten, während er mit der Pistole herumfuchtelte. Vielleicht in dem Gefühl, dass sie es hier mit einem verzweifelten Mann zu tun hatten, gehorchten sie sofort.
Stefan zog die Kartenverkäuferin hinter ihrem Schalter hervor und schob sie hinunter zu den Uniformierten. Milo hielt inzwischen nach Besuchern Ausschau. Es waren nur noch zwei da: ein älteres Paar im ersten Saal. Verdutzt starrten ihn die beiden an.
Während Radovan auf die Gefangenen aufpasste, zückten Milo und Stefan ihre Drahtschneider. Gleich nach dem ersten Schnitt setzte eine schrille Alarmglocke ein, aber darauf waren sie gefasst. Seinen Berechnungen nach hatten sie mindestens zehn Minuten. Ein Monet, ein van Gogh, ein Cézanne und ein Degas.
Mit den schweren Glasscheiben waren die Gemälde sperrig, daher mussten sie jedes zu zweit zum Lieferwagen tragen. Sieben Minuten später tippte Milo dem bedrohlich hin- und herstapfenden Radovan auf die Schulter. Rasch traten sie den Rückzug an.
Giuseppe stieg aufs Gas.
Das war natürlich der leichte Teil. Vier Bilder im Wert von über einhundertsechzig Millionen Dollar in weniger als zehn Minuten. Keine Leichen, keine Verletzten, keine Fehler. Gesichtsmasken, ein Minumum an Gesprächen und ein weißer Lieferwagen auf dem Weg aus der Stadt.
Giuseppe blieb eisern am Tempolimit. Hinten zogen Radovan und Stefan die Leinensäcke über die Gemälde und plauderten über Einzelheiten des Jobs wie über hübsche Mädchen, die sie im Urlaub kennengelernt hatten. Der Ausdruck auf dem Gesicht der Wachleute, der wohlproportionierte Hintern der Kartenverkäuferin, die merkwürdige Ruhe, mit der das alte Paar den Kunstraub beobachtet hatte. Dann beugte sich Stefan ohne jede Vorwarnung nach vorn und übergab sich.
Er entschuldigte sich, aber sie hatten alle genug Erfahrung in solchen Dingen, um zu wissen, dass oft mindestens einer der Beteiligten seinen Magen nicht unter Kontrolle hatte. So etwas war keine Schande.
In einer verwirrenden Abfolge von Kurven und Abzweigungen, die er sich vorher zurechtgelegt hatte, brachte Giuseppe die Gruppe aus dem Stadtgebiet von Zürich. Erst als sie die östliche Straße nach Tobelhof erreichten, entspannten sie sich ein wenig, und für eine kurze Minute bot sich ihnen der friedliche Ausblick auf den Wald dar, der sich zur Spitze des Zürichbergs hinaufzog. Ein Moment der Unschuld, der nicht von Dauer war. Sie passierten die verstreuten Anwesen von Tobelhof, und als sie die urbane Gegend um Gockhausen erreichten, war das Gefühl bereits wieder verflogen.
Jenseits der Stadt gelangten sie wieder in den Wald und fuhren nach links auf einen verlassenen Feldweg, wo nach einem knappen Kilometer auf einer Lichtung ein VW-Bus und ein Mercedes auf sie warteten. Sie stiegen aus und streckten sich. Radovan stieß einen serbischen Freudenfluch aus – »Jebote!« –, bevor sie die Bilder in den VW luden. Giuseppe verteilte einen Kanister Benzin im Inneren des weißen Lieferwagens.
Milo holte aus dem Kofferraum des Mercedes eine weiche Lederaktentasche. Darin befanden sich kleine, gebrauchte Euroscheine im Wert von sechshunderttausend Dollar, verpackt in drei Plastiktüten. Auf eine Frage hin hätte er erklärt, dass das Geld einem Drogenhändler in Nizza abgenommen worden war, aber niemand fragte. Er dankte ihnen für ihre gute Arbeit, und alle forderten ihn auf, sie anzurufen, wenn er wieder einen Job für sie hatte. Milo wünschte Radovan Glück für seine Mutter.
»Es hat lang gedauert«, antwortete der Serbe, »aber jetzt weiß ich, was für mich Vorrang hat. Mit dem Geld kann ich alles bezahlen, was sie braucht.«
»Ich finde, du bist ein guter Sohn.«
»Ja, das bin ich.« Nicht die geringste Bescheidenheit lag in seinem Ton. »Wenn ein Mann den Kontakt zu seiner Familie verliert, kann er sich gleich eine Kugel in den Kopf jagen.«
Milo lächelte freundlich und schüttelte ihm die Hand, aber Radovan ließ nicht los.
»Weißt du, Tante, ich mag eigentlich keine Amerikaner. Die haben meine Heimatstadt bombardiert. Aber dich – dich mag ich.«
Milo war nicht sicher, wie er damit umgehen sollte. »Wie kommst du darauf, dass ich Amerikaner bin?«
Ein breites Grinsen zog über Radovans Gesicht. Es war das wissende und leicht überhebliche Lächeln, das man bei Männern vom Balkan oft beobachten konnte. »Sagen wir einfach, dein deutscher Akzent ist furchtbar.«
»Vielleicht bin ich Engländer. Oder Kanadier.«
Ein Lachen platzte aus Radovan hervor, und er klopfte Milo auf den Arm. »Nein, du bist schon ein Amerikaner. Aber ich mach dir keinen Vorwurf daraus.« Er griff in die Tasche und reichte Milo mit einem Zwinkern dessen abgenutzten Pass. »Tut mir leid, aber ich möchte wissen, für wen ich arbeite. Also dann, tschüs!«
Als Milo dem Serben nachblickte, der voller Stolz zu den anderen trat, musste er daran denken, dass sie beide Glück gehabt hatten. Wenn er etwas geklaut hätte, was einen Rückschluss auf Milos wahre Identität erlaubt hätte – also nicht bloß den Pass mit dem Namen Sebastian Hall –, wäre Radovan nicht lebend aus diesem Wald herausgekommen. Und Milo war nicht unbedingt scharf darauf, heute noch jemanden zu töten.
Als die drei verschwunden waren, setzte er mit dem VW-Bus noch ein paar Meter nach hinten. Dann ging er zurück und zündete mit seinem Zippo die Sitze des Lieferwagens an, ohne die Türen zu schließen. Sich selbst zündete er eine Davidoff an und wartete, bis sich die roten Flammen ausgebreitet hatten und blau wurden, als das Armaturenbrett schmolz und das Innere mit giftigem Rauch füllte. Er drückte die Zigarette an seinem Absatz aus und warf sie in das wachsende Inferno. Dann setzte er sich in den VW und fuhr weg.
Weiter südlich auf der A2, die ihn nach Mailand führen sollte, vibrierte auf dem Beifahrersitz sein Telefon. Er musste gar nicht die Meldung UNBEKANNTER ANRUFER auf dem Display sehen, um zu wissen, wer das war.
Doch die Stimme gehörte nicht Owen Mendel. Sie war tief, aber lebendig wie die eines gebildeten Mannes, der sich noch an seine progressive Jugend klammert. Aber der Code war unverändert.
»Stattlich und feist.«
»Erschien Buck Mulligan«, antwortete Milo. »Wer sind Sie?«
»Der Neue, wenn Sie so wollen. Alan Drummond. Und Sie sind wohl Sebastian Hall.«
»Was ist mit Mendel passiert?«
»Er war nur eine Übergangslösung, bis sie mich gefunden haben. Gehen Sie davon aus, dass ich bleibe.«
»Okay.« Milo zögerte. »Aber Sie rufen nicht bloß an, um sich vorzustellen, oder?«
»Ich bitte Sie, so was würde ich nie machen. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche.«
»Dann kommen wir zur Sache.«
Darauf beorderte ihn Alan Drummond, seine neue Stimme Gottes, ins Hotel Hansablick in Berlin. »Dort warten Instruktionen auf Sie.«
»Sie wissen aber, dass ich hier gerade beschäftigt bin.«
»Das will ich hoffen. Dauert auch nur ein paar Tage.«
»Keine Hinweise?«
»Ich denke, die Sache erklärt sich von selbst.«
Zwei Stunden später verfrachtete er die Gemälde in einem Vorort von Lugano in eine Garage, die er vor einer Woche angemietet und mit einem Kombinationsschloss gesichert hatte. An der Decke brannte eine einzelne Leuchtstoffröhre, in deren surrealem Schein er kurz stehen blieb, um die Bilder zu betrachten. Es war eine Schande: Nach seinem unter starkem Zeitdruck entstandenen Plan sollten nur zwei von ihnen in die Welt zurückkehren. Er zündete sich eine neue Zigarette an und versuchte zu entscheiden, welche überleben sollten und welche nicht, aber er brachte es nicht fertig. Graf Ludovic Lepic und seine zwei Töchter starrten ihn vorwurfsvoll an, als ob sie befürchteten, nie wieder bestaunt zu werden. Degas hatte sie vor fast eineinhalb Jahrhunderten mit Ölfarben unsterblich gemacht, und irgendwann war ein Großindustrieller auf sie gestoßen und hatte sie in seine Villa gehängt. Nächste Woche mussten sie oder zwei andere Bilder mit Hilfe von ein wenig Benzin und dem Feuerzeug verschwinden, als hätten sie nie existiert.
Er sperrte ab und fuhr weiter, bis die südlichen Alpen der Schweiz dem lombardischen Flachland wichen. Die Luft vor seinem Fenster war kalt und sauber, aber in der italienischen Dunkelheit waren die Gipfel hinter ihm nicht zu erkennen. Erst nach Mitternacht erreichte er die neonhellen Straßen Mailands, und auf dem Viale Papiniano wischte er den VW aus und ließ ihn stehen. Nach einer einstündigen Zugfahrt nach Bergamo stieg er in einen Shuttle-Bus zum Flughafen Orio al Serio, wo der erste Flug nach Berlin um halb neun ging. Seine Tragetasche hatte er in einer Züricher Mülltonne entsorgt, bevor er zu seinem Team stieß, daher hatte er jetzt nur dabei, was er in seinen Taschen hatte: Pillen, Davidoffs, Pass, Bargeld und EC-Karten, Handy und einen schlüssellosen Schlüsselring mit einer kleinen Fernbedienung. Er ging mit seinem Sebastian-Hall-Pass an Bord und setzte sich auf einen Platz über dem Flügel, neben einem müden Halbwüchsigen. Rasch schluckte er zwei Dexedrin, um wach zu bleiben. Als sie in der Luft waren, meldete sich der Junge: »Vacation.«
»Pardon?«
Der Italiener mit makellosem Akzent grinste. »Der Song, den Sie summen. ›Vacation‹ von den Go-Go’s.« Er war sichtlich stolz darauf, ein Stück zu kennen, das die meisten Leute zum Zeitpunkt seiner Geburt bereits vergessen hatten.
»Stimmt«, räumte Milo ein. Dann sackte er trotz der in seinen Nervenbahnen ratternden Drogen und der hellen Anrufbeantworterstimmen in seinem Hinterkopf sofort weg.
Anfang November hatten sie angerufen und ihn gefragt, ob er an einer Rückkehr in den Außendienst interessiert war. »Ihre Leistungen waren ja immer hervorragend.« Dieses leicht verblüffte Lob hatte Owen Mendel geäußert – verblüfft, weil er nicht wusste, weshalb dieser fähige Tourist, der sogar schon in die Verwaltung aufgestiegen war und dort sechs Jahre gearbeitet hatte, von der Company gefeuert worden war. Offenkundig hatte Mendel nur eine stark zensierte Akte zu Gesicht bekommen. »Natürlich liegt es bei Ihnen, aber Sie wissen ja, welchen Budgetzwängen wir zurzeit unterliegen. Wenn wir erfahrene Kräfte wie Sie gewinnen, haben wir vielleicht eine Chance zur Erholung.«
Nette Ansage. Nicht die Company erwies ihm einen Gefallen, nein, er war der gute Samariter.
Sobald er Owen Mendels Stimme hörte, wusste er genau, was folgen würde. Jewgeni hatte ihn vorbereitet. »Du sagst natürlich Ja, und nach einem Auffrischungskurs stellen sie dich mit einigen Aufträgen auf die Probe. Ein paar Wochen lang. In dieser Zeit musst du dich bewähren, und wir werden keinen Kontakt haben.«
Aus den »paar Wochen« waren drei Monate geworden. Damit hatte nicht einmal der große Jewgeni Primakow gerechnet, das geheime Ohr der Vereinten Nationen. Und er hatte auch nicht damit gerechnet, was für einen Auftrag Mendels Nachfolger Alan Drummond Milo in Berlin erteilen würde: eine letzte, unmögliche Probe.
Der Job in Zürich lag fünf Tage zurück, es war Freitag, kurz vor neun Uhr. Milo stand auf dem kalten, windigen Platz vor dem Berliner Dom. Er fühlte sich wie Matsch, und durch sein umnebeltes Gehirn spukten böse Vorahnungen. Es fiel ihm schwer, nicht wie ein Penner auszusehen. Die ganze Nacht hatte er Trost bei einem Honiglikör namens Bärenfang gesucht, aber das hatte seine Übelkeit nur verstärkt. Donnernd rollte der Stoßverkehr auf ihn zu; ein Reisebus mit Augsburger Kennzeichen bog in die Karl-Liebknecht-Straße und stoppte ein kurzes Stück entfernt mit lautem Ächzen.
Ein weißer Luftpolsterumschlag hatte auf ihn gewartet, und nachdem er ihn im Hansablick gegen ein Trinkgeld in Empfang genommen hatte, hatte er ihn auf einen langen Spaziergang, eine U-Bahn-Fahrt und einen weiteren Fußweg mit zu einer staubigen, unscheinbaren Pension in Friedrichshain genommen, einem Szeneviertel im ehemaligen Ostberlin.
Zwei Fotos zeigten aus verschiedenen Blickwinkeln ein hübsches, blond gefärbtes Mädchen mit olivfarbener Haut. Adriana Stanescu, fünfzehn Jahre alt, das einzige Kind der moldawischen Einwanderer Andrei und Rada Stanescu. Auf der Rückseite eines Bildes stand:
L0 2/15
Das Kind töten und die Leiche verschwinden lassen. Er hatte bis zum Ende der Woche Zeit.
Gleich am Montag hatte er die Instruktionen verbrannt und danach die Stanescus beschattet, um Näheres über ihr Leben herauszufinden. Rada Stanescu arbeitete bei Imperial Tobacco, und ihr Mann Andrei fuhr an den meisten Abenden einen Wagen der Alligator Taxi GmbH. Sie lebten in Kreuzberg zwischen türkischen Familien und neureichen Deutschen, ein wenig südlich von Milos Pension.
Was war mit dem Mädchen Adriana, deren Tod beschlossen worden war? Er hatte sie auf dem Weg zur Lina-Morgenstern-Gesamtschule verfolgt, die von Deutschen und Türken besucht wurde. Er konnte nichts Ungewöhnliches feststellen.
Keine Fragen stellen – eine weitere Regel im Tourismus. Wenn ein Mädchen getötet werden soll, dann ist es eben so. Handeln genügt als Rechtfertigung.
Schlendernd näherte er sich der Kasse, wo die Bayern aus dem Bus vor Kälte in die Hände klatschten und zwischen dampfenden Atemwolken darauf warteten, dass sich der Schalter öffnete.
Jeden Morgen setzte Andrei Stanescu seine Tochter einen Block vor ihrer Schule ab. Warum brachte er sie nicht direkt hin? Weil es (das entnahm er ihrer Haltung und der Scham im Gesicht ihres Vaters) Adriana peinlich war, dass ihr Vater Taxi fuhr. Zwischen der Stelle, wo sie ausstieg, und der Schule an der Gneisenaustraße befanden sich sechs Wohnhäuser und die stets offene Einfahrt zu einem Hof. Am Nachmittag kam sie auf der gleichen Strecke zurück, immer allein. Das hieß also, dass es in diesem Hof passieren musste. Wenn überhaupt.
Jeder Tourist hat eine Vergangenheit, und Alan Drummond wusste alles über die zwei Gründe, die Milo bei einem komfortableren Budget den Zugang zum Tourismus verwehrt hätten: seine Frau und seine Tochter. Drummond war natürlich klar, dass diese scheinbar so einfache Aufgabe für ihn schwerer war als das Erstürmen der iranischen Botschaft in Moskau.
Offenbar hatte Milo mit seinem Verdacht richtig gelegen: Die Abteilung vertraute ihm noch immer nicht, und die bisherigen Aufträge hatten nur als Vorbereitung gedient, als dreimonatige Inkubationszeit vor seiner Wiedergeburt als Tourist. Ein langer Probelauf, der im neunten Auftrag gipfelte: ein Umschlag, der graue Himmel über Berlin und der Wunsch, lieber sich selbst auszulöschen, als diesen Job durchzuführen.
Hätte er keine Tochter gehabt, wäre es ihm dann leichter gefallen? Er beschloss ganz bewusst, nicht darüber nachzudenken, aber sein Gehirn ignorierte diese Absicht. Stattdessen stellte er sich die sinnlose Frage, wie viele böse Taten nötig sind, damit jemand wirklich böse ist. Sechs? Achtzehn? Nur eine? Wie viele hatte er begangen?
Was sagt die große Stimme?
Schluss.
Er musste den Grund herausfinden. Warum war Adriana Stanescu zum Tod verurteilt worden?
Er hatte rund um die Uhr gearbeitet: den Müll der Familie durchwühlt, die Kontobewegungen überprüft, eine Zeit lang die Bekannten der Stanescus beschattet. Der einzige kleine Makel, auf den er stieß, war ein Onkel namens Mihai, der in einer Bäckerei in der Nähe des Tiergartens arbeitete. Er war zweimal verhaftet worden, weil er illegal Moldawier nach Deutschland geschleust hatte. Ein Menschenschmuggler, aber eher von der unbedeutenden Sorte. Warum wäre er sonst jeden Morgen um vier aufgestanden und erst nach vier Uhr nachmittags von der Arbeit nach Hause zurückgekehrt, die Haare staubig und der ganze Körper klebrig von Mehl?
Nichts deutete darauf hin, dass die Stanescus etwas anderes waren als eine schwer arbeitende Einwandererfamilie mit einer reizenden halbwüchsigen Tochter.
Doch schon während der Nachforschungen bereitete er sich vor. Am Mittwoch besuchte er eine Kneipe in der Nähe der Zentrale von Alligator Taxi und knüpfte dort ein Gespräch mit Günter Wittinger an, einem jungen Fahrer, der erst seit einem Jahr für die Firma tätig war. Er stellte sich als jemand vor, der einen guten Rat brauchte, weil er in diesen Beruf einsteigen wollte. Auch wenn sich Radovan mokiert hatte, reichten seine Sprachkenntnisse dafür aus. Als Günter sechs Biere später auf der Toilette war, stahl Sebastian seinen Alligator-Ausweis und machte sich aus dem Staub.
Am Donnerstag – Valentinstag, wie er an den läppischen rosa Herzen in den Schaufenstern erkannte – stand der Plan. Er kannte ihn in- und auswendig. Die Methode der Ausführung und die Methode der Entsorgung. Er hatte das Werkzeug beisammen – starken Draht, Isolierband, eine große Plastikplane, eine Handsäge –, doch als der Kassierer die Sachen in eine feste Papiertüte hatte gleiten lassen, wäre er bei dem Gedanken an ihre Verwendung fast zusammengebrochen.
Er konnte zwar alle Schritte durchexerzieren, aber in Wirklichkeit war er am Ende. Er war nicht der Tourist Sebastian Hall, sondern der Vater Milo Weaver. Gegen jede Vernunft rief er bei seinem eigenen Vater an.
Es war dumm und irrational. Wenn die Stimme Gottes herausfand, dass er einem leitenden Angestellten der UN Geheimnisse zuflüsterte, war er ein toter Mann. Sogar der Alte reagierte ziemlich kurz angebunden. »Du brauchst mich nicht, Mischa. Du glaubst nur, dass du mich brauchst.«
»Nein, ich brauche dich. Sofort.«
»Was ist daran so schwierig? Du hast alles genau geplant. Mach es einfach.«
»Du verstehst das nicht. Sie sieht genau aus wie Stephanie. «
»Sie sieht überhaupt nicht wie Stephanie aus. Außerdem ist sie doppelt so alt.«
»Egal.« Auf einmal war sich Milo ganz sicher. »Es ist aus. Unsere Abmachung ist hinfällig. Ich bring die Kleine nicht um, bloß damit du deine Quelle kriegst.«
Milo musste erkennen, dass elterliches Verantwortungsgefühl den Alten nicht erweichen konnte. Aber das Risiko, einen Informanten innerhalb der CIA zu verlieren, ließ Jewgeni Primakow aufseufzen. »Wir treffen uns morgen um neun im Berliner Dom. Wir mischen uns unter die Leute.«
Vor seinem Aufbruch in Friedrichshain hatte Milo sein Zimmer in der Pension gesäubert und die Toilettensachen sowie die beiden Kleidergarnituren weggeworfen, die er im KaDeWe gekauft hatte. Egal, was passierte, er wollte noch heute aus dieser verdammten Stadt verschwinden. Um sicherzugehen, dass niemand in der Avenue of the Americas seinen verräterischen Weg nachvollzog, hatte er sein Telefon zerlegt.
Jetzt war es neun, und die Augsburger aus dem Bus tröpfelten allmählich in die Kirche.
Er trat zur Kasse. Die alte Verkäuferin, die schon in Berlin gelebt hatte, als die Stadt noch ein neunhundert Quadratkilometer großer Schutthaufen war, schielte ihn misstrauisch an, als er seinen Wunsch äußerte, den Dom zu besichtigen. Er sah so verkatert aus, wie er war, doch sein Fünfeuroschein war neu.
Irgendwie hatte es Jewgeni Primakow vor ihm in die kalte Kirche geschafft, obwohl Milo unmittelbar nach dem letzten Bayern eingetreten war. Der Alte stand unter einem Fenster und einem Kuppelmosaik mit der Aufschrift Selig sind, die reinen Herzens sind. Milos alkoholgetrübte Augen konnten die Worte nicht entziffern, aber er kannte den Dom von früheren Besuchen.
Sein Vater würdigte ihn keines Blickes. Die langen, knotigen Hände hinter dem Rücken verschränkt, spähte er zu dem Gemälde hinauf. Seit ihrer letzten Begegung waren fünf Monate vergangen, und Jewgeni Primakow hatte sich nicht im Geringsten verändert. Dünnes weißes Haar, schmächtige Gestalt, dichte Augenbrauen und eine Tendenz, mit dem Zeigefinger der linken Hand nach der Wange zu hacken. Wieder ein teurer Maßanzug, der wohl für sein offizielles Amt bei den Vereinten Nationen unverzichtbar war. Milo war größer und hatte einen dunklen Teint. Trotz der schwerlidrigen Augen, die er von seinem Vater geerbt hatte, konnte er sich nicht vorstellen, so zu altern.
Genau wie jetzt waren sie mit dem letzten Treffen ein unverantwortliches Risiko eingegangen. Eine Woche nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis war Milo spätnachts betrunken und frustriert aus dem Fenster seines Apartments in Newark geklettert, die Feuerleiter hinuntergestiegen und in das Gebäude gegenüber geschlichen, wo sich sein Rund-um-die-Uhr-Schatten verschanzt hatte. Er kannte das Gesicht des jungen Agenten – er war ihm seit dem Bus vom Gefängnis gefolgt – und wusste, für wen er arbeitete. Mit einem Schraubenzieher und einem selbst gebastelten Dietrich öffnete er die Wohnungstür und fand ihn dösend auf einer Pritsche unter dem offenen Fenster. Neben sich hatte er eine Videokamera mit einem Stapel Bänder und ein Richtmikrofon. Auf dem Boden waren Fastfood-Behälter und Pappbecher verstreut. Er setzte dem Jungen den Schraubenzieher an den Hals und sprach ihn leise an: »Bestell dem russischen Schweinehund, dass ich ihn in den nächsten achtundvierzig Stunden treffen will.«
»Äh … was für ein Russe?«, keuchte der Agent.
»Der, der deine Strippen zieht. Der, von dem nicht mal die UN weiß, dass er für sie schnüffelt und spioniert. Ruf ihn an und sag ihm, er soll mir alles über den Senator beschaffen. «
»Was für einen Senator?«
»Der, der mich um meine Familie gebracht hat.«
Fünfunddreißig Stunden später hatte ihn Primakow in demselben dreckigen Zimmer getroffen, wie immer piekfein gekleidet, und seine Einschätzung des Politikers kritisiert. »Nein.« Jewgeni sprach russisch. »Du hast dich selbst um deine Familie gebracht, weil du gelogen hast.« Doch die Akte über Senator Nathan Irwin hatte er trotzdem dabei.
Nicht, dass Milo viel daraus erfahren hätte, was er nicht ohnehin schon wusste. Jemand wie Irwin trug dafür Sorge, dass die wesentlichen Einzelheiten seines ansonsten öffentlichen Lebens privat blieben. Der Senator war der Drahtzieher des sudanesischen Desasters im letzten Jahr – der Mord an einem muslimischen Geistlichen, der Unruhen mit über achtzig Todesopfern nach sich gezogen hatte –, und sein verzweifeltes Bemühen, das Ganze zu vertuschen, hatte noch weitere Menschen das Leben gekostet, unter anderem zwei enge Freunde Milos, und Milo ins Gefängnis gebracht. »Kann sein, dass der Mann auf deiner Hassliste ganz oben steht«, meinte Jewgeni, »aber deswegen ist er noch lange nicht für alle Enttäuschungen in deinem Leben verantwortlich.«
Jetzt, fünf Monate später, starrte der Alte hinauf zu dem Gemälde, an dem er Gefallen gefunden hatte, und sprach, wieder auf Russisch, scheinbar mit den Figuren. »Ich habe nachgeforscht. Könnte ein Racheakt gegen den Onkel sein. Der Bäcker. Du hast ihn nicht überprüft, oder?«
»Er ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ich hab ihn beobachtet. Er ist völlig sauber.«
»Aber ich hab ihn nicht nur beobachtet. Mihai Stanescu hat die Finger in Einwanderungsangelegenheiten. Er arbeitet für Immigranten aus dem Osten und besorgt ihnen Arbeit. Auch die Familie des Mädchens ist auf diese Weise hergekommen. Manchmal schmuggelt er die Menschen sogar ein. Er hat Verbindungen zur russischen Mafia in Transnistrien – im Grunde also Verbindungen zur dortigen Regierung. Ich schätze, dass er über diese Einwanderer auch Heroin nach Deutschland transportiert.«
Milo ließ sich nicht so leicht überzeugen. »Und? Warum soll dann seine Nichte umgebracht werden?«
»Vielleicht wurde er gewarnt. Vielleicht steckt das Mädchen mit drin.«
»Auf keinen Fall.«
»Sagst du.«
»Ich habe recht, Jewgeni.«
Sein Vater antwortete nicht sofort, weil plötzlich hinter ihm drei Augsburger auftauchten. Ehrfürchtig flüsternd deuteten sie hoch zu dem Gemälde, und einer schwenkte seine Kamera. Als sie weitergezogen waren, fuhr er fort: »Du weißt genauso gut wie ich, dass man viel länger als eine Woche braucht, um rauszufinden, warum deine Leute dieses Mädchen liquidieren wollen. Wenn New York dich nicht einweiht, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Grund gibt.«
Milo verzichtete auf eine Erwiderung, weil alle Argumente erschöpft waren. Seine Entscheidung stand unverrückbar fest.
Primakow drehte sich zu seinem Sohn um, nicht ohne zuerst einen Blick auf das Gedränge der Touristen in der Kathedrale zu werfen. Schließlich fixierte er ihn stirnrunzelnd. »Du siehst wirklich furchtbar aus, Mischa. Und du stinkst.«
»Berufsrisiko.«
Primakow wandte sich wieder dem Kuppelmosaik zu. »Wahrscheinlich hast du recht, jedenfalls aus meiner Sicht. Das Mädchen ist in nichts verwickelt, und niemand hat was von ihrem Tod. Außer natürlich dein unmittelbarer Vorgesetzter. Wie heißt er?« Selbst jetzt versuchte er, so viel wie möglich herauszuschlagen.
»Alan Drummond.«
»Ein Neuer also? Ich dachte, die Leitung hat jetzt Mendel.«
»Drummond sagt, dass er ihn abgelöst hat.«
»Und wer ist dieser Drummond?«
»Eine Stimme am Telefon.«
Ohne ihn anzuschauen, hakte Primakow nach. »Und du hast die Stimme am Telefon, die dich auffordert, ein junges Mädchen zu beseitigen, nicht überprüft?«
Milo starrte auf den Hinterkopf seines Vaters. »Yale. Marines, zwei Jahre Afghanistan. 2005 Wechsel zur Company. Einsatzbereich Rüstungskontrolle. Im nächsten Jahr auf eigenen Wunsch in die Abteilung Kongressangelegenheiten versetzt. Ich weiß nicht, wie er von dort zum Tourismus gekommen ist. Wahrscheinlich Beziehungen.«
»Wer sind seine Beziehungen?«
»Keine Ahnung, aber es muss jemand mit einigem Einfluss sein.«
Primakow scharrte über seine Wange. »Ja, das passt zusammen. Mendel hat dich Stück für Stück auf die Probe gestellt. Einfache Aufträge. Dann übernimmt dieser Drummond das Kommando, und er möchte seinen Gönnern in der Regierung beweisen, was er für ein Ass ist, will den Tourismus auf Vordermann bringen. Also schaut er sich deine Akte an, und da fällt ihm deine Tochter auf. Im Idealfall hätte er eine Sechsjährige finden müssen, um die du dich kümmern sollst, aber so ein Job wäre schon viel verlangt, selbst von einem Touristen. Deswegen verdoppelt er das Alter und pickt wahllos jemanden heraus.«
»Dann bleib ich dabei. Es ist vorbei. Ich bringe nicht irgendein Mädchen um, bloß damit ich in New York gut dastehe.«
»Lass es dir lieber nochmal durch den Kopf gehen.«
»Das mache ich seit fast einer Woche, Jewgeni.« Er hielt inne. »Mutter erlaubt es nicht.«
Der Alte bearbeitete wieder seine Backe. »Hörst du wieder ihre Stimme?«
»Manchmal.«
Die Tatsache, dass sein Sohn den Empfehlungen einer Toten lauschte, schien Jewgeni Primakow nicht weiter zu stören. »Du musst sie ja nicht umbringen. Du hast gesagt, sie wollen keine Spuren, keine Leiche. Es reicht, wenn sie verschwindet.«
»Soll ich sie irgendwo in einem Kellerloch gefangen halten? Danke für den Rat.«
Er wandte sich zum Gehen, aber Primakow fasste ihn am Arm, und sie schlenderten zusammen durch den südlichen Gang. »Du bist kaputt. Wieder diese Pillen?«
»Nicht viele.«
»Du musst gesund bleiben, Mischa. Ich will nicht, dass du dich vorzeitig ins Grab legst. Und Tina auch nicht. Hast du in letzter Zeit mit ihr geredet?«
Sofort schossen ihm die Erinnerungen durch den Kopf. Das letzte Treffen mit seiner Frau, im November, einen Tag nach dem Anruf von der Company. Ihre gemeinsamen Beratungsgespräche hatten ständig um die gleichen Argumente gekreist, ohne den geringsten Fortschritt. Vertrauen – das war der Knackpunkt. Tina hatte zu viel über ihren Mann erfahren. Niemand, so hatte sie der Therapeutin auseinandergesetzt, fühlt sich gern wie der Trottel in einer Beziehung. Im Lauf der Wochen hatte er keine Zeichen von Nachsicht erkennen können, also nahm er das Angebot der CIA an und erzählte am nächsten Tag mit der vagen Umschreibung Außendienst von seiner neuen Tätigkeit. Die Therapeutin, die die plötzliche Kälte im Raum spürte, fragte Tina, ob sie sich dazu äußern wollte. Tina fuhr die Konturen ihres großen, sinnlichen Mundes nach. Na ja, eigentlich wollte ich vorschlagen, dass er wieder bei Stef und mir einzieht. Aber das ist jetzt wohl vom Tisch.
Schlechtes Timing.
»Mischa?«
Der Alte packte ihn an den Schultern und zog ihn tiefer in den Schatten.
»Kein Grund, Tränen zu vergießen, mein Sohn. Sie ist immer noch deine Frau, und auch Stephanie bleibt deine Tochter. Kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.«
Milo wischte sich die Wangen trocken, er war nicht einmal verlegen. »Das kannst du doch gar nicht wissen.«
Der Alte bleckte das blendend weiße Gebiss zu einem Grinsen. »Natürlich weiß ich es. Im Gegensatz zu dir habe ich ab und zu bei meiner Schwiegertochter und meiner Enkelin vorbeigeschaut.«
Das überraschte ihn. »Was hast du Tina gesagt?«
»Die Wahrheit, was sonst? Ich hab ihr alles über deine Mutter erzählt, wie sie gestorben ist, und warum du ihr deine Kindheit und mich verschwiegen hast.«
»Hat sie es verstanden?«
»Also wirklich, Mischa. Du darfst die Menschen nicht so unterschätzen. Vor allem nicht deine Frau.« Er strich seinem Sohn über den Rücken. »Sie weiß, dass du dich im Augenblick nicht melden kannst. Aber sobald es möglich ist, wäre es sicher keine schlechte Idee, ihr einen Besuch abzustatten.«
Das war die beste Nachricht seit Monaten. Fast eine Minute lang hörte Adriana Stanescu auf zu existieren, und er konnte wieder atmen. Immer noch verkatert, ja, aber er fühlte wieder Boden unter den Füßen. Er räusperte sich und wischte sich noch einmal übers Gesicht. »Danke, Jewgeni.«
»Nichts zu danken. Und jetzt kümmern wir uns um dein kleines Problem.«