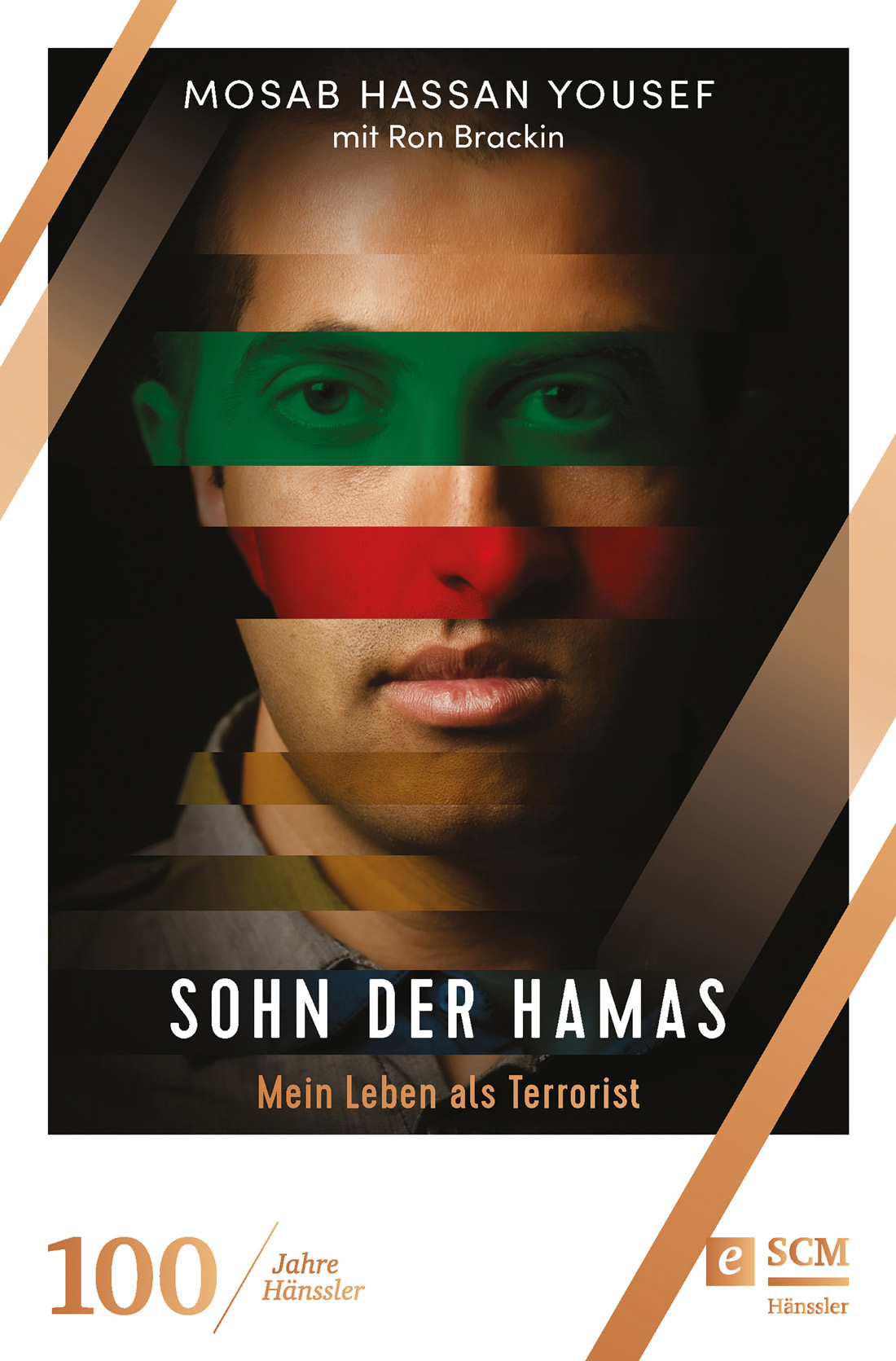
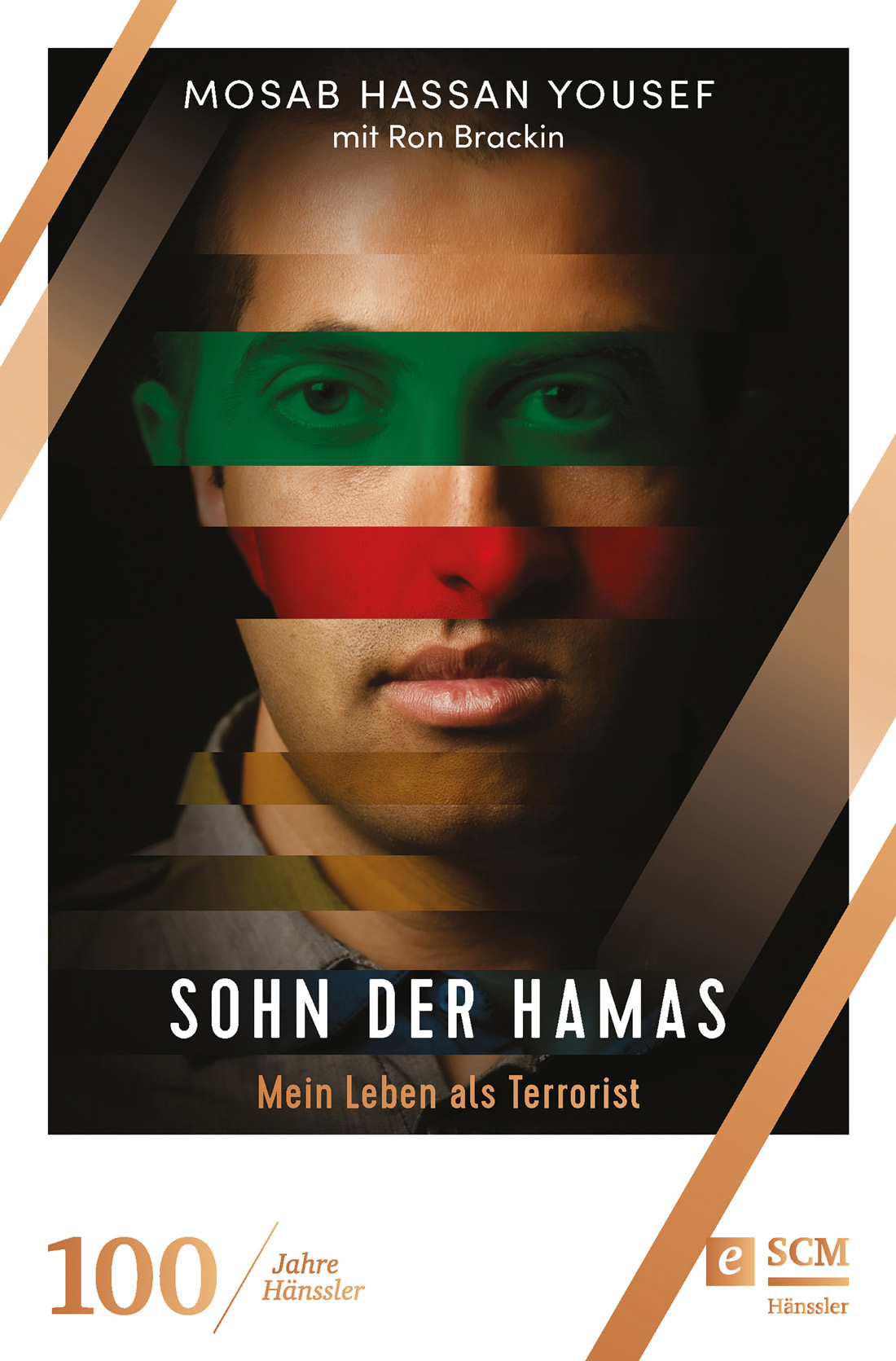
Mosab Hassan Yousef
mit Ron Brackin
Sohn der Hamas
Mein Leben als Terrorist

MOSAB HASSAN YOUSEF
mit Ron Brackin
Sohn der Hamas
Mein Leben als Terrorist


Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das E-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
4. Auflage 2010
Bestell-Nr. 395.223
ISBN 978-3-7751-5223-5 (lieferbare Buchausgabe)
ISBN 978-3-7751-7025-3 (E-Book)
Datenkonvertierung E-Book:
Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH, 80801 München
© Copyright der Originalausgabe 2010 by Mosab Hassan Yousef
Published by Tyndale House Publishers, Inc., USA.
Originally published in English under the title: Son of Hamas
All rights reserved. This Licensed Work is published with permission.
Author and cover photo copyright © 2009 by Tyndale House Publishers, Inc.
All Rights Reserved.
© Copyright der deutschen Ausgabe 2010 by
SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de
E-Mail: info@scm-haenssler.de
Übersetzung: Doris C. Leisering
Israelkarte: Timo Roller, www.morija.de
Umschlaggestaltung: OHA Werbeagentur GmbH, Grabs, Schweiz;
www.oha-werbeagentur.ch
Satz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:
Neues Leben. Die Bibel, © Copyright der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 by
SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.
Weiter wurden verwendet: Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus im
SCM-Verlag GmbH & Co. KG · 58452 Witten.
Die Weblinks wurden bei Redaktionsschluss der 1. Auflage überprüft. Zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten.
Widmung
Für meinen geliebten Vater und meine auseinandergerissene Familie.
Für die Opfer des palästinensisch-israelischen Konflikts.
Für jedes Menschenleben, das der Herr gerettet hat.
Meiner Familie.
Ich bin sehr stolz auf Euch! Nur mein Gott allein kann verstehen, was Ihr durchgemacht habt. Ich weiß: Das, was ich getan habe, hat Euch eine weitere tiefe Wunde zugefügt, die in diesem Leben vielleicht nicht heilen wird, und vielleicht werdet Ihr für immer mit dieser Schande leben müssen.
Ich hätte ein Held werden und mein Volk stolz auf mich machen können. Ich weiß, welche Art Held mein Volk gern gehabt hätte: einen Kämpfer, der sein Leben und seine Familie seiner Nation zu Füßen legt. Selbst nach meinem Tod hätten zukünftige Generationen meine Geschichte noch erzählt und wären ewig stolz auf mich gewesen – doch in Wirklichkeit wäre ich kein großer Held gewesen.
Stattdessen wurde ich in den Augen meines Volkes zum Verräter. Früher wart Ihr sehr stolz auf mich, jetzt bin ich Eure Schande. Früher war ich der Thronfolger, jetzt bin ich ein Fremder in einem fremden Land, der gegen Einsamkeit und Dunkelheit als seine Feinde kämpft.
Ich weiß, Ihr betrachtet mich als Verräter. Bitte versteht, dass ich nicht Euch verraten habe, sondern Euer Verständnis von Heldentum. Erst dann, wenn die Nationen des Nahen Ostens – Juden und Araber gleichermaßen – etwas von dem zu verstehen beginnen, was ich jetzt verstehe, wird es Frieden geben. Und wenn mein Herr abgelehnt wurde, weil er die Welt vor der Strafe der Hölle gerettet hat, dann macht es auch mir nichts aus, abgelehnt zu werden!
Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber ich weiß, dass ich keine Angst habe. Und jetzt möchte ich Euch etwas weitergeben, das mir bisher geholfen hat zu überleben: Alle Schuld und Schande, die ich all die Jahre getragen habe, ist ein geringer Preis für die Rettung eines – vielleicht auch nur eines einzigen – unschuldigen Menschenlebens.
Wie viele Menschen wissen zu schätzen, was ich getan habe? Nicht sehr viele. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube an das, was ich getan habe. Ich glaube noch immer. Das ist der einzige Motor, der mich auf meiner langen Reise in Bewegung hält. Jeder Tropfen unschuldigen Bluts, der gerettet wurde, gibt mir Hoffnung und Stärke, den Weg bis zum letzten Tag weiterzugehen.
Ich habe bezahlt. Ihr habt bezahlt. Und dennoch fordern Krieg und Frieden immer noch einen hohen Preis. Gott sei mit uns allen und gebe uns, was wir brauchen, um diese schwere Last zu tragen.
In Liebe,
Euer Sohn
Inhalt
Karte von Israel und den palästinensischen Gebieten
Ein Wort vom Autor
Vorwort
Gefangen
Die Leiter des Glaubens
Die Muslimbruderschaft
Steinwürfe
Überleben
Die Rückkehr eines Helden
Radikal
Öl ins Feuer
Waffen
Das Schlachthaus
Das Angebot
Nummer 823
Traue niemandem
Aufstand
Straße nach Damaskus
Zweite Intifada
Undercover
Meistgesucht
Schuhe
Zerrissen
Das Spiel
Schutzschild
Übernatürlicher Schutz
Schutzhaft
Salih
Eine Vision für die Hamas
Auf Wiedersehen
Epilog
Nachwort
Die beteiligten Personen
Worterklärungen
Chronologische Übersicht
Anmerkungen

Ein Wort vom Autor
Zeit ist etwas Fortlaufendes – ein Faden, der sich zwischen Geburt und Tod spannt.
Ereignisse ähneln allerdings eher einem persischen Teppich – Tausende wunderbar farbiger Fäden, die zu komplexen Mustern und Bildern verwoben sind. Jeder Versuch, Ereignisse in eine rein chronologische Reihenfolge zu bringen, ist so, als würde man die einzelnen Fäden aus dem Teppich ziehen und sie aneinanderreihen. Das wäre vielleicht einfacher, doch das Muster ginge verloren.
Die Ereignisse in diesem Buch folgen meiner Erinnerung, sofern sie mich nicht im Stich lässt. Sie wurden aus dem Mahlstrom meines Lebens in den palästinensischen Gebieten in Israel ausgesiebt und so, wie sie sich ereigneten, miteinander verwoben – nacheinander und gleichzeitig.
Um Ihnen einige Anhaltspunkte zu liefern und einen Überblick über die arabischen Namen und Begriffe zu verschaffen, habe ich im Anhang eine kurze chronologische Übersicht angefügt sowie Worterklärungen und eine Liste der beteiligten Personen.
Aus Sicherheitsgründen habe ich beim Erzählen absichtlich viele Details über sensible Operationen des israelischen Geheimdienstes Schin Beth ausgelassen. Die Informationen, die in diesem Buch enthalten sind, stellen keine Gefahr für den weltweiten Kampf gegen den Terror dar, in dem Israel eine führende Rolle spielt.
Und schließlich ist Sohn der Hamas, wie auch der Nahe Osten selbst, eine Fortsetzungsgeschichte. Deswegen möchte ich Sie einladen, sich mit meinem Blog www.sonofhamas.com auf dem Laufenden zu halten. Dort schreibe ich meine Gedanken zu wichtigen Entwicklungen in der Region auf, aber auch neue Berichte über das, was Gott mit diesem Buch und in meiner Familie tut und wohin er mich führt.
MHY
Vorwort
Frieden im Nahen Osten ist seit mehr als fünf Jahrzehnten der Heilige Gral von Diplomaten, Premierministern und Präsidenten. Jede neue Figur auf der Weltbühne meint, er oder sie könnte derjenige sein, der den arabisch-israelischen Konflikt löst. Und jeder von ihnen versagt ebenso kläglich und vollständig wie diejenigen vor ihm.
Tatsache ist, dass nur wenige Bewohner der westlichen Welt die komplexen Zusammenhänge des Nahen Ostens und seiner Bevölkerung umfassend verstehen können. Doch ich kann es – weil ich das Vorrecht einer ausgesprochen einzigartigen Perspektive habe. Ich bin ein Sohn jener Region der Welt – und jenes Konflikts. Ich bin ein Kind des Islam und der Sohn eines als Terroristen angeklagten Mannes. Und ich bin auch ein Mann, der Jesus Christus nachfolgt.
Noch bevor ich einundzwanzig Jahre alt wurde, sah und erlebte ich Dinge, die niemand je sehen und erleben sollte: bittere Armut, Machtmissbrauch, Folter und Tod. Ich habe Verhandlungen zwischen den Führern des Nahen Ostens, die weltweit für Schlagzeilen sorgen, hinter den Kulissen miterlebt. Ich genoss das Vertrauen der höchsten Führungsebene der Hamas, und ich nahm an der sogenannten Intifada teil. Ich wurde in den Tiefen von Israels meistgefürchteter Strafanstalt gefangen gehalten. Und wie Sie sehen werden, traf ich Entscheidungen, die mich in den Augen von Menschen, die ich sehr liebe, zum Verräter machten.
Meine ungewöhnliche Reise hat mich an dunkle Orte geführt und mir Zugang zu außerordentlichen Geheimnissen verschafft. Auf den Seiten dieses Buches erzähle ich endlich von einigen dieser lang gehüteten Geheimnisse. Dabei lege ich Ereignisse und Vorgänge offen, die bisher nur einer Handvoll Personen bekannt sind.
Die Enthüllung dieser Tatsachen wird wahrscheinlich Teile des Nahen Ostens erschüttern. Doch hoffe ich, dass sie viele Familien der Opfer tröstet und sie bei der Trauerarbeit unterstützt.
In Amerika, wo ich heute lebe, begegnen mir viele Fragen über den arabisch-israelischen Konflikt, doch nur wenige Antworten und noch weniger fundierte Informationen. Ich höre Fragen wie zum Beispiel:
• »Warum können die Menschen im Nahen Osten einfach nicht miteinander auskommen?«
• »Wer ist im Recht – die Israelis oder die Palästinenser?«
• »Wem gehört das Land wirklich? Warum siedeln die Palästinenser nicht einfach in andere arabische Länder über?«
• »Warum gibt Israel nicht das Land und die Grundstücke zurück, die es 1967 im Sechs-Tage-Krieg erobert hat?«
• »Warum leben so viele Palästinenser immer noch in Flüchtlingslagern? Warum haben sie nicht ihren eigenen Staat?«
• »Warum hassen die Palästinenser Israel so sehr?«
• »Wie kann Israel sich vor Selbstmordanschlägen und den vielen Raketenangriffen schützen?«
Das sind alles gute Fragen. Doch keine davon berührt den eigentlichen Streitpunkt, das zugrunde liegende Problem. Der heutige Konflikt reicht zurück bis zu der Feindseligkeit zwischen Sara und Hagar, die im ersten Buch der Bibel beschrieben wird. Um die politischen und kulturellen Realitäten zu verstehen, muss man allerdings nicht viel weiter zurückblicken als bis zu den Nachwehen des Ersten Weltkriegs.
Nach Kriegsende fielen die palästinensischen Gebiete, die jahrhundertelange Heimat der Palästinenser, unter das Mandat Großbritanniens. Und die britische Regierung hatte eine ungewöhnliche Vorstellung für die Zukunft der Region, die sie in der Balfour-Deklaration von 1917 darlegte: »Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina.«
Ermutigt von der britischen Regierung, überfluteten Hunderttausende jüdische Einwohner, hauptsächlich aus Osteuropa, die palästinensischen Gebiete. Zusammenstöße zwischen Arabern und Juden waren unvermeidlich.
Israel wurde im Jahr 1948 ein unabhängiger Staat. Die Palästinensergebiete blieben allerdings genau das, was sie waren – nicht souveränes Gebiet. Ohne Verfassung, die wenigstens ein gewisses Maß an Ordnung garantiert hätte, wurde das religiöse Gesetz zur höchsten Autorität. Und wenn jeder das Gesetz so auslegen und ausüben kann, wie er es für richtig hält, folgt daraus Chaos. Für die restliche Welt ist der Nahostkonflikt einfach ein Tauziehen um ein kleines Stück Land. Doch das eigentliche Problem ist, dass noch keiner das eigentliche Problem verstanden hat. Und demzufolge behandeln die Unterhändler von Camp David und Oslo weiterhin selbstsicher einen Herzpatienten – mit Gipsverband und Schiene.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich schreibe dieses Buch nicht, weil ich meine, ich wäre klüger oder weiser als die großen Denker unserer Zeit. Das bin ich nicht. Aber ich glaube, dass Gott mir einen einzigartigen Blickwinkel geschenkt hat, indem er mich auf mehrere Seiten eines scheinbar unlösbaren Konflikts gestellt hat. Mein Leben ist so zerstückelt wie dieser verrückte kleine Landstrich am Mittelmeer, von manchen als Israel bezeichnet, von anderen als Palästina oder als besetzte Gebiete.
Mein Ziel ist es, auf den folgenden Seiten die Darstellung einiger grundlegender Ereignisse zu korrigieren, einige Geheimnisse aufzudecken und, wenn alles gut geht, Ihnen die Hoffnung zu vermitteln, dass das Unmögliche möglich ist.
Gefangen
1996
Vorsichtig lenkte ich meinen kleinen weißen Subaru durch eine unübersichtliche Kurve. Es war auf einer jener engen Straßen, die auf die Landstraße außerhalb der Stadt Ramallah im Westjordanland führen. Ich bremste leicht ab und näherte mich langsam einem der unzähligen Kontrollpunkte, welche die Straßen von und nach Jerusalem säumen.
»Motor abstellen! Anhalten!«, rief jemand in gebrochenem Arabisch.
Ohne Vorwarnung sprangen sechs israelische Soldaten aus dem Gebüsch und versperrten mir den Weg. Jeder von ihnen trug ein Maschinengewehr, und jedes dieser Gewehre war direkt auf meinen Kopf gerichtet.
Panik stieg in mir auf. Ich hielt an und warf den Autoschlüssel durch das offene Fenster.
»Aussteigen! Aussteigen!«
Gleich darauf riss einer der Männer die Wagentür auf und warf mich auf den staubigen Boden. Ich hatte kaum Zeit, die Arme über den Kopf zu bringen, bevor die Tritte begannen. Ich versuchte zwar, mein Gesicht zu schützen, doch die schweren Stiefel der Soldaten fanden rasch andere Ziele: Rippen, Nieren, Rücken, Nacken, Schädel.
Zwei der Männer zerrten mich hoch und schleppten mich zum Kontrollpunkt, wo sie mich hinter einer Betonbarrikade auf die Knie zwangen. Die Hände wurden mir hinter dem Rücken mit Kabelbinder viel zu stramm gefesselt. Jemand verpasste mir eine Augenbinde und stieß mich in einen Jeep hinten auf den Boden. Meine Angst vermischte sich mit Wut, als ich mich fragte, wohin sie mich brachten und wie lange ich dort bleiben würde. Ich war kaum 18 Jahre alt und stand wenige Wochen vor meinen Abschlussprüfungen in der Schule. Was würde mit mir passieren?
Nach einer eher kurzen Fahrt hielt der Jeep an. Ein Soldat zog mich heraus und nahm mir die Augenbinde ab. Ich blinzelte in das helle Sonnenlicht und stellte fest, dass wir in Ofer waren. Ofer ist ein israelischer Militärstützpunkt und eine der größten und sichersten Militäranlagen im Westjordanland.
Auf dem Weg zum Hauptgebäude passierten wir mehrere Panzer unter Tarnplanen. Diese monströsen Hügel hatten mich immer fasziniert, wenn ich sie draußen gesehen hatte. Sie sahen aus wie riesige, übergroße Felsblöcke.
Im Hauptgebäude wurden wir von einem Arzt empfangen, der mich rasch einmal von Kopf bis Fuß untersuchte. Offenbar sollte er bestätigen, dass meine gesundheitliche Verfassung gut genug für ein Verhör war. Ich hatte die Musterung wohl bestanden, denn wenige Minuten später wurden mir Handschellen und Augenbinde wieder angelegt, und ich wurde zurück in den Jeep verfrachtet.
Ich versuchte meinen Körper so zu drehen, dass er in den kleinen Raum passte, der normalerweise für Beine und Füße der Wageninsassen gedacht war. Ein muskelbepackter Soldat stemmte seinen Stiefel auf meine Hüfte und drückte mir die Mündung seines M16-Sturmgewehrs auf die Brust. Der Gestank von heißen Abgasen zog sich über den Boden des Fahrzeugs und schnürte mir den Hals zu. Immer wenn ich versuchte, meine eingezwängte Stellung zu verändern, rammte mir der Soldat den Gewehrlauf tiefer in den Brustkorb.
Ohne Vorwarnung schoss ein stechender Schmerz durch meinen Körper. Jeder Muskel verkrampfte sich, bis hinunter in meine Zehen. Mir war, als würde eine Rakete in meinem Schädel explodieren. Der Schlag war vom Vordersitz aus gekommen, und mir wurde klar, dass einer der Soldaten mir wohl mit dem Gewehrkolben einen Schlag gegen den Kopf verpasst hatte. Bevor ich mich schützen konnte, schlug er wieder zu, nur dieses Mal noch härter und aufs Auge. Ich versuchte mich wegzudrehen, aber der Soldat, der mich als Fußschemel benutzte, zerrte mich hoch.
»Keine Bewegung oder ich erschieße dich!«, schnauzte er.
Aber ich konnte nicht anders. Jedes Mal, wenn sein Kamerad mich schlug, zuckte ich unwillkürlich zurück.
Unter der rauen Augenbinde begann mein Auge zuzuschwellen, und mein Gesicht fühlte sich taub an. In meinen Beinen spürte ich keinen Blutfluss mehr. Mein Atem ging flach und stoßweise. Noch nie hatte ich solche Schmerzen gehabt. Doch schlimmer noch als die körperlichen Schmerzen war das Entsetzen, etwas Erbarmungslosem, Rohem und Unmenschlichem hilflos ausgeliefert zu sein. Meine Gedanken rasten. Ich versuchte zu verstehen, welche Motive meine Peiniger hatten. Ich verstand, dass man aus Hass, Wut, Rache oder sogar aus einer Notwendigkeit heraus kämpfen und töten konnte. Aber ich hatte diesen Soldaten nichts getan. Ich hatte mich nicht gewehrt. Ich hatte alles getan, was man mir gesagt hatte. Ich war keine Bedrohung für sie. Ich war gefesselt, hatte die Augen verbunden und war unbewaffnet. Was ging in diesen Leuten vor, dass sie ein solches Vergnügen daran hatten, mich zu verletzen? Selbst die niedersten Tiere töten aus einem bestimmten Grund und nicht nur aus Spaß.
Ich dachte daran, was meine Mutter wohl fühlen würde, wenn sie erfuhr, dass ich verhaftet worden war. Da mein Vater bereits in einem israelischen Gefängnis saß, war ich der Mann in der Familie. Würde ich Monate oder sogar Jahre im Gefängnis festgehalten werden wie er? Und wenn ja: Wie würde meine Mutter zurechtkommen, wenn ich auch noch weg war? Ich begann zu verstehen, wie mein Vater sich fühlte – in Sorge um seine Familie und bedrückt von dem Wissen, dass wir uns um ihn sorgten. Tränen schossen mir in die Augen, als ich mir das Gesicht meiner Mutter vorstellte.
Ich fragte mich auch, ob all die Jahre an der Oberschule jetzt umsonst waren. Wenn ich tatsächlich auf dem Weg in ein israelisches Gefängnis war, würde ich die Abschlussprüfungen nächsten Monat verpassen. Ein Sturzbach von Fragen und Schreien tobte in meinem Kopf, während mich ein Schlag nach dem anderen traf: Warum tut ihr mir das an? Was habe ich denn getan? Ich bin kein Terrorist! Ich bin noch ein halbes Kind. Warum verprügelt ihr mich so brutal?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehrmals das Bewusstsein verlor, aber jedes Mal, wenn ich wieder zu mir kam, waren die Soldaten immer noch da und schlugen auf mich ein. Ich konnte den Schlägen nicht ausweichen. Ich konnte nur schreien. Ich spürte, wie es mir sauer im Hals aufstieg. Ich würgte und übergab mich heftig.
Während es wieder dunkel um mich wurde, spürte ich eine tiefe Traurigkeit, bevor ich das Bewusstsein verlor. War es das Ende? Würde ich sterben, bevor mein Leben überhaupt richtig begonnen hatte?
Die Leiter des Glaubens
1955 bis 1977
Mein Name ist Mosab Hassan Yousef.
Ich bin der älteste Sohn von Scheich Hassan Yousef, einem der sieben Gründer der Hamas. Ich wurde im Westjordanland in einem Dorf in der Nähe von Ramallah geboren und ich gehöre zu einer der religiösesten islamischen Familien im Nahen Osten.
Meine Geschichte beginnt mit meinem Großvater, Scheich Yousef Dawud, der die oberste religiöse Autorität – der Imam – des Dorfes al-Janiya war. Das liegt in der Gegend Israels, die in der Bibel unter die Bezeichnung »Judäa und Samarien« fällt. Ich liebte meinen Großvater heiß und innig. Sein weicher, weißer Bart kitzelte an meiner Wange, wenn er mich umarmte. Ich konnte stundenlang sitzen und ihm zuhören, wenn seine melodische Stimme mit dem adhan – dem islamischen Gebetsruf – zum Gebet rief. Und dazu hatte ich reichlich Gelegenheit, da Muslime fünfmal am Tag zum Gebet gerufen werden. Den adhan und Texte aus dem Koran gut zu rezitieren, ist nicht einfach, aber bei meinem Großvater klang es immer zauberhaft.
Als ich noch ein kleiner Junge war, störten mich einige Gebetsrufer so sehr, dass ich mir am liebsten die Ohren zugestopft hätte. Aber mein Großvater war ein leidenschaftlicher Mann und mit seinem Ruf führte er die Zuhörer tief in die Bedeutung des adhan ein. Er glaubte selbst jedes Wort, das er vortrug.
Etwa vierhundert Menschen lebten damals in al-Janiya, als es unter jordanischer Herrschaft und israelischer Besatzung stand. Doch die Einwohner dieses kleinen, ländlichen Dorfes hatten nur wenig Sinn für Politik. Malerisch in den sanft geschwungenen Hügeln einige Kilometer nordwestlich von Ramallah gelegen, war al-Janiya ein sehr friedlicher und schöner Ort. Die Sonnenuntergänge dort tauchten alles in rosafarbenes und violettes Licht. Die Luft war sauber und klar, und von vielen Hügeln konnte man bis zum Mittelmeer sehen.
Jeden Morgen um vier Uhr war mein Großvater bereits auf dem Weg in die Moschee. Wenn er sein Morgengebet beendet hatte, nahm er seinen kleinen Esel und ging aufs Feld. Er bearbeitete den Boden, kümmerte sich um seine Olivenbäume und trank frisches Wasser aus der Quelle, die dem Berg entsprang. Es gab keine Luftverschmutzung, weil nur eine Person in al-Janiya ein Auto besaß.
Wenn er daheim war, empfing mein Großvater einen nicht versiegenden Besucherstrom. Er war mehr als nur der Imam – er war alles für die Menschen im Dorf. Er betete über jedem neugeborenen Baby und flüsterte den adhan ins Ohr des Kindes. Wenn jemand starb, wusch und salbte mein Großvater den Leichnam und wickelte ihn in große Tücher. Er traute Ehepaare und begrub die Toten.
Mein Vater Hassan war sein Lieblingssohn. Schon als kleiner Junge, noch bevor er dazu verpflichtet war, ging mein Vater regelmäßig mit meinem Großvater in die Moschee. Keinem seiner Brüder war der Islam auch nur annähernd so wichtig wie ihm.
An der Seite seines Vaters lernte Hassan, den adhan vorzutragen. Und wie sein Vater hatte er eine Stimme und eine Leidenschaft, welche die Menschen berührte. Mein Großvater war sehr stolz auf ihn. Als mein Vater zwölf Jahre alt war, sagte mein Großvater: »Hassan, du hast gezeigt, dass du großes Interesse an Allah und dem Islam hast. Deshalb werde ich dich nach Jerusalem schicken, um die Scharia zu studieren.« Die Scharia ist das islamische religiöse Gesetz, das alle Fragen des täglichen Lebens regelt, von den Bereichen Familie und den Reinheitsvorschriften bis hin zu Politik und Wirtschaft.
Hassan wusste nichts über Politik und Wirtschaft. Das interessierte ihn auch nicht. Er wollte einfach wie sein Vater sein. Er wollte den Koran lesen und rezitieren können, und er wollte den Menschen dienen. Doch bald sollte er herausfinden, dass sein Vater sehr viel mehr war als nur eine vertrauenswürdige religiöse Autorität und ein geliebter Diener seines Volkes.
Da Werte und Traditionen dem arabischen Volk schon immer mehr bedeutet haben als Regierungserlasse und Gerichtshöfe, wurden Männer wie mein Großvater oft zur höchsten Autorität. Besonders in Regionen, wo die weltlichen Führer schwach oder korrupt waren, war das Wort einer religiösen Autorität Gesetz.
Mein Vater wurde nicht nach Jerusalem geschickt, um einfach nur Religion zu studieren; er sollte aufs Regieren vorbereitet werden. In den nächsten Jahren lebte und studierte mein Vater also in der Jerusalemer Altstadt neben der al-Aqsa-Moschee – in der Umar-Moschee, dem berühmten Bauwerk mit der goldenen Kuppel, welche das Stadtbild von Jerusalem in den Augen der meisten Menschen der Welt bestimmt. Im Alter von 18 Jahren schloss er sein Studium ab und zog nach Ramallah, wo er sofort als Imam der Moschee in der Altstadt angestellt wurde. Voller Leidenschaft, Allah und seinem Volk zu dienen, konnte mein Vater es kaum erwarten, hier seine Arbeit zu beginnen, so wie sein Vater es in al-Janiya getan hatte.
Doch Ramallah war nicht al-Janiya. Erstere Ortschaft war eine geschäftige Stadt. Letztere ein kleines verschlafenes Dorf. Als mein Vater zum ersten Mal die Moschee betrat, war er schockiert, dass nur fünf alte Männer auf ihn warteten. Alle anderen waren anscheinend in irgendwelchen unmoralischen öffentlichen Schauspiel- und Kaffeehäusern, wo sie sich betranken und dem Glücksspiel frönten. Selbst der Mann, der für den adhan in der Nachbarmoschee zuständig war, hatte das Minarett mit einem Mikrofon ausgerüstet, damit er der islamischen Tradition entsprechen konnte, ohne sein Kartenspiel unterbrechen zu müssen.
Meinem Vater blutete das Herz beim Anblick dieser Menschen, obwohl er nicht wusste, wie er sie erreichen sollte. Selbst seine fünf alten Männer gaben zu, dass sie nur kamen, weil sie wussten, dass sie bald sterben würden und ins Paradies kommen wollten. Doch immerhin waren sie bereit zuzuhören. Also arbeitete er mit denen, die da waren. Er leitete die Männer im Gebet und lehrte sie den Koran. Schon nach kurzer Zeit liebten sie ihn, als wäre er ein Engel, den der Himmel geschickt hatte.
Außerhalb der Moschee sah es allerdings ganz anders aus. Für viele Menschen unterstrich die Liebe meines Vaters zu dem Gott des Koran nur umso deutlicher ihre eigene laxe Haltung zur Religion, und sie waren beleidigt.
»Wer ist dieses Kind, das den adhan vorträgt?«, spotteten die Leute und deuteten auf meinen durchaus noch sehr jung aussehenden Vater. »Er gehört nicht hierher. Er ist ein Unruhestifter.«
»Warum blamiert dieser junge Kerl uns? Nur alte Leute gehen in die Moschee.«
»Ich wäre lieber ein Hund, als so zu sein wie du«, schrie ihm einer ins Gesicht.
Mein Vater erduldete die Verfolgung still. Er schrie nie zurück oder verteidigte sich. Doch seine Liebe und sein Mitgefühl für die Menschen ließen ihn nie aufgeben. Und er setzte die Arbeit fort, zu der er berufen worden war: Er ermahnte die Menschen, zum Islam und zu Allah zurückzukehren.
Seine Sorgen besprach er mit meinem Großvater, der rasch erkannte, dass mein Vater noch größeren Eifer und größeres Potenzial besaß, als er ursprünglich angenommen hatte. Mein Großvater schickte ihn nach Jordanien, um den Islam noch gründlicher zu studieren. Wie Sie noch sehen werden, sollten die Menschen, die er dort kennenlernte, später den Lauf meiner Familiengeschichte und sogar die Geschichte des Nahostkonflikts beeinflussen. Doch bevor ich weitererzähle, muss ich kurz innehalten und einige wichtige Punkte der Geschichte des Islam erklären. Sie können Ihnen helfen zu verstehen, warum die zahllosen diplomatischen Lösungen bisher durchweg versagt haben und keine Hoffnung auf Frieden bieten können.
* * *
Zwischen 1517 und 1923 verbreitete sich der Islam – personifiziert durch das Osmanische Kalifat – von seinem Sitz in der heutigen Türkei über drei Kontinente. Doch nach einigen Jahrhunderten großer wirtschaftlicher und politischer Macht wurde das Osmanische Reich zentralistisch und korrupt, und sein Niedergang begann.
Unter den Osmanen waren muslimische Dörfer im ganzen Nahen Osten das Ziel von Unterdrückung und harter Besteuerung. Konstantinopel, das heutige Istanbul, war einfach zu weit weg, als dass der Kalif die Gläubigen vor Übergriffen durch Soldaten und örtliche Beamte schützen konnte. Als das 20. Jahrhundert anbrach, waren viele Muslime desillusioniert und begannen, nach einer anderen Lebensweise zu suchen. Einige schlossen sich dem Atheismus des gerade aufkommenden Kommunismus an. Andere ertränkten ihre Probleme in Alkohol, Glücksspiel und Unmoral. Diese Dinge waren zu einem großen Teil von den Abendländern eingeführt worden, die der Reichtum an Bodenschätzen und die wachsende Industrialisierung in die Region gelockt hatte.
Im ägyptischen Kairo blutete dem jungen Grundschullehrer Hassan al-Banna das Herz beim Anblick seiner Landsleute, die arm, arbeitslos und gottlos waren. Doch er gab dem Abendland die Schuld, nicht den Türken, und er glaubte, die einzige Hoffnung für sein Volk und besonders die Jugend sei die Rückkehr zu einem reinen, schlichten Islam.
Er ging in die Kaffeehäuser, kletterte auf Tische und Stühle und predigte allen von Allah. Die Betrunkenen verspotteten ihn. Die religiösen Führer forderten ihn heraus. Doch die meisten Leute liebten ihn, weil er ihnen Hoffnung gab.
Im März 1928 gründete Hassan al-Banna die Muslimbruderschaft. Das Ziel dieser neuen Organisation war es, die Gesellschaft nach islamischen Prinzipien umzubauen. Innerhalb eines Jahrzehnts gab es in jeder Provinz Ägyptens eine Gruppe der Bruderschaft. Al-Bannas Bruder gründete 1935 einen Zweig im britischen Mandatsgebiet Palästina. Und nach zwanzig Jahren zählte die Bruderschaft allein in Ägypten etwa eine halbe Million Mitglieder.
Die Muslimbruderschaft rekrutierte ihre Mitglieder hauptsächlich aus den ärmsten Schichten mit dem geringsten Einfluss – doch diese waren der Sache mit glühender Treue ergeben. Sie spendeten aus eigener Tasche, um ihren muslimischen Brüdern zu helfen, wie der Koran es fordert.
Viele Menschen in der westlichen Welt, die alle Muslime als Terroristen betrachten, wissen nichts über die Seite des Islam, die Liebe und Barmherzigkeit verkörpert und für die Armen, die Witwen und Waisen sorgt. Der Islam unterstützt Bildung und Wohlfahrt. Er vereint und stärkt. Diese Seite des Islam motivierte die ersten Anführer der Muslimbruderschaft. Natürlich gibt es auch die andere Seite. Die Seite, die alle Muslime zum Dschihad aufruft. Zum Kampf gegen die ganze Welt. Zum Kampf für ein globales Kalifat, das von einem Mann geleitet wird, der an der Stelle Allahs regiert und spricht. Es ist wichtig, dass Sie diese beiden Seiten verstehen und beim Lesen immer wieder daran denken. Doch zurück zu unserer Geschichtsstunde …
Im Jahr 1948 versuchte die Muslimbruderschaft einen Staatsstreich gegen die ägyptische Regierung, die aus Sicht der Bruderschaft für den zunehmenden Säkularismus des Landes verantwortlich war. Allerdings scheiterte der Aufstand, bevor er an Boden gewinnen konnte, als das britische Mandat erlosch und Israel seine Unabhängigkeit als jüdischer Staat ausrief.
Muslime im gesamten Nahen Osten waren außer sich. Wenn ein Feind in ein muslimisches Land einmarschiert, sind dem Koran nach alle Muslime zur Verteidigung dieses Landes aufgerufen. Vom Standpunkt der arabischen Welt aus waren Ausländer einmarschiert und besetzten jetzt Palästina, die Heimat der al-Aqsa-Moschee, des drittgrößten islamischen Heiligtums nach Mekka und Medina. Die Moschee war an der Stelle erbaut worden, an welcher der Überlieferung zufolge Mohammed mit dem Engel Gabriel in den Himmel aufgestiegen und mit Abraham, Mose und Jesus gesprochen hatte.
Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien und Irak marschierten sofort in den neu gegründeten jüdischen Staat ein. Unter den zehntausend ägyptischen Soldaten waren Tausende Freiwillige aus der Muslimbruderschaft. Die arabische Koalition war nach meinem Kenntnisstand allerdings zahlenmäßig und an Waffen unterlegen. Weniger als ein Jahr später waren die arabischen Truppen aus Israel vertrieben.
Infolge des Krieges floh eine dreiviertel Million palästinensischer Araber oder wurde aus ihrer Heimat vertrieben, in der jetzt der Staat Israel entstand.
Die Vereinten Nationen verabschiedeten die Resolution 194. In dieser Stellungnahme hieß es unter anderem, dass »denjenigen Flüchtlingen, die zu ihren Wohnstätten zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies … gestattet werden soll« und dass »für das Eigentum derjenigen, die sich entscheiden, nicht zurückzukehren, … Entschädigung gezahlt werden soll«.
Doch diese Empfehlung wurde nie umgesetzt. Zehntausende Palästinenser, die im ersten Arabisch-Israelischen Krieg aus Israel geflohen waren, bekamen ihre Häuser und ihr Land nicht wieder zurück. Viele dieser Flüchtlinge und ihre Nachkommen leben in verkommenen Flüchtlingslagern, die bis heute von den Vereinten Nationen betrieben werden.
Als die nunmehr bewaffneten Mitglieder der Muslimbruderschaft aus diesem Krieg nach Ägypten zurückkehrten, wurden die Pläne des vereitelten Staatsstreichs wieder aufgegriffen. Doch Informationen über die Umsturzpläne drangen nach außen. Daraufhin verbot die ägyptische Regierung die Bruderschaft, konfiszierte ihr Vermögen und verhaftete viele ihrer Mitglieder. Diejenigen, die fliehen konnten, ermordeten einige Wochen später den ägyptischen Premierminister.
Im Gegenzug wurde am 12. Februar 1949 Hassan al-Banna ermordet – vermutlich vom staatlichen Geheimdienst. Doch die Bruderschaft bestand ungebrochen. Innerhalb von nur 20 Jahren hatte Hassan al-Banna den Islam aus seinem Dämmerschlaf wachgerüttelt und eine Revolution mit bewaffneten Kämpfern begonnen. In den nächsten Jahren vergrößerte sich die Organisation und stärkte ihren Einfluss – nicht nur in Ägypten, sondern auch im nahe gelegenen Syrien und in Jordanien.
Als mein Vater Mitte der 1970er-Jahre in Jordanien eintraf, um sein Studium fortzusetzen, war die Muslimbruderschaft bereits fest etabliert und bei der Bevölkerung beliebt. Ihre Mitglieder setzten sich für die Ziele ein, die meinem Vater auf dem Herzen lagen – sie weckten neuen Glauben bei denen, die von der islamischen Lebensweise abgeirrt waren; sie heilten diejenigen, die verletzt waren; und sie versuchten, sie vor den zerstörerischen Einflüssen der Gesellschaft zu schützen. Er hielt diese Männer für religiöse Reformatoren des Islam, so wie es Martin Luther und Philipp Melanchthon für das Christentum gewesen waren. Sie wollten nur Menschen retten und ihnen zu einem besseren Leben verhelfen – nicht töten und zerstören. Und als mein Vater einige der ersten Anführer der Bruderschaft kennenlernte, sagte er: »Ja, das ist es, wonach ich gesucht habe.«
Was mein Vater in den ersten Anführern der Muslimbruderschaft sah, war die Seite des Islam, die Liebe und Barmherzigkeit verkörpert. Was er nicht sah, und was er sich vielleicht bis heute nicht zu sehen gestattete, ist die andere Seite des Islam.
Das islamische Leben ist wie eine Leiter. Gebet und die Verehrung Allahs bilden die unterste Sprosse. Die höheren Stufen sind Hilfeleistungen für die Armen und Bedürftigen, das Gründen von Schulen und Unterstützung für wohltätige Werke. Die oberste Sprosse ist der Dschihad.
Die Leiter ist hoch. Nur wenige schauen nach oben und sehen, was an der Spitze ist. Und der Aufstieg erfolgt meistens schrittweise, beinahe unmerklich – wie bei einer Katze, die einer Schwalbe nachstellt. Die Schwalbe wendet den Blick nie von der Katze ab. Sie sitzt einfach da und beobachtet die Katze, die hin und her läuft, hin und her. Doch die Schwalbe kann die Entfernung nicht einschätzen. Sie sieht nicht, dass die Katze mit jedem Hin- und Herlaufen etwas näher kommt, bis an den Krallen der Katze plötzlich das Blut der Schwalbe klebt.
Traditionelle Muslime stehen am Fuß der Leiter. Sie leben ständig mit Schuldgefühlen, weil sie den Islam nicht richtig praktizieren. Ganz oben stehen die Fundamentalisten, die wir in den Nachrichten sehen und die Frauen und Kinder zur Ehre Allahs töten. Die Gemäßigten stehen dazwischen. Die meisten Selbstmordattentäter waren anfangs gemäßigte Muslime.
An dem Tag, als mein Vater den Fuß auf die unterste Leitersprosse setzte, hätte er sich nie träumen lassen, wie weit er sich am Ende von seinen ursprünglichen Idealen entfernen würde. Und fünfundzwanzig Jahre später hätte ich ihn gern gefragt: Weißt du noch, wo du angefangen hast? Du hast all diese verlorenen Menschen gesehen, und es brach dir das Herz. Du wolltest, dass sie zu Allah kommen und dass es ihnen gut geht. Und jetzt Selbstmordattentäter und unschuldiges Blut? Hattest du das vor? Doch in unserer Kultur spricht man mit seinem Vater nicht über solche Dinge. Und so ging er weiter diesen gefährlichen Weg.
Die Muslimbruderschaft
1977 bis 1987
Als mein Vater nach seinem Studium in Jordanien in die besetzten Gebiete zurückkehrte, war er voller Optimismus und Hoffnung für alle Muslime. Vor seinem inneren Auge sah er eine helle Zukunft, die durch eine gemäßigt auftretende Muslimbruderschaft entstehen würde.
Begleitet wurde er von Ibrahim Abu l-Salem, einem der Gründer der Muslimbruderschaft in Jordanien. Abu l-Salem war gekommen, um mitzuhelfen, der Bruderschaft in Palästina, bei der es nicht vorwärtsging, neues Leben einzuhauchen. Er und mein Vater arbeiteten gut zusammen. Sie rekrutierten junge Leute, die die gleiche Leidenschaft hatten, und bauten mit ihnen kleine Aktivistengruppen auf.
Im Jahr 1977, mit nur 50 Dinaren in der Tasche, heiratete Hassan die Schwester von Ibrahim Abu l-Salem, Sabha Abu l-Salem. Im Jahr darauf wurde ich geboren.
Als ich sieben Jahre alt war, zog unsere Familie nach al-Bira, der Nachbarstadt von Ramallah. Mein Vater wurde Imam im al-Amari-Flüchtlingslager, das innerhalb der Stadtgrenzen von al-Bira lag. Damals gab es im Westjordanland neunzehn Lager. Al-Amari war 1949 auf etwa neun Hektar Land errichtet worden. Bis 1957 hatte man seine verwitterten Zelte durch dicht beieinanderliegende Betonhäuser ersetzt. Die Straßen waren gerade breit genug für ein Auto, und in den Abflussrinnen floss das ungeklärte Abwasser wie ein schlammiger Fluss. Das Lager war überfüllt, das Wasser ungenießbar. Der einzige Baum stand in der Mitte des Lagers. Die Flüchtlinge waren in jeder Hinsicht von den Vereinten Nationen abhängig: für ihre Unterkunft, Lebensmittel, Kleidung, medizinische Versorgung und Bildung.
Als mein Vater zum ersten Mal in die Moschee kam, war er enttäuscht nur zwei Reihen von Betern vorzufinden, zwanzig Männer in jeder Reihe. Einige Monate nachdem er begonnen hatte im Lager zu predigen, konnte die Moschee allerdings die vielen Menschen nicht mehr fassen, sodass sie bis hinaus auf die Straße standen. Neben seiner Hingabe an Allah besaß mein Vater auch eine große Liebe zu der Gemeinschaft aller Muslime und viel Mitgefühl. Und auch sie liebten ihn immer mehr.
Hassan Yousef war so sympathisch, weil er wie alle anderen war. Er hielt sich nicht für besser als diejenigen, denen er diente. Er lebte so wie sie, aß das Gleiche wie sie, betete wie sie. Er trug keine schicke Kleidung. Er bezog ein kleines Gehalt von der jordanischen Regierung (kaum genug, um seine Auslagen zu decken), die den Betrieb und die Instandhaltung der islamischen Einrichtungen unterstützte. Montag war sein freier Tag, doch er nahm ihn nie. Er arbeitete nicht für Geld; er arbeitete, um Allah zu gefallen. Für ihn war das seine heilige Pflicht, der Sinn seines Lebens.
Im September 1987 nahm mein Vater eine zweite Stelle als Religionslehrer an, und zwar an einer christlichen Privatschule im Westjordanland. Natürlich bedeutete das, dass wir ihn noch seltener sahen als zuvor – nicht, weil er seine Familie nicht liebte, sondern weil er Allah mehr liebte. Wir wussten allerdings nicht, dass auf uns eine Zeit zukam, in der wir ihn so gut wie nie sehen würden.
Während mein Vater arbeitete, lag auf den Schultern meiner Mutter die Aufgabe, uns Kinder allein großzuziehen. Sie lehrte uns, gute Muslime zu sein; weckte uns bei Tagesanbruch zum Morgengebet, als wir alt genug dafür waren; und ermunterte uns, im heiligen Monat Ramadan zu fasten. Wir waren jetzt sechs Kinder – meine Brüder Suhayb, Saif und Uwais, meine Schwestern Sabila und Tasnim und ich. Selbst mit dem doppelten Gehalt meines Vaters von zwei Arbeitsstellen hatten wir kaum genug Geld, um die Rechnungen zu bezahlen. Meine Mutter bemühte sich sehr, jeden Dinar bis aufs Äußerste zu strecken.
Sabila und Tasnim fingen an, meiner Mutter bei der Hausarbeit zu helfen, als sie noch sehr klein waren. Meine süßen, unschuldigen, hübschen Schwestern beschwerten sich nie, dass ihr Spielzeug verstaubte, weil sie keine Zeit hatten, damit zu spielen. Stattdessen wurden die Küchengeräte ihr neues Spielzeug.
»Du machst zu viel, Sabila«, sagte meine Mutter zur älteren meiner Schwestern. »Du musst auch mal eine Pause machen.« Doch Sabila lächelte nur und arbeitete weiter.
Mein Bruder Suhayb und ich lernten sehr früh, wie man ein Feuer macht und den Ofen benutzt. Wir erledigten ebenfalls unseren Anteil beim Kochen und Abwaschen, und wir alle passten auf Uwais, das Baby, auf.
Unser Lieblingsspiel hieß »Sternchen«. Jeden Abend vor dem Schlafengehen schrieb meine Mutter unsere Namen auf ein Blatt Papier und wir setzten uns im Kreis um sie, damit sie uns »Sternchen« für das geben konnte, was wir an dem Tag erledigt hatten. Am Ende des Monats war derjenige der Gewinner, der die meisten Sternchen hatte – meistens war das Sabila. Natürlich hatten wir kein Geld für richtige Preise, aber das war egal. Bei den »Sternchen« ging es mehr als alles andere darum, die Dankbarkeit und Anerkennung unserer Mutter zu verdienen, und wir warteten immer ungeduldig auf unseren kleinen Augenblick der Herrlichkeit.
Die Ali-Moschee lag nur einen knappen Kilometer von unserem Haus entfernt, und ich war sehr stolz darauf, dass ich allein dorthin laufen konnte. Ich wollte unbedingt so sein wie mein Vater, ebenso wie er sich gewünscht hatte, so zu sein wie sein Vater.
Der Ali-Moschee gegenüber lag einer der größten Friedhöfe, die ich bisher gesehen hatte. Da er für Ramallah, al-Bira und die Flüchtlingslager als Gräberfeld diente, war der Friedhof fünfmal so groß wie unsere ganze Nachbarschaft und von einer einen halben Meter hohen Mauer umgeben. Fünfmal am Tag, wenn der adhan uns zum Gebet rief, ging ich an Tausenden Gräbern vorbei zur Moschee – und danach wieder zurück. Für einen Jungen meines Alters war dieser Ort unglaublich unheimlich, besonders abends, wenn es ganz dunkel war. Ich konnte mich der Vorstellung nicht erwehren, dass die Wurzeln der großen Bäume ihre Nahrung aus den begrabenen Leichnamen zogen.
Einmal, als der Imam uns zum Mittagsgebet rief, reinigte ich mich, trug ein wenig Parfüm auf und zog meine gute Kleidung an, so wie mein Vater es immer tat. Dann machte ich mich auf zur Moschee. Es war ein schöner Tag. Als ich mich der Moschee näherte, bemerkte ich, dass mehr Autos als üblich davor parkten und eine Menschentraube in der Nähe des Eingangs stand. Ich zog meine Schuhe aus wie immer und ging hinein. Gleich neben der Tür lag ein Leichnam, in ein weißes Baumwolltuch gewickelt, in einem offenen Sarg. Ich hatte noch nie einen Leichnam gesehen, und obwohl ich wusste, dass ich nicht hinstarren sollte, konnte ich den Blick nicht abwenden. Er war in ein Leichentuch gewickelt und nur sein Gesicht war zu sehen. Ich beobachtete seinen Brustkorb intensiv und erwartete beinah, dass er wieder zu atmen anfing.
Der Imam rief uns auf, zum Gebet zu kommen, und ich ging mit allen anderen nach vorn, obwohl ich immer wieder einen Blick nach hinten auf den Leichnam im Sarg warf. Als wir unsere Gebete rezitiert hatten, rief der Imam, man solle den Leichnam nach vorne tragen, um über ihm zu beten. Acht Männer hoben den Sarg auf ihre Schultern, und ein Mann rief: »La ilaha illallah!« (Es gibt keinen Gott außer Allah!) Wie aufs Stichwort fingen auch alle anderen an zu rufen: »La ilaha illallah! La ilaha illallah!«
Ich zog meine Schuhe so schnell wie möglich wieder an und folgte der Menge, die sich auf den Friedhof zubewegte. Weil ich so klein war, musste ich zwischen den Beinen der älteren Männer hindurchlaufen, nur um Schritt halten zu können. Ich war noch nie auf dem Friedhof selbst gewesen, aber ich dachte mir, dass ich wohl sicher wäre, weil ich mit so vielen anderen Leuten unterwegs war.
»Nicht auf die Gräber treten«, rief jemand. »Das ist verboten!«
Ich bahnte mir vorsichtig einen Weg durch die Menge, bis wir am Rand eines tiefen, offenen Grabes ankamen. Ich spähte auf den Grund des zweieinhalb Meter tiefen Lochs, wo ein alter Mann stand. Ich hatte gehört, wie einige Kinder in der Nachbarschaft sich über diesen Mann unterhielten. Er hieß Juma’a. Sie sagten, er käme nie in die Moschee und glaubte nicht an Allah, doch er begrub alle Toten, manchmal zwei oder drei pro Tag.
Hat er denn gar keine Angst vor dem Tod?, fragte ich mich.
Die Männer ließen den Leichnam hinunter in Juma’as starke Arme. Dann reichten sie ihm eine Flasche Parfüm und Grünzeug, das frisch und gut roch. Er öffnete das Leichentuch und goss die Flüssigkeit über den Leichnam.
Juma’a drehte den Toten auf die rechte Seite in Richtung Mekka und baute einen kleinen Rahmen mit Betonstücken um ihn auf. Während vier Männer mit Schaufeln das Loch mit Erde füllten, begann der Imam zu predigen. Er fing an wie mein Vater.
»Dieser Mann ist tot«, sagte er, während die Erde auf Gesicht, Hals und Arme des toten Mannes fiel. »Er hat alles zurückgelassen – sein Geld, sein Haus, seine Söhne, seine Töchter, seine Frau. Das ist unser aller Schicksal.«
Er drängte uns, Buße zu tun und aufzuhören zu sündigen. Und dann sagte er etwas, das ich von meinem Vater nie gehört hatte. »Die Seele dieses Mannes wird bald zu ihm zurückkehren und zwei schreckliche Engel namens Munkar und Nakir werden aus dem Himmel kommen, um ihn zu befragen. Sie werden seinen Körper nehmen, ihn schütteln und fragen: ›Wer ist dein Gott?‹ Wenn er falsch antwortet, werden sie ihn mit einem großen Hammer schlagen und ihn siebzig Jahre tief in die Erde schicken. – Allah, wir bitten dich, gib uns die richtigen Antworten, wenn unsere Zeit kommt!«
Entsetzt starrte ich in das offene Grab. Der Leichnam war inzwischen fast vollständig mit Erde bedeckt, und ich fragte mich, wie lange es wohl dauern würde, bis die Fragen begannen.
»Und wenn seine Antworten nicht zufriedenstellend sind, wird das Gewicht der Erde über ihm seine Rippen zerdrücken. Würmer werden sein Fleisch langsam auffressen. Er wird von einer Schlange mit 99 Köpfen und einem Skorpion so groß wie ein Kamelhals gequält, bis zur Auferstehung der Toten, wenn sein Leiden Allahs Vergebung verdienen möge.«
Ich konnte kaum glauben, dass all dies jedes Mal, wenn jemand begraben wurde, in unmittelbarer Nähe unseres Hauses vor sich ging. Der Friedhof war mir schon immer unheimlich gewesen, aber jetzt hatte ich ein noch schlechteres Gefühl. Ich beschloss, diese Fragen auswendig zu lernen, sodass ich die richtigen Antworten geben konnte, wenn die Engel mich nach meinem Tod befragten.
Der Imam sagte, die Prüfung werde beginnen, sobald der Letzte den Friedhof verlassen habe. Ich ging nach Hause, doch ich konnte nicht aufhören, über das nachzudenken, was er gesagt hatte. Ich beschloss, zum Friedhof zurückzukehren und der schmerzhaften Bestrafung des Toten zuzuhören. Ich ging durch die Nachbarschaft und versuchte, meine Freunde zu überreden, mit mir zu kommen. Doch sie hielten mich alle für verrückt. Ich würde allein gehen müssen. Auf dem ganzen Rückweg zum Friedhof zitterte ich vor Angst. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Bald fand ich mich inmitten eines Meeres von Gräbern wieder. Ich wollte weglaufen, doch meine Neugier war stärker als meine Furcht. Ich wollte Fragen hören, Schreie – irgendwas. Doch ich hörte nichts. Ich trat näher, bis ich einen Grabstein berührte. Nur Stille. Eine Stunde später wurde mir langweilig und ich ging heim.
Meine Mutter war in der Küche beschäftigt. Ich erzählte ihr, dass ich auf dem Friedhof gewesen war, wo laut den Worten des Imam eine schmerzhafte Bestrafung stattfinden sollte.
»Und …?«
»… und ich ging zurück, nachdem die Leute den Toten verlassen hatten, aber nichts geschah.«
»Nur Tiere können diese Bestrafung hören«, erklärte sie, »Menschen nicht.« Für einen achtjährigen Jungen wie mich war diese Erklärung absolut schlüssig.
Danach schaute ich jeden Tag zu, wie immer mehr Leichname auf den Friedhof gebracht wurden. Nach einer Weile gewöhnte ich mich tatsächlich daran und fing an, dort herumzulungern, nur um zu sehen, wer gestorben war. Gestern eine Frau. Heute ein Mann. An einem Tag brachten sie zwei Leute und dann, einige Stunden später, noch jemanden. Wenn niemand Neues kam, ging ich zwischen den Gräbern umher und las, was über die bereits hier begrabenen Leute auf den Grabsteinen stand. Hundert Jahre tot. Fünfundzwanzig Jahre tot. Wie hieß er? Woher kam sie? Der Friedhof wurde zu meinem Spielplatz.
So wie ich hatten auch meine Freunde zuerst Angst vor dem Friedhof. Doch wir forderten einander heraus, auch nachts hinzugehen, und da keiner von uns als Feigling gelten wollte, überwanden schließlich alle ihre Angst. Wir spielten sogar Fußball auf den freien Flächen.
* * *
Unsere Familie wuchs, und die Muslimbruderschaft auch. Es dauerte nicht lange, bis sie nicht mehr nur eine Organisation der Armen und Flüchtlinge war. Jetzt gehörten auch gebildete junge Männer und Frauen dazu, Geschäftsleute und Fachleute, die aus eigener Tasche für Schulen, wohltätige Projekte und Krankenhäuser spendeten.
Angesichts dieses Wachstums waren viele junge Leute in der islamischen Bewegung, besonders aus dem Gazastreifen, der Meinung, dass die Bruderschaft sich gegen die israelische Besatzung zur Wehr setzen sollte. Wir haben uns um die Gesellschaft gekümmert, sagten sie, und das werden wir auch weiterhin tun. Aber sollen wir wirklich die Besatzung für immer akzeptieren? Gebot der Koran uns nicht, die jüdischen Invasoren zu vertreiben? Diese jungen Männer waren unbewaffnet, aber sie waren zäh und hart und brannten auf einen Kampf.
Mein Vater und die anderen führenden Köpfe im Westjordanland teilten diese Meinung nicht. Sie waren nicht bereit, die Fehler von Ägypten und Syrien zu wiederholen, wo die Bruderschaft Staatsstreiche geplant hatte und gescheitert war. In Jordanien, so ihre Argumentation, kämpfen unsere Brüder nicht. Sie nehmen an Wahlen teil und haben großen Einfluss auf die Gesellschaft. Mein Vater war nicht prinzipiell gegen Gewalt, doch war er der Meinung, dass seine Leute nicht in der Lage waren, gegen das israelische Militär anzukommen.