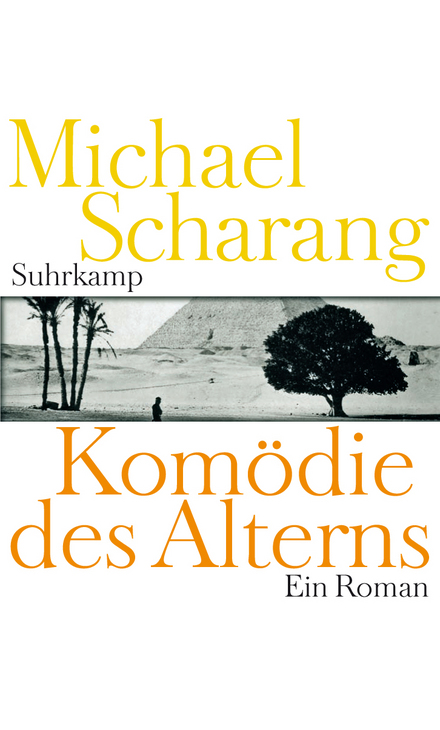
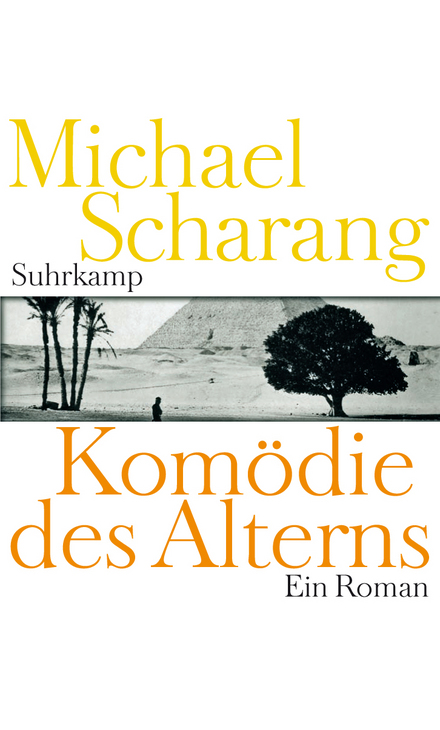
Komödie des Alterns
Ein Roman
Suhrkamp Verlag
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
Erste Auflage 2010
© Suhrkamp Verlag Berlin 2010
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
eISBN 978-3-518-73980-8
Zur Erinnerung
an den Zeichner und Maler
Andreas Scharang
(1963-2003)
Es waren zwei Männer, ein Ägypter und ein Österreicher, die verband von Jugend an eine tiefe Freundschaft. Daß ihre Wege sich trennten, so zufällig wie sie sich gekreuzt hatten, blieb ohne Einfluß auf ihre Freundschaft. Selbst wenn das Meer zwischen ihnen lag, gewöhnlich das Mittelmeer, manchmal der Atlantik, hatten sie doch das Empfinden, miteinander verbunden zu sein, spürbar, wie damals in der Jugend, als sie Felswände durchkletterten, der bergkundige Alpenbewohner am oberen, der sternenkundige Wüstenbewohner am unteren Ende des Seils.
Sofern kein Gewitter aufzog – im Sommer fuhren Blitze nieder mit einer Angriffslust, daß man sich, die beiden waren einmal in ein Unwetter geraten, freiwillig hinwarf und das Gesicht ins Geröll drückte – und sofern im Winter der Fels nicht mit Eis überzogen war, unternahmen die beiden jeden Sonntag eine Klettertour auf den Hochschwab, ein Kalkmassiv inmitten der Steiermark, nur zweitausend Meter hoch, aber überreich an zerklüfteten Felstürmen und lotrechten Wänden.
Zu dem Empfinden der beiden, entfernt voneinander zu sein und doch Seite an Seite zu leben, gesellte sich die Gewißheit, daß sie, indem sie einander schrieben, in stetem Austausch standen. Briefe zu schreiben bedeutete für sie nicht, das Sprechen zu ersetzen, denn sie schrieben nicht im Plauderton, sondern wohlüberlegt, und suchten für die Sache, um die es ging, den schönsten Ausdruck, der Sache wegen, aber auch aus Lust am Klang der Wörter, den sie, wenn einmal ein Satz gelungen war, in ihrem Überschwang für die Sache hielten.
Das erforderte Zeit. Einen Brief zu schreiben hieß, sich einen Tag freizuhalten. Und da keine Woche verging, ohne daß sie einander schrieben, verwandten sie in einem Monat vier, manchmal fünf ganze Tage auf nichts anderes als auf ihre Korrespondenz. Entsprechend knapp faßten sie sich im Umgang mit der übrigen Welt.
Hunderte Briefe, sorgsam gesammelt, gern wiedergelesen, waren es im Lauf der Jahrzehnte geworden, der Abstand von Brief zu Brief wurde nicht länger, die Briefe nicht kürzer. In ihnen offenbarten die zwei Männer Gefühle, die sonst im Verborgenen geblieben und dort erstickt wären, weil ihnen die Lebensluft gefehlt hätte, und sie vertrauten einander Gedanken an, vor deren Kühnheit sie, mit sich allein, zurückgeschreckt wären, Gedanken, die, wie die beiden sich ausdrückten, mit dem Kopf durch die Wand, nicht an ihr zerschellen sollten. Und dann, im Alter, dieser Haß. Sinnesverwirrt und kraftlos traten sie gegeneinander an, zwei brüchige Windmühlen, die sich für Ritter hielten, bereit zum tödlichen Hieb gegen den Halunken, der, so wüst dachten sie voneinander, diese schöne Freundschaft gemein verraten hatte. Für beide gab es nur einen Schuldigen: den anderen. Sie konnten, zerfressen von Haß, das Glas nicht mehr halten, verschütteten den Wein, mit dem sie sich Mut hätten antrinken wollen, Mut, um das Maul aufzureißen, damit der Fluch herauskann und sich im Feind verkrallt.
Gegen diesen Wahn, in dem sie sich suhlten wie in einer Jauche, von deren Gestank sie nicht genug bekamen, gab es nur eine einzige Barriere, eine unscheinbare und doch haltbare Schranke, nämlich, daß es nicht in der Natur der beiden Männer lag, sich in Haß zu verzehren.
Sie waren dem Ausbruch dieser Pest nicht gewachsen, einer Gefühlspest, die auch den Körper, die beiden waren um die sechzig, an allen Ecken und Enden in Mitleidenschaft zog, als Kopf-, als Gelenks-, als Rückenschmerzen, in einem Ausmaß, daß das Herz, damit das Leben nicht stehenblieb, schneller und schneller schlagen mußte.
Das Herz befand sich im Wettlauf mit dem Tod. Der klopfte mit der Knochenhand einen aberwitzigen Takt, um es anzutreiben, bis es erschöpft aufgeben würde. An eine Ruhepause war in diesem Kampf nicht zu denken, schon gar nicht an einen heilsamen Schlaf, der doch für die beiden Männer, schon um zur Besinnung zu kommen, so wichtig gewesen wäre.
Sie hätten es als himmlisch empfunden, einmal, ein einziges Mal in diesen höllischen August- und Septemberwochen des Jahres 2001 in einen Schlaf zu fallen, der länger währte als zwei Stunden. Aber auch dieser Kurzschlaf war nur eine Art Ohnmacht, randvoll noch dazu mit Albträumen. Erwachten sie daraus, war es ein Aufschrecken, das den Körper von der Matratze katapultierte und ihn neben das Bett auf den Fußboden warf. Als sie später darüber sprachen, konnten sie es nicht fassen, daß jedem das gleiche widerfahren war: von einem Albtraum aus dem Schlaf gerissen zu werden und, wach geworden, neben dem Bett sich wiederzufinden. Danach aber waren sie erst recht mit einem Albtraum konfrontiert, dem schrecklichsten: der Wirklichkeit ihrer, wie sie meinten, für immer zerbrochenen Freundschaft.
Der Österreicher, er hieß Heinrich Freudensprung, wußte nicht, in welchem Zustand der Freund sich befand, sprach vom Ende seines Lebens, halblaut sprach er in sich hinein, daß er diese Pein keinen Tag länger ertrage. Der Ägypter mit Namen Zacharias Sarani, der seinerseits nicht ahnte, wie es dem Freund erging, fühlte sich sterbenselend. So könne er nicht leben. Der September war noch nicht zu Ende – der Monat, in welchem unweit des Hauses, in dem der Österreicher wohnte, im südlichen Teil Manhattans, die beiden höchsten Gebäude New Yorks nach Anschlägen zusammenstürzten; die Nachricht darüber kam ihm zwar zu Ohren, sein Verstand, vom eigenen Unglück zerrüttet, vermochte sie jedoch nicht aufzunehmen –, der September war noch nicht zu Ende, als die beiden Freunde, gegen ihre Absicht, wie jeder betonte, doch wieder miteinander sprachen, wenn auch nur am Telefon.
Freudensprung war es, der sich überwand und aus New York anrief. Er hatte sich ein paar Sätze zurechtgelegt: daß man einander lange nicht gesehen, daß das Leben ihm übel mitgespielt habe. Sarani sagte nur: Nimm die nächste Maschine. Freudensprung antwortete: Die nächste Maschine nach Kairo fliegt morgen. Der andere sagte: Ich hole dich ab. Und legte auf.
Was für ein Tag! rief Sarani. Er saß im Schatten eines Baums, schaute hinaus in das Sonnenlicht und sagte zu sich, daß es auf der Welt nichts Schöneres gebe, als sich im Schatten an der Sonne zu erfreuen, noch dazu im Herbst, wenn die Sommerhitze vorüber sei.
Nach einem langen Seufzer fuhr er fort: Das Leben ist schön gewesen. Auch wenn es in den nächsten Tagen zu Ende geht. Auch wenn mein Lebenswerk zerstört ist. Und um es neu aufzubauen, bin ich zu alt.
Was für ein Tag, flüsterte er. Zacharias Sarani war froh, daß unter diesem Baum eine Bank stand, und er genoß es, hier zu sitzen, an der kilometerlangen, kerzengeraden Prachtstraße zwischen Kairos Stadtzentrum und dem Flughafen. Auf einem breiten Streifen aus Erde und Sand reihte sich Baum an Baum, meist waren es Palmen, doch hie und da machte sich ein Laubbaum breit.
Stünde die Bank nicht hier, dachte er, hätte ich mich auf den Boden setzen müssen, denn weiter hätten die Beine mich nicht getragen. Das Auto hatte er am Straßenrand abgestellt, er wollte über den Streifen aus Erde und Sand gehen und dann weiter über die Nebenfahrbahn zur Autohandlung, wo er ein Geländefahrzeug bestellt hatte, nicht zum Kauf, sondern zur Miete, und nur für eine Woche. Danach würde er es nicht mehr brauchen.
Sarani stellte sich vor, unter dem Baum auf dem Boden zu sitzen. Unvorstellbar, sagte er zu sich, mit verschmutztem Anzug zum Autohändler und dann zum Flughafen und dort verdreckt in der Ankunftshalle sitzen. Das wäre ihm sonst egal gewesen, nicht aber an diesem Tag.
Er war früher als gewohnt aufgestanden und hatte unter den Anzügen jenen ausgewählt, den er am liebsten trug, einen aus leichtem, hellgrauem Flanell, einen Zweireiher. Ein Blick in den Spiegel gab ihm recht: In diesem Anzug wirkte er, der kleine, hagere Mann, besonders stattlich. Er band die rote Krawatte um, hielt inne und sah, wie das dunkelgraue, gewellte Haar sich vorteilhaft von dem hellgrauen Stoff abhob.
Er wußte, wie und wann er sterben würde, darüber brauchte er sich keine Gedanken zu machen. Er wußte aber nicht, wie er bis dahin leben sollte. Würde er Sophie tatsächlich nicht mehr sehen? Er hatte ihr – sie schlief noch – einen Brief hinterlegt, voll mit Lügen, wie er seit Wochen seine geistige Zerrüttung und seinen körperlichen Zusammenbruch mit Ausflüchten vor ihr zu verbergen suchte. Er sei nicht mehr der Jüngste, war sein liebstes Argument.
Seine Frau, erinnerte er sich, hatte genickt und gelächelt. Sie höre diesen Quatsch, hatte sie gesagt, seit mehr als einem Jahr, seit seinem sechzigsten Geburtstag, und sie höre ihn gern. Mindestens einmal pro Monat beteuere er, es gehe mit ihm zu Ende, seine Kraft sei aufgebraucht. Ihr, Sophie, sei diese Marotte, die er von seinem Freund Heinrich angenommen habe, welcher diese Unart seit Jahren pflege, lieb geworden, denn nach jeder Ankündigung, er fühle den Tod sich nahen, sei er ungestümer gewesen denn je. Sie hatte recht, auch mit der Bemerkung, es sei doch selbstverständlich, daß im Alter die Kraft nachlasse. Ihr, Sophie – sie war nur drei Jahre jünger als Zacharias –, ergehe es nicht anders.
In dem Brief hatte er geschrieben, er sei spätabends angerufen und zu einer Besprechung nach Alexandria gebeten worden. Fachleute aus verschiedenen Ländern seien dort, die sich mit der Möglichkeit einer Bepflanzung der Wüste beschäftigten, sie wollten mit ihm eine internationale Konferenz zu diesem Thema vorbereiten. In einigen Tagen sei er zu Hause. Er hielt diese Ausflucht für glaubwürdig, weil es weltweit niemanden gab, der mehr Erfahrung in der Bewirtschaftung des Wüstenbodens hatte als er.
Ob seine Frau ihm glaubte oder nicht, hatte ohnehin keine Bedeutung. Man würde in einigen Tagen in seinem Haus in der Wüste drei Abschiedsbriefe finden und so erfahren, daß er tot ist. Ob man ihn selbst finden würde, war ungewiß. Die Briefe an seine Frau Sophie und seine Tochter Johanna hatte er bereits geschrieben, er trug sie bei sich. Den Brief an seinen Sohn David hatte er im Kopf. Er zögerte, ihn zu Papier zu bringen, der Brief schien ihm zu kurz und zu schroff. »Ich liebe Dich trotz allem.« Er hätte im Angesicht des Todes gern ein versöhnliches Wort angefügt – aber welches?
Sarani, als Naturwissenschaftler und Techniker ein Zweifler par excellence, zweifelte nicht, daß seine Frau und seine Kinder dafür Verständnis haben würden, daß er sich mit gebrochenem, durch keine Heilkunst zu kurierendem Herzen in sein Haus in der Wüste zurückzog und dort lebte bis zu seinem Tod, der, wenn die Wüste gnädig war, ihn bald ereilen würde. Er setzte seine Hoffnung in den nächsten Sturm.
Als Kind hatte er es als Kraftprobe empfunden, gegen den Sandsturm anzugehen, als ein Experiment, wie nahe die Menschennatur der Naturgewalt kommen darf, ohne von ihr zermalmt zu werden. Es war ein Abenteuer gewesen, gewiß, doch eines, nach dem er sich sehnte, kein Unternehmen, bei dem er das Leben aufs Spiel setzte.
Im nächsten Sandsturm allerdings werde er, der Alte, umkommen, werde hinausgefegt werden aus dieser Welt – und endlich seinen beiden Brüdern und seinem Onkel nachfolgen.
Er hatte sie vor fünfzig Jahren verloren; zuerst nur aus den Augen. Der Sandsturm wurde immer dichter, die Brüder und der Onkel gerieten in Panik, rannten gegen Abermilliarden Sandkörner an, wohl in der Hoffnung, auf diese Weise, in einem Sprint, die besiedelte Oase zu erreichen. Die lag jedoch weit weg. Zwanzig Kilometer im Sandsturm waren, wenn man nicht gelernt hatte, sich darin zu bewegen, eine undurchdringliche Hölle, in der die maschinenhafte Einförmigkeit des Tosens das Schrecklichste war.
Ihn, den Jüngsten und Kleinsten, vergaßen sie in ihrer Todesangst; sie vergaßen aber auch, aufeinander zu achten. Als er sie zuletzt wahrnahm, umrißhaft, noch keine dreißig Meter entfernt, schienen sie nicht mehr die eigene Kleidung zu tragen, sondern waren umhüllt von Faltenwürfen aus Sand. Sie verschwanden so rasch, als müßten sie nicht gegen den Sturm ankämpfen, sondern als würden sie von ihm angesogen; und, für ihn der furchtbarste Eindruck: als würden sie nicht mit jedem schnellen Schritt an Kraft verlieren, sondern als eilten sie, von einer nicht bekannten Kraft angezogen, willfährig in diesen Sturm hinein.
Sie stoben in drei Richtungen auseinander, als wären sie einander feind und als wäre der Gegner nicht der Sturm, gegen den man zusammenstehen sollte. Gleich darauf versanken sie in der Wand aus Sandkörnern, die sich vor ihm auftürmte. In diesem Augenblick, daran dachte Sarani unwillig, denn die Erinnerung schmerzte ihn, war ihm klar, daß seine Brüder und sein Onkel umkommen würden.
Er selbst zwang sich, ruhig zu bleiben, trotz der Angst, die ihn angesichts der maßlosen Wucht des Sturms überkam, eines Sturms, wie er noch nie einen erlebt hatte, und trotz des Schreckens, die Brüder und den Onkel verloren zu wissen. Ihm waren Sandstürme nicht fremd, er fühlte sich von klein an zu ihnen hingezogen. Ein Sandsturm war für ihn ein Abkömmling des Himmels, Wolken, die sich auf die Erde herabsenkten, dort als Sturm dahinrollten, jedoch nicht Regen in sich bargen, sondern Sand. In solche Wolken hineinzugehen, sich dort aufzuhalten, davon hatte er als Kind geträumt: Inmitten eines Sandsturms zu sein würde einen ahnen lassen, wie es im Himmel aussehe, im irdischen, an einen überirdischen hatte er nie geglaubt.
Er hatte einen Weg gefunden, sich jenen Traum zu erfüllen. Der eine der beiden Chauffeure des Vaters, ein Nubier aus Oberägypten, der Gestalt nach ein antiker Gott, war ihm wohlgesinnt, weil Zacharias es ablehnte, sich zur Schule fahren und Stunden später von dort, von der deutschen Schule in Kairo, abholen zu lassen. In der Zeit, die der Chauffeur dadurch gewann, konnte er – ohne Erlaubnis seines Dienstherrn – mit dem noblen Auto noble Hotelgäste, denen die Rezeption ein gewöhnliches Taxi nicht zumuten wollte, zu den Pyramiden kutschieren und so gutes Geld dazuverdienen, das er dringend brauchte, denn der Dienstherr hielt ihn knapp. Der Fahrer, der das Studium der Mathematik an einer Kairoer Universität absolviert, aber keine Arbeit als Mathematiker gefunden hatte, arbeitete, wie er Zacharias erklärte, gewissermaßen doch als Mathematiker, indem er zu dem dürftigen Salär die fetten Trinkgelder der Ausländer addierte – so weit trieb er die Selbstironie.
Zacharias war klar, daß der Chauffeur unerlaubte Fahrten unternahm, und das war ihm recht. Er konnte guten Gewissens eine Gegenleistung verlangen. Der Chauffeur mußte ihn, wenn von der Kairoer Wetterstation ein Sandsturm vorhergesagt worden war, hinaus in die Wüste bringen und ihn zwei, drei Stunden später abholen. Niemand durfte davon wissen. Wäre er im Sturm umgekommen, kein Mensch hätte sagen können – der Chauffeur würde sich gehütet haben, den Mund aufzumachen –, wie er in die Wüste gelangt war.
Dort sammelte er Erfahrungen, wie andere Kinder am Wüstenrand zerbrochene Muscheln, gebleichte Tierknochen und Alabasterstücke sammelten. Die Erfahrungen erweiterte er, indem er beobachtete, wie Beduinen sich verhielten, mit welchen Tüchern sie sich auf welche Weise einhüllten, mit welcher Art Sandalen sie im Sand gingen. Eine solche Ausrüstung, die er sich für wenig Geld im Basar gekauft hatte, nahm er mit auf seine Ausflüge.
Auch an jenem verhängnisvollen Tag, einem Sonntag, trug er wie seine Brüder und sein Onkel einen feinen, luftigen englischen Leinenanzug, darunter jedoch, als wäre es das Hemd, ein Beduinentuch; ohne diesen Schutz für Augen, Ohren, Nase und Mund wäre er nicht in die Wüste gefahren. Er wußte, daß zwar Kamele, nicht aber Menschen einen Sinn dafür haben, wann der Wind – der immerfort mit dem Sand spielt und fast nie zur Ruhe kommt – sich in einen alles verfinsternden Sturm verwandelt.
Für ihn war in den Jahren, in denen er die Wüste erforschte, eines zur beruhigenden Gewißheit geworden: Der Sturm, anders als der Wind, änderte nie die Richtung. Ging er direkt gegen ihn an, und so auch wieder zurück, gelangte er nach Stunden, während denen man nichts hatte sehen können, exakt zum Ausgangspunkt zurück.
Dazu kam die Erfahrung, daß er, wenn er frontal, mit der ganzen Breite des Körpers, gegen den Sturm marschierte, sehr bald völlig erschöpft einhalten und froh sein mußte, nicht rücklings zu Boden geworfen zu werden. Ging er aber seitlich, was den Beinen die Technik abforderte, einen Fuß nicht vor, sondern über den anderen zu setzen, kam er gut voran. Dank dieses Wissens war er, der Elfjährige, der einzige aus der vierköpfigen Ausflugsgesellschaft, der überlebte.
Zacharias Sarani erinnerte sich, daß man ihn, auf der Suche nach einer Erklärung, mit Fragen überhäufte. Doch er schwieg. Man hielt ihm zugute, er müsse von den Ereignissen zermürbt sein, und stellte keine Fragen mehr. Erst Jahre später, in Österreich, dem neuen Freund gegenüber – hatte er Freund gesagt?; dieser Fehler durfte ihm nie wieder unterlaufen –, gab er die eine und andere Einzelheit preis und sprach, meist belustigt, über die Folgen jener Katastrophe. Er erzählte dem Österreicher, was damals schon die Rettungsmannschaften festgestellt hatten, daß das Auto, das der Onkel lenkte, zwanzig Kilometer vor dem Ziel defekt liegen blieb. Die Nockenwelle war gebrochen.
Wäre das sechzig Kilometer vor dem Reiseziel passiert, sie wären schicksalsergeben im Auto sitzen geblieben, hätten gewartet, bis im Lauf des Tages ein Fahrzeug vorbeikam und sie zur Oase mitnahm, von wo aus sie per Funk wieder an die Welt der Abschleppdienste und hauseigenen Chauffeure angeschlossen gewesen wären. Die läppischen zwanzig Kilometer aber glaubten sie zu Fuß zurücklegen zu können. Niemand, auch er nicht, ein Sandsturm war nicht abzusehen, hatte einen Einwand. Man fand von seinen Gefährten nicht einmal eine Spur, sie blieben verschollen. Seine Brüder waren siebzehn und achtzehn Jahre alt, der Onkel, der jüngere Bruder von Saranis Vater, stand im vierundvierzigsten Lebensjahr. Bei der Suche nach ihnen scheute der ägyptische Staat keine Mittel, auch Militär wurde eingesetzt. Zeitungen und Radio behandelten den Fall als nationales Ereignis, man konnte sich an eine ähnliche Suchaktion nicht erinnern.
Nach zwei Wochen gab man auf, und das nationale Ereignis, an dem das Land sich gelabt hatte, wandelte sich zur nationalen Katastrophe. Alle Schuld wurde den Suchmannschaften, hauptsächlich dem Militär, zugeschoben. Es wirkte auf die Stadtbewohner in der Tat lächerlich, daß drei Menschen, die in der Nähe eines defekten Autos, das man bald gefunden hatte, verschwunden waren, von Aberhunderten Soldaten nicht, auch nicht tot, gefunden wurden.
Wenn in Kairo nur zwei Menschen beieinanderstanden, wurde in den ersten Tagen, nachdem der Mißerfolg zugegeben worden war, aufgeregt und lautstark bramarbasiert über die, selbstverständlich vorauszusehende, Unfähigkeit des Militärs. In den Tagen darauf war die Rede bereits von dessen Unwillen. Hohe Offiziere hätten in dem weiträumig abgesperrten Gebiet – warum abgesperrt, fragte man sich – genau dort suchen lassen, wo die Vermißten gewiß nicht zu finden gewesen wären. Das Militär, das dem Königshaus feindselig gegenüberstehe, darin kulminierte das Meinungsgebräu, habe die drei Mitglieder der königstreuen Familie Sarani mit Absicht sterben lassen.
Man verdammte das unfähige Militär, mit Emporkömmlingen an der Spitze, welche dem König die Gunst, aufsteigen zu dürfen, damit vergalten, schon im nichtmilitärischen, im Katastropheneinsatz zu versagen – wenn nicht überhaupt illoyal zu sein. Der König wies die Kritik am Militär nicht zurück, er schien sie zu billigen, ja man hatte den Eindruck, daß er sie genoß.
Da geschah Unerhörtes. Flugzettel wurden verteilt, zuerst im Basar; Flugzettel des Inhalts, das Militär habe bei der Suchaktion nichts anderes getan, als den Befehlen ihres Oberbefehlshabers, des Königs, zu gehorchen. Offensichtlich wälzten die Offiziere die Schuld, die ihnen von der Bevölkerung aufgehalst wurde, auf den König. Das öffentlich zu tun wurde von der Bevölkerung als Hochverrat empfunden, und man erwartete die Verhaftung und Erschießung der Schuldigen. Der König aber sprach von den Offizieren als von seinen Kindern, die nach und nach erwachsen würden und entsprechend aufbegehrten.
Zacharias’ Vater hatte im Familienkreis den König als weise gelobt und bedauert, daß dessen Tage gezählt seien. Ist der König krank? wurde erschrocken gefragt. Der Vater schüttelte den Kopf, und dabei beließ er es. Dem König jedoch sagte er sehr bestimmt, wie er später seiner Frau und dem Sohn erzählte: daß jene Flugzettelaktion der Vorbote eines Militärputsches sei. Der König sah das auch so. Ob Vorkehrungen zu treffen seien, fragte der Vater. Der König schüttelte den Kopf. Er hing der Auffassung an, das gute Alte, das er repräsentiere, sei auf jeden Fall schlechter als das noch so schlechte Neue.
Einzig der Onkel hätte an diesem Gedanken Gefallen gefunden. Er war erst dreiundvierzig, als er starb, zwanzig Jahre jünger als der König, und doch dessen bester, manche sagten, einziger Freund. Der Onkel, von Kindheit an dem Klavierspiel verfallen, hatte fünf Jahre an der Wiener Musikakademie eine Meisterklasse besucht. Seine Lehrerin, die wegen ihres Sarkasmus gefürchtete Franziska Huppert, war aus Überzeugung antipädagogisch. Zur Begrüßung sagte sie jedem Schüler – Schülerinnen nahm sie nicht, sie war extrem frauenfeindlich –, er möge sich stets vergegenwärtigen, daß er eine Zumutung für die Musik sei. Gleichwohl hatte sie weltweit den Ruf, die beste Lehrerin zu sein, insbesondere für die Interpretation Schuberts.
Nach dem Klavierstudium wurde der Onkel von Konzertagenturen mit Angeboten überhäuft, doch er war an der Laufbahn eines Pianisten nicht interessiert. Er kehrte nach Kairo zurück, um wirtschaftliche Pläne zu verfolgen. Es waren vorerst vage Pläne, nichts, was eilte. Deshalb willigte er amüsiert ein, als der König ihn drängte, sein Klavierlehrer zu werden. Dem König lag an der Auffrischung seiner Kenntnisse. Die beiden spielten oft stundenlang vierhändig. Zu regieren gebe es ja nichts, antwortete er auf besorgtes Nachfragen des Pianisten, das Volk sei an Religion interessiert und lehne jeden Fortschritt ab, die Oberschicht sei an Privilegien interessiert und lehne ebenso jeden Fortschritt ab. Wenn schon alles vergeblich sei, so bleibe nur, diejenige Musik zu spielen, welche die Vergeblichkeit am vollkommensten ausdrücke, die Musik Schuberts.
Es konnte nur der Einfall des Onkels gewesen sein, einen Ausflug zu unternehmen, niemand sonst aus der großen Familie Sarani hatte jemals einen Ausflug unternommen, niemand war aus bloßem Vergnügen irgendwo hingefahren, irgendwohin in Ägypten. Ins Ausland selbstverständlich, nach Paris, wo man die Oper und die Museen besuchte, nach London, wo man sich mit Kleidung und Personenautos versorgte.
Der Onkel, erinnerte Sarani sich, war in Ägypten eine ebenso bekannte wie mißtrauisch beäugte Person. Er galt, auch innerhalb der Familie, als Hasardeur, doch das irritierte ihn nicht. Er stand unter dem Schutz seines Bruders, der ihn zu seinen Unternehmungen, die nach Meinung der meisten scheitern mußten, sogar ermunterte. Der Onkel tat wirtschaftlich das Gegenteil dessen, was in Ägypten üblich war, er kaufte ausländische Unternehmen, insbesondere Hotels mittlerer Größe, von denen er den Eindruck hatte, die Besitzer ließen sie verkommen. Die Gäste, wollten sie die Pyramiden sehen, mußten mit diesen Absteigen vorliebnehmen. Reisten sie früher ab, als sie es geplant hatten, weil das kaputte Frühstücksgeschirr und die wackeligen Betten ihnen den Aufenthalt vergällten, störte das die Besitzer nicht, kamen doch unausgesetzt neue Touristen. Der Onkel renovierte solche Betriebe, führte sie erfolgreich, wodurch ein neuer Touristen-Typus angezogen wurde, Leute, die, nachdem sie sich drei Tage mit den Altertümern beschäftigt hatten, gern noch in der Stadt blieben, höchst erstaunt, daß diese einen interessanten Kontrast zu den meist einem Totenkult verhafteten Altertümern bildete.
Den Ausländern das Geschäft wegzuschnappen, deren Privileg es seit Jahrhunderten war, die Ägypter in allem zu bevormunden, dafür erntete der Onkel von den westlichen Geschäftsleuten diplomatische Proteste, von der Kairoer Geschäftswelt Argwohn und Verwünschungen. Doch der Bruder, und darauf kam es an, stand demonstrativ zu ihm. Er war nicht nur Oberhaupt der weitverzweigten Familie Sarani, er war auch, dem Rang nach, der zweithöchste Beamte des Landes, der Bedeutung nach der wichtigste. Vor ihm rangierte nur der Zeremonienmeister des Hofes.
Der Vater konnte den Tod des Bruders, Vater und Mutter konnten den Tod ihrer beiden älteren Söhne nicht verwinden. In ihrer Trauer suchten sie Halt beim Jüngsten, doch der war niemandem zugänglich. Die Eltern führten das auf den Schock zurück, die Brüder und den Onkel verloren zu haben, aber auch auf ein wahrscheinliches Trauma, ausgelöst vom Überlebenskampf im Sandsturm.
Er redete damals sehr wenig, aber nicht weil er unter Schock stand, sondern aus Berechnung. Er konstatierte, daß nach jenen Ereignissen niemand ein größeres Anrecht darauf hatte, seelisch und körperlich mitgenommen zu sein, als er, und er nutzte diese Chance, um, was er ohnedies vorhatte, sich mit seinen Problemen zurückzuziehen. Ohne jene Ereignisse hätte er das nicht mit solcher Kompromißlosigkeit tun können.
Er litt nicht sehr unter dem Verlust der Brüder, sie waren um etliches älter, er hatte wenig mit ihnen gemeinsam, der Verlust des Onkels aber ging ihm nahe. Der Onkel war in der Langeweile des Alltags auch insofern ein Paradiesvogel gewesen, als er, anders als die übrigen Mitglieder der großen Familie, mit seinem Status als Aristokrat kokettierte und dem Neffen aberwitzige Geschichten von mazedonischen Vorfahren erzählte. Der Onkel jedenfalls fehlte ihm, aber er vermißte ihn nicht. Für ihn war das wichtigste, die Gunst der Stunde zu nutzen und sich gegenüber der Welt zu verschließen.
Aus gutem Grund: Er sah sich umstellt. Von seinem sehr mächtigen, sehr gebildeten, dabei liebenswürdigen Vater, unter dem er keineswegs litt, dem er nur Gutes nachsagen konnte – abgesehen von dessen Wunderglauben an eine gute Verwaltung. Er sah sich umstellt von der fürsorglichen, massigen, gleichwohl eleganten Mutter. Beide waren im Haus präsenter denn je, seit sie sich der Trauer hingaben, denn es fehlte an Gästen, seit keine mehr geladen wurden. Den Verwandten, Freunden, Bekannten, die in dem gastfreundlichen Haus, nach Belieben fast, aus und ein gegangen waren, hatte man beschieden, sich eine Zeitlang fernzuhalten, und aus dieser Zeitlang wurde eine lange Zeit – so hatten es die ausgesperrten Gäste empfunden, ohne zu ahnen, daß dieses prachtvolle Haus auf der Nilinsel ihnen nie wieder offenstehen würde.
Und er sah sich umstellt von Zufälligkeiten. Er entschied sich für dieses Wort, als er zu seinem Entzücken im Wörterbuch der deutschen Sprache neben »Zufall« auch »Zufälligkeit« entdeckte. Er hielt letztere, die Zufälligkeit, für den philosophisch bedeutsamen Begriff gegenüber dem bloßen Zufall. Über die Neigung der deutschen Sprache, durch Vor- oder Nachsilben harmlose Wörter zum Dröhnen zu bringen, klärte ihn erst später der Österreicher auf. Er jedenfalls, ohnedies schon davon beeindruckt, daß die deutsche Sprache das »Wesen« – angeblich die Substanz schlechthin – noch zu steigern, gewissermaßen in die Tiefe zu steigern wußte durch die »Wesenheit«, erklärte die Zufälligkeit zu dem Begriff, der ihm helfen würde, sein Dasein zu erklären.
Man kann sich die Eltern nicht aussuchen, so ging seine Überlegung, so wenig, wie diese sich das Kind aussuchen können, das sie in die Welt setzen. Die Zufälligkeit zwingt einen zusammen. In seinem Fall war das Zwangsverhältnis zu den Eltern gut – zufällig. Noch dazu wurde er in eine reiche Familie hineingeboren – zufällig. Der Satz, den er damals am öftesten vor sich her sagte: Ich stelle nur fest. Er beklagte sich nicht über sein Schicksal, er frohlockte nicht, er wollte nur festgehalten wissen, daß dieses Schicksal zufällig seines war. Er hatte dazu nichts beigetragen.
Und er sah sich umstellt von Gott. Genauer: von drei Göttern, von denen jeder den anderen ausschloß, denn es waren Götter von drei monotheistischen Religionen. Der Vater war Kopte, Anhänger einer christlichen Religion, die Mutter Muslimin, der ungläubige Onkel war mit einer Jüdin verheiratet, sympathisierte mit deren Religion und wäre dieser, wenn die Aufnahme nicht rituelle Schwerarbeit erfordert hätte, auch beigetreten.
Zacharias kam in der selbstgewählten Einsamkeit, in die er sich zum Nachdenken zurückgezogen hatte, zu dem Schluß, daß unter all den Zumutungen, die einem entgegenschlugen, wenn man in diese Welt hineingeboren wurde, die Zumutung, daß es einen Gott geben soll, die unverfrorenste war.
Er nutzte die Möglichkeit, den Trauernden zu mimen, um, ohne dabei gestört zu werden, mit seinen forschenden Gedanken durch die Oberfläche der Welt zu dringen, einer Welt, die seiner Ansicht nach von Religionen bis zur Unbewohnbarkeit verkrustet war. Wo seine Gedanken auch hinzielten, sie stießen auf Schlacke, auf den unfruchtbaren Verbrennungsrückstand einer vor Tausenden Jahren vielleicht fruchtbaren Götterwelt, auf einen Aberglauben, der allergrößten Wert darauf legte, Glauben genannt zu werden. Der eine Teil der Menschheit, der kleinere, berief sich auf Gott, wenn er seinen Reichtum verteidigte, der andere Teil tat desgleichen, um redliche Argumente für seine Armut vorzubringen. Jeder, ob Muslim, Jude, Christ, rechtfertigte seinen Aberglauben damit, so Zacharias’ Annahme, daß er für die jeweilige Situation, wie gut, wie schlecht sie auch war, gute religiöse Gründe fand.
Daß nach so vielen Jahrtausenden Menschheitsgeschichte, daß in der Mitte des 20. Jahrhunderts, der religiöse Unfug immer noch eine Antriebskraft der Gesellschaft war, wunderte ihn zwar, aber er nahm es hin. Als Angehörigen der Oberschicht – da materiell gesichert, überließ er sich bewußt geistiger Unsicherheit – konnte ihn, so jedenfalls sah er es, als er nun zurückblickte, keine noch so radikale Erkenntnis aus der Lebensbahn werfen.
Die beiden Gewichte, die auf einem schon lasteten, ehe man zur Welt kam, Eltern und Aberglaube, wurden, dessen war er sich nun gewiß, gewichtig ergänzt von der grandiosen Geschichte Ägyptens. Auch ein Phänomen, das schon immer vorhanden war und das sich einem nicht nur aufdrängte wie die Eltern und der Glaube, sondern, schlimmer, das sich ausgab als eine Art Natur, nicht als Geschichte, sondern als Erdgeschichte. Er hatte den Eindruck, die baulichen Großtaten der Altvorderen würden unmäßig verherrlicht, so als wären sie bereits vor der Wüste, vor dem Nil und vor dem Meer dagewesen.
Die Eltern starben langsam dahin, zwei Jahre nach dem Tod seiner Brüder waren auch sie nicht mehr am Leben. Er spielte sich nichts vor, als er, gerade dreizehn geworden, vor den Leichen stand, zuerst vor dem Vater, drei Monate später vor der Mutter, und dachte: Ich habe ihn gerngehabt; ich habe sie gerngehabt. Zum ersten Mal in seinem Leben weinte er bitterlich. Und dennoch, als sie begraben waren, sagte er zu sich: Nun bin ich allein und frei. Frei auch von den freundlichen und herablassenden Bemerkungen der Eltern und der Brüder, er sei für die Gedanken, denen er fortwährend nachhänge, viel zu jung. Er hatte sich deshalb auch nicht mehr geäußert, außer gegenüber dem Onkel, der ihm zu jenen Gedanken applaudierte.
Seit dem Tod der Eltern beschäftigten ihn Gott und die Gottesfrage nicht mehr, zur gleichen Zeit fühlte er sich befreit von der Geschichte. Und tatsächlich mied er sein Leben lang, soweit das einem Ägypter möglich war, die Beschäftigung mit der Geschichte des Altertums. Sein Forschergeist sagte ihm, Denken sei an lebendige Erfahrung gebunden, weshalb man aus der Geschichte vor allem lernen könne, daß man aus ihr nichts lernen kann. Sarani erschrak über diese Erinnerung, die voll war von Toten, er erschrak aber auch darüber, wie er auf der Bank saß: völlig in sich zusammengesunken. Er riß sich zusammen, setzte sich gerade und straffte den Rücken. Dabei seufzte er unwillkürlich, es war ein Seufzen, das in ein Röcheln überging, was in ihm die Hoffnung weckte, auf der Stelle tot von der Bank zu fallen und nicht auf den Tod in der Wüste warten zu müssen.
Nein, rief er und stampfte wütend auf. Und zu sich sagte er, unhörbar, aber bestimmt: Ich bin nicht hierhergekommen, um zu sterben.
Sarani hatte es satt, sich den Tag mit düsteren Überlegungen zu vergällen. Er wollte wie in der ersten Minute, als er hier gestrandet war, die Sonne im Schatten des Baumes genießen. Den Gedanken, daß ein Schwächeanfall ihn auf die Bank gezwungen hatte, verscheuchte er; lieber horchte er in die Windstille hinein, kein Blatt raschelte, und voll Verwunderung betrachtete er den Baum, an dem selbst die dünnsten Zweige sich nicht bewegten.
Er wußte, daß in einer Wüstenregion selten Windstille herrscht. Das Wort herrschen irritierte ihn. Damit verband er Gewalt und Getöse; die Sprache aber, jene deutsche Sprache, die er im Alter von zehn Jahren zu lernen begonnen hatte und deren ewiger und dankbarer Schüler er war, wollte offenbar, daß auch die Stille herrscht; vielleicht bestand deren Gewalt in der Unterdrückung des Getöses.
Er wußte, daß der ständige Wind zur Wüste gehörte wie der Sand, der, vom Wind Hunderte Meter hochgewirbelt, gewöhnlich als eine dünne, graue Schicht über Kairo und den Nil hinwegzog wie ein endloses Tuch, das Tag für Tag, Monat für Monat unverändert und starr über der Stadt zu hängen schien und sich doch immerfort weiterbewegte – ausgenommen die Zeit der Windstille, in der man den wolkenfreien, blauen Himmel sehen konnte, was Sarani überaus entzückte, weil das klare Sonnenlicht, das auf den Laubbaum fiel, die Blätter als Schatten auf den Erdboden zeichnete. Er konnte sich an diesen Bildern nicht satt sehen.
Zugleich lauschte er den Geräuschen des Verkehrs, weil sie einerseits deutlich wahrzunehmen waren, andrerseits sich anhörten, als kämen sie von weit weg, wiewohl die sechsspurige Flughafenautobahn nur zehn Meter von der Bank entfernt war; da jedoch kein Wind den Lärm hierher trug, wirkten die Geräusche, als wäre die Straße ein Käfig, in dem sie tobten und am Gitter rissen, Sarani aber nichts anhaben konnten.
Als ärgerlich empfand er, daß Hunger und Durst ihm von Minute zu Minute stärker zusetzten. Er hatte in den vergangenen Wochen nur so viel getrunken, daß er nicht an Austrocknung starb. Versuchte er aber zu essen, blieb ihm der Bissen im Hals stecken. Wollte er nicht ersticken, mußte er ihn hinunterwürgen, woraufhin es ihm den Magen umdrehte.
Diese Art, sich zu ernähren, führte nur deshalb nicht zu seinem Tod, weil er vor dem Tod noch etwas zu erledigen hatte. In der Innentasche seines Rocks steckte neben den Abschiedsbriefen an Frau und Tochter ein auf einer Seite beschriebenes Blatt Papier, das ihm vor einem halben Jahr zugesandt worden war und das er dem Absender zurückschicken wollte, nach Wien oder nach New York, wo der Absender, der Österreicher, abwechselnd lebte.
Allerdings wollte er ein paar eigene Zeilen dazulegen, er hatte auch schon versucht, den einen und anderen Satz zu formulieren, doch er fand nicht die richtigen Worte, jedes erschien ihm zu schwach: Schurke, Verräter, Lügner, alles nichtssagende Wörter in Anbetracht der Schurkerei, des Verrats, der Lügen, deren der Österreicher sich schuldig gemacht hatte.
Dieser Mann hatte am Tag zuvor aus New York angerufen und völlig wirr gesprochen. Sarani fragte sich, ob der Mann den Zynismus auf die Spitze treibe, indem er nun sich selbst als Leidenden darstelle. Oder ob er sich als jemand stilisiere, den die Einsicht in seine Schuld niederdrücke und der nun hoffe, daß ihm verziehen werde. Beides war Sarani gleich widerwärtig. Den Zynismus des Täters, sich als Opfer zu geben, aber auch das Schuldbekenntnis eines Schuldigen wies er zurück, denn der Täter hatte das Schurkenstück über eine lange Zeitspanne geplant, zusammen mit seinem, Saranis, Sohn.
Schluß, befahl er sich, er wollte nicht, daß in seinem Kopf zum tausendsten Mal die Litanei in Gang gesetzt wurde über den Verrat des Freundes, über die Treulosigkeit des Sohnes, beides für ihn unfaßbar – in seinen wüstesten Alpträumen, in denen er die Liebe zu Sophie hatte enden, seine Kinder durch einen Unfall hatte sterben, sein Unternehmen durch ein Erdbeben hatte zerstieben sehen, war jenes Unglück nicht vorgekommen, das wirklich über ihn hereingebrochen war, so daß ihm kein anderer Weg offenstand als der in den Tod.
Seit er das wußte, ging es ihm besser. Am Morgen hatte er sogar, nach langem wieder, seinen Lieblingsanzug angezogen, wobei ihm auffiel, so frei war sein Kopf wieder, daß etwas anziehen nur korrespondierte mit Anzug, nicht mit Hose, Hemd oder Socken.
Der Anruf vom Tag zuvor brachte Sarani nicht aus dem Konzept. Sollte der Österreicher tatsächlich in Kairo landen, was Sarani für möglich, nicht aber für wahrscheinlich hielt, denn was ein Schurke verspricht, dem schenkt man nur bedingt Glauben, hätte das den Vorteil, daß er den Text, den er hatte zurücksenden wollen, ihm einfach in die Hand drücken konnte, ohne sich weiter darüber den Kopf zu zerbrechen, welche den Verfasser ins Herz treffenden Worte er beilegen sollte.
Sarani mußte seinen Plan nur geringfügig ändern: Er werde mit dem Geländewagen zum Haus in der Wüste fahren, nachdem er den Österreicher am Flughafen getroffen, ihn zu einem Taxi begleitet, ihm den Text überreicht und ihn aufgefordert habe, ins Hotel Marriott zu fahren und dort Quartier zu nehmen. Er werde ihn dort am nächsten Tag um elf besuchen. Er werde dann zum Österreicher sagen: Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Der Kerl, der sich in der Nacht eine Erklärungs-, Entschuldigungs-, und Rechtfertigungsrede zurechtgelegt habe, werde diese nun loswerden wollen, er, Sarani, aber werde sich von ihm abwenden und weggehen.
Daraufhin, dachte er, werde er zum Wüstenhaus fahren. Die Windstille sei das sichere Vorzeichen für einen gewaltigen Sturm, und der sei ein Garant für den sicheren Tod. Sarani brauche sich nur mit Absicht falsch zu bewegen, und der Sand werde ihn unter sich begraben.