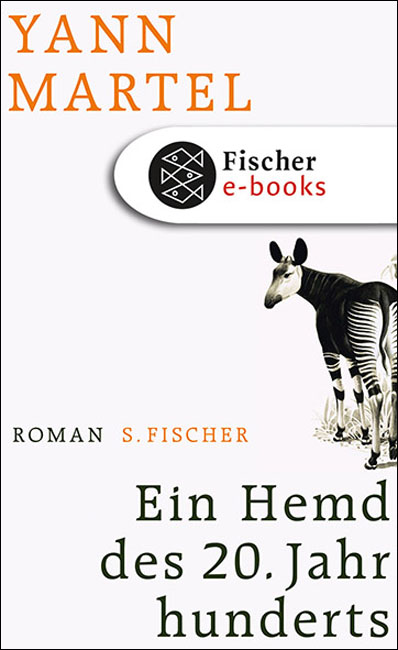
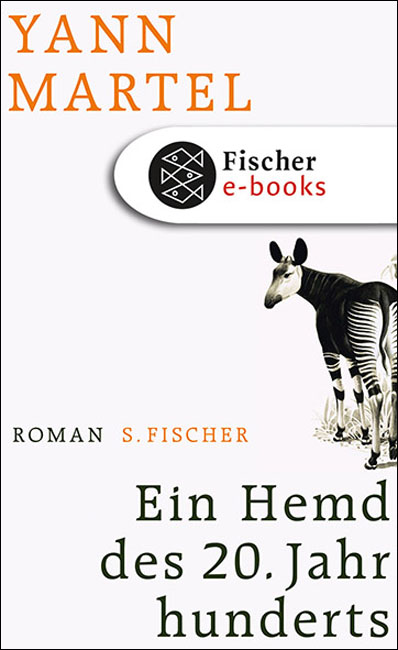
Yann Martel
Ein Hemd des 20. Jahrhunderts
Roman
Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
Fischer e-books

Yann Martel wurde 1963 in Spanien geboren. Seine Eltern sind Diplomaten. Er wuchs in Costa Rica, Frankreich, Mexiko, Alaska und Kanada auf und lebte später im Iran, in der Türkei und in Indien. Er studierte Philosophie und wohnt derzeit in Montreal. Sein Roman »Schiffbruch mit Tiger« gewann den Booker Prize 2002 und wurde zum Weltbestseller.
Henry T., ein ehemals erfolgreicher Schriftsteller, bekommt eines Tages einen Brief von einem Leser, der ihn sehr neugierig macht. Die Suche nach jenem führt Henry zur Tierpräparation »Okapi« und ihrem Besitzer. Der zeigt ihm Szenen eines ungewöhnlichen Theaterstückes, das er gerade schreibt. Es handelt vom »Schrecken«. Doch was ist der »Schrecken«, was geschieht da, und wie können wir Erlebnisse benennen, die sich in ihrer Grausamkeit jeglicher Sprache entziehen?
Yann Martel hat ein literarisches Zauberspiel über die Barbarei der Diktatur geschrieben. Anwendbar für jeglichen fürchterlichen, alles Menschliche unterdrückenden Faschismus, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ein poetisches, erfindungsreiches und herausforderndes Plädoyer für Menschenwürde und Toleranz.
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: © Look and Learn / Bridgeman Berlin
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
›Beatrice and Virgil‹ bei Spiegel & Grau,
an imprint of The Random House Publishing Group,
a division of Random House, Inc., New York
© 2010 by Yann Martel
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt
ISBN 978-3-10-400770-0
Henrys zweiter Roman, den er wie den ersten unter Pseudonym veröffentlich hatte, war ein Erfolg gewesen. Er hatte Preise bekommen und sein Buch war in Dutzenden von Sprachen erschienen. Henry wurde zu Buchpremieren und Literaturfestivals rund um den Erdball eingeladen, Schulen nahmen das Buch in ihren Lehrplan auf, Buchclubs in ihr Programm, immer wieder sah er im Flugzeug oder im Zug Leute, die es lasen, Hollywood wollte einen Film daraus machen und so weiter und so fort.
Henry lebte derweil weiter ein halbwegs normales, anonymes Leben. Schriftsteller werden selten Stars. Bekannt werden, und das zu Recht, die Bücher selbst. Leser erkennen sofort den Umschlag eines Buches, das sie gelesen haben, aber in einem Café – der Mann da, ist das nicht … ist das nicht … na, schwer zu sagen – der hatte doch längere Haare – oh, jetzt ist er weg.
Es machte Henry nichts aus, wenn man ihn erkannte. Nach den Erfahrungen, die er gemacht hatte, war die Begegnung mit einem Leser ein Vergnügen. Schließlich hatten sie sein Buch gelesen und es hatte sie berührt, weshalb sollten sie sonst zu ihm kommen? Es war etwas Intimes; zwei Fremde kamen zusammen, aber sie redeten nicht über sich, sondern über eine Sache, etwas, woran sie glaubten und das sie beide berührt hatte, und damit fielen sämtliche Schranken. In einem solchen Gespräch war kein Platz für Lügen oder große Sprüche. Man redete leise, stand eng beieinander, jeder gab etwas von sich preis. Einer erzählte Henry, seinen Roman habe er im Gefängnis gelesen. Bei einer anderen Leserin war es der Kampf gegen Krebs. Ein Vater hatte ihm anvertraut, dass sie sich das Buch im Familienkreis laut vorgelesen hatten, nachdem ihr Kind zu früh zur Welt gekommen und gestorben war. Und es gab noch weitere solcher Begegnungen. In jedem dieser Fälle hatte etwas an seinem Roman – eine Zeile, eine Figur, ein Handlungselement oder ein Symbol – jemandem geholfen, eine Lebenskrise zu überstehen. Manche Leser, denen Henry begegnete, schütteten ihm ihr ganzes Herz aus. Das rührte ihn jedes Mal neu und er mühte sich immer, ihnen etwas Trostreiches zu sagen.
In den meisten Fällen wollten die Leser einfach nur von ihrer Anerkennung oder Bewunderung sprechen, manchmal hatten sie auch ein Andenken, gebastelt oder gekauft: einen Schnappschuss, ein Lesezeichen, ein Buch. Sie hatten vielleicht eine Frage oder zwei, die sie schüchtern vorbrachten, weil sie ihn nicht belästigen wollten. Sie waren ihm dankbar, wenn er eine Antwort gab, egal welche. Sie nahmen das Buch, das er signierte, und drückten es sich mit beiden Händen an die Brust. Die Mutigeren, meistens, aber nicht immer Teenager, fragten manchmal, ob er sich mit ihnen fotografieren lasse. Henry stand dann da, den Arm um ihre Schulter gelegt, und lächelte in die Kamera.
Die Leser gingen davon, und ihre Gesichter strahlten, weil sie ihm begegnet waren, und er selbst strahlte, weil er den Lesern begegnet war. Henry hatte einen Roman geschrieben, weil er eine Leere in sich gespürt hatte, die er füllen wollte, eine Frage, die er beantworten wollte, ein Stück Leinwand, das danach schrie, bemalt zu werden – jene Mischung aus Beklemmung, Neugier und Begeisterung, die der Ursprung der Kunst ist –, und er hatte die Leere gefüllt, die Frage beantwortet, Farbe auf die Leinwand gekleckst; all das um seiner selbst willen, weil er nicht anders konnte. Dann kamen Wildfremde und erzählten ihm, sein Buch habe eine Leere in ihrem Inneren ausgefüllt, eine Frage beantwortet, Farbe in ihr Leben gebracht. Der Trost von Fremden, ob nun ein Lächeln, ein Schulterklopfen oder ein lobendes Wort, ist wahrhaftiger Trost.
Die Berühmtheit dagegen, die fühlte sich nach gar nichts an. Berühmtheit war kein Gefühl wie Liebe oder Hunger oder Einsamkeit, das in einem aufstieg und dem äußeren Auge unsichtbar blieb. Im Gegenteil, sie war etwas rein Äußerliches, etwas, das seinen Ursprung in den Köpfen der anderen hatte. Sie bestand in der Art, wie Leute ihn ansahen und sich ihm gegenüber verhielten. So gesehen war Berühmtsein nicht anders als homosexuell oder jüdisch sein oder sichtlich Angehöriger einer Minderheit: man ist, wer man ist, und dann projizieren die Leute ihre Vorstellung auf einen. Im Grunde hatte der Erfolg seines Romans Henry nicht verändert. Er war dieselbe Person, die er vorher gewesen war, mit denselben Stärken, denselben Schwächen. In den seltenen Fällen, in denen ein Leser sich ihm auf unerfreuliche Weise näherte, blieb ihm immer noch die letzte Waffe eines Schriftstellers, der unter Pseudonym schrieb: nein, er sei nicht XY, er sei nur ein Typ namens Henry.
Nach einer Weile waren dann die Verkaufsveranstaltungen für seinen Roman vorbei, und Henry kehrte zurück zu einem Leben, wo er in aller Ruhe wochen- oder gar monatelang in seinem Zimmer sitzen konnte. Er schrieb ein weiteres Buch. Das bedeutete fünf Jahre Nachdenken, Nachforschen, Schreiben, Umschreiben. Das Schicksal dieses Buches spielt seine Rolle bei dem, was im Anschluss mit Henry geschah, und so sollten wir wohl ein paar Worte darüber verlieren.
Das Buch, das Henry schrieb, bestand aus zwei Teilen, und er wollte es in einer Form veröffentlichen, die im Verlagsgeschäft flipbook heißt; das ist ein Buch, das eigentlich aus zwei Büchern, jedes mit seiner eigenen Seitenzählung, besteht, die Rücken an Rücken gebunden werden, so dass man den einen Teil von der einen und den anderen von der anderen Seite liest. Wenn man ein solches Buch durchblättert, kommt man an eine Stelle, an der die nächste Seite auf dem Kopf steht. Man muss es bei der Lektüre umdrehen, und genau das bedeutet das englische Wort to flip.
Henry war auf diese ungewöhnliche Lösung verfallen, weil er überlegt hatte, wie er am besten zwei literarische Produkte präsentieren konnte, die den Titel, das Thema und die dahinterliegenden Gedanken gemeinsam hatten, sich jedoch in der Form unterschieden. Im Grunde hatte er zwei Bücher geschrieben: das eine war ein Roman, das andere hatte die Form eines Essays. Er hatte diesen doppelten Ansatz gewählt, weil er fand, dass er für sein Thema alle Mittel ausschöpfen sollte, die ihm zur Verfügung standen. Aber nur sehr selten findet man Fiktionales und Nichtfiktionales zusammen in einem Buch. Das war das Problem. Es ist Tradition, dass man die beiden getrennt hält. So werden nämlich unsere Vorstellungen vom Leben und unser Wissen darüber in den Buchläden und Bibliotheken geordnet – getrennte Reihen, getrennte Etagen –, und so präsentieren die Verlage ihre Bücher, die Phantasie im einen Paket und die Vernunft im anderen. Aber Schriftsteller schreiben nicht so. Einem Roman fehlt es nicht an Vernunft, und ein Essay kommt nicht ohne Phantasie aus. Und die Menschen leben nicht so. Leute trennen in ihrem Denken und ihren Taten Phantasie und Vernunft nicht so radikal. Manche Dinge sind wahr, manche sind gelogen – das ist die Unterscheidung, auf die es ankommt, in Büchern wie im Leben. Unterscheiden muss man zwischen Fiction und Nonfiction, die die Wahrheit sagen, und Fiction und Nonfiction, die gelogen sind.
Aber, er konnte es nicht leugnen, die eingefahrenen Wege stellten Henry vor ein Problem. Wenn sein Roman und sein Essay in zwei getrennten Büchern veröffentlicht würden, wäre nicht mehr offensichtlich, dass sie zusammengehörten, die Kraft, mit der sie sich ergänzen sollten, wäre verloren. Sie mussten in einem gemeinsamen Band erscheinen. Aber welcher Teil zuerst? Den Essay vor den Roman zu setzen, kam Henry nicht richtig vor. Der Roman, der dem Leben näher stand, sollte Vorrang vor der Abstraktheit des Sachbuchs haben. Es sind die Geschichten – des Einzelnen, der Familie, der Nation –, die all die so unterschiedlichen Elemente unseres Lebens zu einem großen Ganzen verknüpfen. Wir leben von Geschichten. Es wäre nicht richtig gewesen, einem so wunderbaren Ausdruck unseres ganzen Lebens den zweiten Platz hinter einem viel begrenzteren Akt des verstandesmäßigen Erklärens zuzuweisen. Aber hinter einem ernsthaften Sachtext stehen dieselben Fakten und dieselbe Mühe wie hinter einem Erzähltext – in beiden Fällen geht es um nichts Geringeres als um die Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein –; wieso sollte man da den Essay zum Nachwort degradieren?
Unabhängig von der Frage, wer welchen Platz verdiente: wenn Roman und Essay hintereinander in einem Band veröffentlicht wurden, würde das, was an zweiter Stelle kam, im Schatten des ersten stehen.
Die inhaltliche Zusammengehörigkeit forderte also, dass sie zusammen veröffentlicht werden sollten; der Wunsch, dass beide zu ihrem Recht kommen sollten, forderte die getrennte Veröffentlichung. Und nach langem Nachdenken kam Henry dann auf die Lösung mit dem zweiseitigen Buch.
Als er erst einmal auf dieses Format verfallen war, ging ihm auf, dass es noch weitere Vorteile hatte. Die Ereignisse, um die es in diesem Buch ging, waren – und sind es bis heute – wahrhaft entsetzlich, sie stellten, könnte man sagen, die ganze Welt auf den Kopf, und da war es doch nur passend, dass das Buch selbst ebenfalls immer halb auf dem Kopf stand. Und wenn es in dieser Form des Umdrehbuches erschiene, bliebe es dem Leser selbst überlassen, welchen Teil er zuerst las. Leser, die sich Trost und Hilfe vom Verstand versprachen, würden den Essay zuerst lesen. Diejenigen, die sich mit dem emotionaleren, unmittelbareren Ansatz des Romans wohler fühlten, würden dort anfangen. Jedenfalls lag die Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand des Lesers, und die Möglichkeit einer Wahl, gerade wenn es um unangenehme Dinge geht, ist immer eine gute Sache. Und zu all dem kam noch die Tatsache, dass ein solches Doppelbuch zwei Vorderseiten hat. Für Henry war das mehr als nur die Aussicht auf einen schönen Umschlag. Ein Flipbook ist ein Haus mit zwei Eingangstüren, aber ohne Ausgang. Schon die Form gibt zu verstehen, dass es bei den Dingen, von denen darin die Rede ist, keine Lösung geben kann; es ist kein hinterer Buchdeckel da, mit dessen Zuklappen der Leser die Sache zufrieden für abgeschlossen erklären kann. Für diese Sache gibt es keinen Abschluss; immer wieder kommt der Leser – oder die Leserin – an eine zentrale Seite, nach der die folgende plötzlich auf dem Kopf steht, und damit ist klar, dass die Angelegenheit nicht zu Ende ist, dass sie nicht zu Ende sein kann, dass man immer wieder von vorn beginnen muss. Deshalb fand Henry auch, dass die beiden Bücher auf ein und derselben Seite enden sollten, mit nur einer einzigen leeren Zeile zwischen den beiden letzten, aus zwei Richtungen darauf zulaufenden Sätzen. Vielleicht noch mit einer einfachen Zeichnung in diesem Niemandsland zwischen Fiction und Nonfiction.
Die Angelegenheit wird noch komplizierter dadurch, dass das englische Wort flipbook auch noch etwas ganz anderes bezeichnen kann, nämlich eine kuriose Form von Büchlein, die man im Deutschen Daumenkino nennt, eine Folge von jeweils von Bild zu Bild leicht veränderten Zeichnungen oder Fotografien; wenn man die Seiten schnell auffächert, entsteht die Illusion eines bewegten Bildes, eines galoppierenden oder springenden Pferdes zum Beispiel. Später sollte Henry noch reichlich Gelegenheit haben, zu überlegen, was für einen Zeichentrickfilm sein Buch wohl gezeigt hätte, wenn es ein Flipbook dieser anderen Sorte gewesen wäre: Es wäre ein Streifen von einem Mann gewesen, der voller Selbstvertrauen erhobenen Hauptes seines Weges geht, bis er mit einem Male stolpert und taumelt und spektakulär auf die Nase fällt.
Man sollte erwähnen, dass es – denn das liegt im Mittelpunkt all der Schwierigkeiten, auf die Henry stoßen sollte, seines Stolperns, Taumelns und Aufdienasefallens – in dem Buch um die Ermordung von Millionen unschuldiger Juden – Männer, Frauen und Kinder – durch die Nazis und ihre willigen Helfer überall in Europa im jetzt vergangenen Jahrhundert ging. Um jene entsetzliche, jahrelange Epidemie des Judenhasses, die man heute, was eine kuriose Konvention ist, die Aneignung eines Begriffs, der aus der Religion kommt, als den Holocaust kennt. Genauer gesagt ging es in Henrys Doppelbuch darum, wie dieses Ereignis in Geschichten gefasst wurde. In den vielen Jahren, die Henry nun schon Bücher las und Filme sah, war ihm aufgefallen, wie wenig tatsächlich Fiktives es über den Holocaust gab. Das Thema wurde so gut wie immer historisch, faktisch, dokumentarisch, anekdotisch, zeitzeugenhaft, wortwörtlich behandelt. Grundtyp waren die Memoiren des Überlebenden, Primo Levis Ist das ein Mensch? zum Beispiel. Der Krieg hingegen – um einen anderen Anschlag auf die Menschheit zu nehmen – lieferte ständig Material für ganz anderes. Krieg wird am laufenden Band trivialisiert, als harmloser hingestellt als das, was er in Wirklichkeit ist. Die Kriege unserer Zeit haben Millionen Menschen das Leben gekostet und ganze Länder verwüstet, und doch müssen Darstellungen, die den Krieg in seiner ganzen Grausamkeit zeigen, sich mühen, damit sie gesehen oder gehört oder gelesen werden unter all den Kriegsthrillern, den Kriegskomödien, den Kriegsromanzen, der Kriegssciencefiction und der Kriegspropaganda. Aber wer traut sich, von »Trivialisierung« des Krieges zu sprechen? Haben Veteranenverbände je protestiert? Nein, denn so ist das eben mit dem Krieg, so reden wir darüber, auf vielerlei Art und mit vielerlei Absicht. Es sind Darstellungen, die uns helfen zu verstehen, was Krieg für uns bedeutet.
Selten hat sich jemand eine solche dichterische Freiheit für den Holocaust genommen – vielleicht wird sie selten gestattet. Dies schreckliche Ereignis wird immer nur von einer einzigen Denkschule dargestellt: dem historischen Realismus. Die Geschichte, immer dieselbe Geschichte, war immer im selben Zeitraum angesiedelt, am selben Ort, mit denselben Figuren. Ausnahmen gab es natürlich. Henry dachte an Maus, das Comicbuch des amerikanischen Zeichners Art Spiegelman. David Grossmans Stichwort: Liebe hatte es ebenfalls mit einem anderen Ansatz versucht. Doch auch da zog die eigentümliche Schwerkraft des Ereignisses den Leser zurück zu den wortwörtlichen historischen Fakten. Wenn eine Geschichte später oder anderswo einsetzte, musste der Leser doch binnen kurzem über Zeiten und Grenzen ins Jahr 1943 und nach Polen marschieren, wie der Held in Martin Amis’ Pfeil der Zeit. Und so fragte Henry sich: warum dieses Misstrauen gegenüber der Phantasie, warum dieser Widerstand gegen die künstlerische Metapher? Eine Arbeit wird zum Kunstwerk, weil sie wahr ist, nicht weil sie realistisch ist. Lag denn nicht sogar eine Gefahr darin, den Holocaust getreu den historischen Fakten darzustellen? Es musste doch irgendwo zwischen den Texten, die erzählten, was geschehen war, den wichtigen und notwendigen Tagebüchern, Memoiren und Berichten auch einen Platz für den Kommentar der Phantasie geben. Andere geschichtliche Ereignisse, und grässliche darunter, sind künstlerisch verarbeitet worden, und es war eine Bereicherung. Um nur drei bekannte Beispiele zu nennen, wie die Kunst Zeugnis ablegen kann: Orwell mit seiner Farm der Tiere, Camus mit der Pest und Picasso mit Guernica. In allen drei Fällen hatte der Künstler sich eine Katastrophe von gewaltigem Ausmaß vorgenommen, hatte den Mut gefunden und sie in nicht-wörtlicher, konzentrierter Form präsentiert. Der historische Ballast wurde abgeworfen, die Essenz ließ sich in einen einzigen Koffer packen. Die Kunst als Koffer, leicht, tragbar, aufs Wesentliche reduziert – ließ sich so etwas denn nicht auch für die größte Tragödie von allen finden, die der europäischen Juden? Ja, musste man es nicht sogar finden?
Um sich für diese Art des Umgangs mit dem Holocaust einzusetzen, um sie zu illustrieren, hatte Henry seinen Essay und seinen Roman geschrieben. Fünf Jahre harter Arbeit hatte er dafür gebraucht. Dann machten die Manuskripte bei diversen Verlagen die Runde. Das war der Punkt, an dem er zum Mittagessen eingeladen wurde. Behalten Sie den Mann in dem Daumenkino im Auge, der stolpert und taumelt und fällt. Henry bekam einen Atlantikflug bezahlt, nur für dieses Mittagessen. Es fand an einem Frühlingstag in London während der dortigen Buchmesse statt. Henrys Verleger, vier an der Zahl, hatten einen Historiker und einen Buchhändler dazu geladen, was Henry als Zeichen doppelter Anerkennung verstand, wissenschaftlicher wie kommerzieller. Er hatte keine Ahnung, was ihm bevorstand. Das Restaurant war vornehm, im Art-déco-Stil. Ihr Tisch war an den beiden Längsseiten elegant geschwungen, wodurch er die Form eines Auges bekam. An einer Seite war in die Wand eine passend geschwungene Bank eingelassen. »Warum setzen Sie sich nicht hierhin«, meinte einer seiner Verleger und zeigte auf die Mitte der Bank. Ja, dachte Henry, das war doch genau der Platz für einen Autor mit einem neuen Buch, wie Braut und Bräutigam am Kopf der Tafel. Rechts und links von ihm ließen sich zwei Verleger nieder. Ihnen gegenüber, auf vier Stühlen entlang der anderen geschwungenen Seite des Tisches, saßen der Historiker und der Buchhändler, rechts und links von je einem Verleger flankiert. Es war eine recht förmliche Sitzordnung, aber es fühlte sich durchaus gemütlich an. Der Kellner brachte die Speisekarten und erläuterte die erlesenen Spezialitäten des Tages. Henry war bester Dinge. Er fühlte sich wie auf einem Hochzeitsfest.
In Wirklichkeit war es ein Exekutionskommando.
Normalerweise machen Verleger ihre Autoren mit Komplimenten auf alles aufmerksam, was ihrer Meinung nach mit dem Buch nicht stimmt. Jede Schmeichelei versteckt einen Vorwurf. Es ist ein diplomatisches Verfahren, das ihnen zu einem besseren Buch verhelfen soll, ohne dass der Autor die gute Laune verliert. Und so begann also, nachdem sie ihr Essen bestellt und ein wenig Konversation gemacht hatten, der Vormarsch der lobenden Kommentare, in denen sich Vorschläge versteckten, die als Anordnungen gemeint waren, wie der Wald von Birnam, der gegen Dunsinane vorrückt. Doch Henry war ein ahnungsloser Macbeth. Er verstand überhaupt nicht, was sie sagen wollten. Er lachte nur und tat ihre immer konkreter werdenden Fragen ab. »Sie reagieren genau so, wie die Leser das tun werden«, sagte er, »mit Fragen, Kommentaren, Einwänden. Und so soll es auch sein. Ein Buch ist Teil eines Gesprächs. Im Mittelpunkt von meinem steht ein absolut abscheuliches Ereignis, das sich nur im Dialog bewältigen lässt. Also, reden wir!«
Es war der Buchhändler, ein amerikanischer Buchhändler in London, ein Mann, der mit seiner näselnden Stimme nicht um den heißen Brei herumredete, der Henry schließlich sozusagen am Jackenaufschlag packte und ihm unmissverständlich klarmachte, worum es ging. »Essays sind langweilig«, sagte er und fasste damit, nahm Henry an, seine Erfahrungen im Buchgeschäft beiderseits des Atlantiks und vielleicht auch eigene Lektüreeindrücke zusammen. »Gerade wenn es um eine heilige Kuh wie den Holocaust geht. Alle paar Jahre kommt mal ein Holocaustbuch raus, das die Herzsaiten schwingen lässt« – das war die Formulierung des Buchhändlers – »und sich weltweit verkauft, aber auf jedes einzelne davon kommen ganze Kisten voll von denen, die am Ende eingestampft werden. Und bei Ihrem Ansatz – ich meine da nicht nur diese Sache mit dem Flipbook – ich meine auch die Idee, die Sie da haben, dass wir uns mit unserer ganzen Phantasie mit dem Holocaust beschäftigen sollen – Holocaustwestern, Holocaustsciencefiction, Holocaustkomödien über jamaikanische Bobschlittenfahrer – ich meine, was soll denn das? Und dann wollen Sie es auch noch als Flipbook machen, was ja normalerweise nur ein Gag ist, so was stellt man unter die Witzbücher, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Ihr Flipbook womöglich ein Flopbook ist, ein einziger großer Flop. Flip-flop, flip-flop, flip-flop«, schloss er, denn der erste Gang wurde gebracht, eine Reihe winziger Tellerchen mit ein paar Happen überkandidelter Delikatessen darauf.
»Ich verstehe Sie«, sagte Henry, nachdem er ein paarmal geblinzelt und geschluckt hatte, als hätte er einen großen Goldfisch im Hals, »aber wir können doch nicht immer wieder das Gleiche machen. Sollte denn nicht gerade das Neue daran, im Inhalt und in der Form, in einem ernsthaften Buch, Aufmerksamkeit wecken? Ist das denn kein Verkaufsargument?«
»Wo sollen wir Ihr Buch hinlegen?«, fragte der Buchhändler, der mit vollem Mund redete, »Literatur oder Sachbuch?«
»Im Idealfalle beides«, antwortete Henry.
»Können Sie vergessen. Schafft nur Durcheinander. Wissen Sie eigentlich, wie viele Bücher eine Buchhandlung hat? Da hätten wir viel zu tun, wenn wir bei jedem überlegen müssten, ob wir es so rum oder so rum legen. Und wo wollen Sie den Barcode hintun? Der ist immer hinten auf dem Umschlag. Wo tun Sie den Barcode hin, wenn Sie zwei Vorderseiten haben?«
»Keine Ahnung«, sagte Henry, »auf den Rücken.«
»Zu schmal.«
»Innen auf die Umschlagklappe.«
»Die Kassiererinnen können nicht jedes Buch aufmachen und schauen, wo der Barcode ist. Und was ist, wenn das Buch in Folie ist?«
»Auf einer kleinen Bauchbinde.«
»Die reißen und gehen verloren. Und wenn man keinen Barcode hat – ein Albtraum.«
»Dann weiß ich es nicht. Ich habe mein Buch über den Holocaust geschrieben und nicht ein einziges Mal an Ihren albernen Barcode gedacht.«
»Ich will Ihnen nur helfen, Ihr Buch zu verkaufen«, sagte der Buchhändler und rollte mit den Augen.
»Ich glaube, was Jeff sagen will«, schaltete sich einer von Henrys Verlegern ein – eine Verlegerin, genauer gesagt, die nun ihrem Mitstreiter beisprang –, »ist, dass es mit dem Buch gewisse Probleme gibt, praktischer und konzeptioneller Art, und damit müssen wir uns beschäftigen. Zu Ihrem Besten«, beteuerte sie.
Henry riss ein Stück Brot ab und wischte wütend eine Tapenade aus Oliven auf, die von einem aus nur sechs Bäumen bestehenden Hain in einem stillen Winkel Siziliens stammten. Er entdeckte den Spargel. Der Kellner hatte ihnen ausgiebig die Soße erläutert, eine kulinarische Komposition von größter Raffinesse, aus den erlesensten Zutaten und so weiter. So wie er es beschrieben hatte, war es, wenn man auch nur einmal die Zunge in dieses Zeug steckte, als habe man einen Doktorgrad errungen. Dr.Henry packte eine Spargelstange, zog sie durch die rosa Soßenkleckse und stopfte sie sich in den Mund. Er war so außer sich, dass er überhaupt nichts schmeckte. Es war nur grün und irgendwie weich.
»Versuchen wir es mit einem anderen Ansatz«, schlug der Historiker vor. Er war ein Mann mit freundlichem Gesicht und beruhigender Stimme. Er neigte das Haupt und blickte Henry über die Brillenränder hinweg an. »Worum geht es in Ihrem Buch?«, fragte er.
Das brachte Henry in Verlegenheit. Eine naheliegende Frage vielleicht, aber keine, die man so ohne weiteres beantworten konnte. Deswegen schrieb man ja schließlich Bücher – um ausgiebige Antworten auf kurze Fragen zu geben. Und über den Buchhändler hatte er sich geärgert. Henry atmete tief durch. Er gab sich Mühe mit seiner Antwort an den Historiker. Aber er kam ins Stottern, er verhedderte sich. »In meinem Buch geht es um Darstellungsmöglichkeiten des Holocaust. Das Ereignis ist vergangen; was wir jetzt haben, sind Geschichten darüber. In meinem Buch geht es um eine neue Alternative für solche Geschichten. Bei historischen Ereignissen sollen wir nicht einfach nur Zeugnis ablegen, nicht nur berichten, wie es war, damit die Toten zu ihrem Recht kommen. Wir müssen auch deuten, Schlussfolgerungen ziehen, damit wir heutige Menschen, die Kinder dieser Toten, ansprechen können. Neben dem historischen Wissen brauchen wir auch das Verständnis, das die Kunst liefert. Geschichten bieten Identifikation, sie halten Gruppen zusammen, sie geben einer Sache Bedeutung. So wie Musik ein Geräusch ist, das etwas zu sagen hat, ein Gemälde Farbe, die etwas zu sagen hat, so ist eine Geschichte Leben, das etwas zu sagen hat.«
»Ja, sicher, das mag sein«, sagte der Historiker, ging gar nicht auf Henrys Worte ein, sondern starrte ihn nur eindringlicher an, »aber worum geht es in Ihrem Buch?«
Inzwischen war Henry arg nervös. Er versuchte es mit einem neuen Anlauf, der diesmal mit dem zu tun hatte, was hinter seiner Idee vom Doppelbuch steckte. »Fiktionales und Nichtfiktionales lassen sich nicht so leicht auseinanderhalten. Fiktives ist vielleicht nicht real, aber es ist wahr; es geht über den Horizont der Fakten hinaus, um an die emotionalen und psychologischen Wahrheiten zu kommen. Das Nichtfiktive hingegen, die Historie, das mag zwar real sein, aber die Wahrheit ist daran schwerer zu fassen, weniger leicht zugänglich, weniger eindeutig. Wenn aus Geschichte keine Geschichten werden, dann ist sie tot, dann lebt sie nur noch in den Köpfen der Historiker. Kunst, das ist der Koffer, in dem die Historie transportiert wird, das Wesentliche daran. Kunst ist der Rettungsring der Historie. Kunst ist das Samenkorn, Kunst ist die Erinnerung, Kunst ist der Impfstoff.« Henry spürte, dass der Historiker ihn gleich unterbrechen würde, und so fuhr er hastig und unzusammenhängend fort. »Der Holocaust, das ist ein Baum mit mächtigen historischen Wurzeln, aber mit nur ein paar ganz wenigen, vereinzelten literarischen Früchten. Aber in den Früchten steckt der Samen! Die Früchte pflücken die Leute. Wenn er keine Früchte trägt, kümmert sich keiner mehr um den Baum. Jeder von uns ist so ein Buch mit zwei Seiten«, fuhr Henry fort, auch wenn es überhaupt nichts mit dem, was er gerade gesagt hatte, zu tun hatte. »Jeder von uns ist eine solche Mischung aus Fakt und Fiktion, ein Gewebe aus Geschichten, die in unserem ganz realen Körper angesiedelt sind. Oder etwa nicht?«
»Das verstehe ich alles«, sagte der Historiker mit einer Spur Ungeduld. »Aber ich frage Sie noch einmal: Worum geht es in Ihrem Buch?«
Auf die nun zum dritten Mal vorgebrachte Frage hatte Henry keine Antwort. Vielleicht wusste er nicht, worum es in seinem Buch ging. Vielleicht war das die Schwierigkeit damit. Er atmete tief ein und seufzte. Er starrte das weiße Tischtuch an, rot im Gesicht, und wusste nicht, was er sagen sollte.
Einer der Verleger brach das betretene Schweigen. »Da hat Dave schon recht«, sagte er. »Das Ganze müsste präziser sein, der Roman und der Essay. Das ist ein eindrucksvolles Buch, das Sie da geschrieben haben, eine große Leistung, da sind wir uns alle einig, aber so wie es jetzt dasteht, fehlt es dem Roman an Tempo und dem Essay an Zusammenhalt.«
Der Kellner, der während dieses katastrophalen Mittagessens Henry immer wieder zu Hilfe kam, brachte einen neuen Gang, den Vorwand zu einem Themenwechsel, zu gespielter guter Laune und grimmigem Genuss, bis dann wieder ein Verleger oder der Buchhändler oder der Historiker den professionellen – vielleicht auch den persönlichen – Drang verspürte, die Flinte anzulegen, sie auf Henry richtete und abdrückte. So ging es während des ganzen Essens, ein ständiges Hin und Her zwischen der Frivolität der Haute Cuisine und dem Zerpflücken seines Buches; Henry, der sich wand und wehrte, die anderen, die beschwichtigten und zuschlugen, hin und her und auf und ab, bis es nichts mehr zu essen und nichts mehr zu sagen gab. Jetzt kam alles ans Licht, verpackt in die freundlichsten Worte: Der Roman war langweilig, die Handlung schwach, die Figuren waren nicht überzeugend, ihr Schicksal interessierte nicht, man wusste nicht, was es überhaupt sollte; der Essay war pompös, es fehlte ihm an Substanz, er war nicht schlüssig argumentiert, und er war schlecht geschrieben. Die Idee mit dem Flipbook war eine lästige Äußerlichkeit und dazu noch kommerzieller Selbstmord. Das ganze Buch war ein einziger Reinfall, nicht zu veröffentlichen.
Als das Essen endlich vorbei war und sie ihn freiließen, ging Henry benommen davon. Seine Beine schienen das Einzige, was noch funktionierte. Er konnte nicht sagen, in welche Richtung sie ihn trugen. Nach ein paar Minuten kam er an einen Park. Henry war überrascht von dem, was er dort fand. In Kanada, woher Henry stammte, war ein Park in der Regel voller Bäume. Dieser Londoner Park war ganz anders. Es war eine weite Fläche mit wunderschönem Gras, eine Symphonie aus Grün. Ein paar Bäume gab es, doch die ragten in große Höhe, die Äste hoch angesetzt, als ob sie sich fürchteten, all dem Gras in die Quere zu kommen. Ein runder Teich schimmerte im Mittelpunkt des Parks. Es war ein warmer, sonniger Tag, und überall waren Leute. Henry streifte durch den Park, und erst nach und nach begriff er, was da gerade geschehen war. Die Arbeit von fünf Jahren war für unbrauchbar erklärt worden. Langsam erwachte sein Verstand, von dem Schlag verstummt, wieder zum Leben. Das hätte ich sagen sollen … und das … Wer zum Teufel ist dieser Kerl eigentlich? … Wie kann sie es wagen … – so brüllte es jetzt in seinem Kopf, er malte es sich aus in all seiner Wut. Henry versuchte, seine Frau Sarah in Kanada anzurufen, aber sie war bei der Arbeit, ihr Handy ausgeschaltet. Er hinterließ, untröstlich wie er war, eine lange Nachricht auf ihrer Sprachbox.