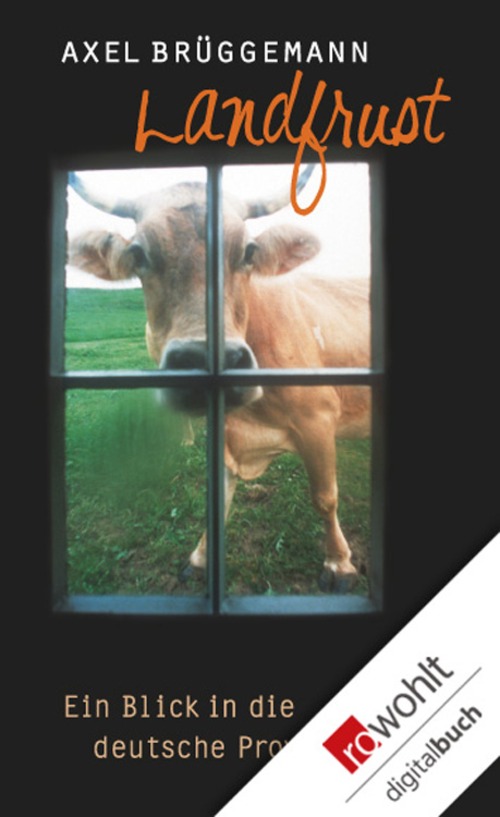
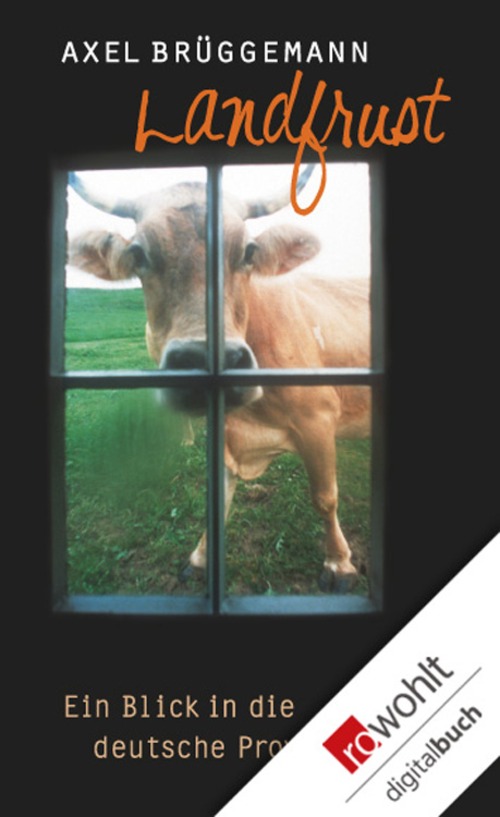
Axel Brüggemann
Landfrust
Ein Blick in die deutsche Provinz
Rowohlt Digitalbuch

Axel Brüggemann, geboren 1971, hat Geschichte, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte studiert. Er war Kulturredakteur und Textchef bei der Welt am Sonntag. Seit 2006 schreibt er unter anderen für die FAS, den Stern, den Cicero und Focus. Außerdem ist er für den Deutschlandfunk, das ZDF und arte tätig. Seine CD-Reihe «Der kleine Hörsaal» (Deutsche Grammophon) wurde mit dem Klassik-ECHO ausgezeichnet.
Schluss mit der Romantisierung des Landlebens!
Immer mehr Städter ziehen inzwischen aufs Land – oder träumen vom Häuschen im Grünen. Doch ist dort wirklich das Idyll zu finden, nach dem sich alle sehnen? Axel Brüggemann, der selbst aus Berlin zurück in sein norddeutsches Heimatdorf zog, geht dieser Frage nach und reist durch die deutsche Provinz. Und er stellt fest, dass das Landleben, wie man es sich als Städter vorstellt, mittlerweile kaum noch existiert. Ausgeprägter Gemeinschaftssinn der Dorfbevölkerung, nachbarschaftliche Hilfe und ein ruhiges Leben im Einklang mit der Natur sind nur noch selten zu finden. Stattdessen werden in der Provinz Schulen und Arbeitsplätze rar, und die jungen Menschen verlassen das Land in Richtung Stadt.
Axel Brüggemann rückt einige Klischees über das Glück zwischen Kuhstall und Tante-Emma-Laden zurecht, erzählt anekdotenreich und unterhaltsam vom Leben in seinem Dorf und wirft einen mal kritischen, mal liebevollen Blick auf die deutsche Provinz. Denn eines ist ganz sicher: Das Leben auf dem Land lohnt sich doch.
«Ursprünglich sollte dieses Buch davon handeln, wie unglaublich schön mein Leben geworden ist, seit ich aus Berlin in ein Dorf bei Bremen zog. Aber nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, wie verlockend es ist, sich selbst zu betrügen, um Zweifel an der eigenen Lebensplanung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Um ehrlich zu sein: In meinem Dorf ist nichts mehr so, wie es zu Zeiten meiner Kindheit gewesen ist. Damals lebten noch drei Generationen unter einem Dach. Die Nachbarschaft war eine Solidargemeinschaft, der Tante-Emma-Laden ein täglicher Anlaufpunkt und unser Sportverein das gesellschaftliche Zentrum des Dorfes. Inzwischen ist hier tagsüber kaum noch jemand anzutreffen, für Klönschnack bleibt keine Zeit mehr. Jenes Lebensgefühl, von dem die Großstädter so gerne lesen, das in unzähligen Romanen oder auf dem Fernsehschirm idealisiert wird – ist das überhaupt zu verwirklichen? Oder ist das Land mittlerweile zur neuen Krisenregion Deutschlands verkommen – ein Nährboden für Verdummung, Verrohung und Vereinsamung?»
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke und Cordula Schmidt
(Umschlagabbildung: Jochen Manz/Volker Ernst)
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
ISBN Buchausgabe 978-3-463-40592-6 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-30521-2
www.rowohlt-digitalbuch.de
ISBN 978-3-644-30521-2
Für Claudia und Marie,
die das Abenteuer Dorf beleben.
Ursprünglich sollte dieses Buch davon handeln, wie unglaublich schön mein Leben geworden ist, seit ich aus der Großstadt Berlin in ein Dorf bei Bremen zog – von der Kulturhauptstadt in die Natur. Von einer Wohnung in Schöneberg in das Haus meines Großvaters. Und davon, wie erholsam das alles ist: die Ruhe, die Muße, die Gemeinschaft. Ich wäre nicht der Erste gewesen, der davon berichtet. Es ist Mode geworden, das Landleben als letzte Herausforderung eines Großstädters zu bezeichnen – und sich für den dafür erforderlichen Mut feiern zu lassen.
Aber nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, wie verlockend es ist, sich selbst zu betrügen. Wie schnell man beginnt, sich seine Umgebung schönzureden – nur um eventuelle Zweifel an der eigenen Lebensplanung gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Um ehrlich zu sein: In meinem Dorf ist heute nichts mehr so, wie es zu Zeiten meiner Kindheit gewesen ist. Damals, als mein Großvater der Herr dieses Hauses war, lebten hier noch drei Generationen unter einem Dach. Die Nachbarschaft war eine Solidargemeinschaft, der Tante-Emma-Laden ein täglicher Anlaufpunkt, die Marmelade meiner Oma eine Wucht und unser Sportverein das gesellschaftliche Zentrum des Dorfes.
Inzwischen ist dieses Dorf zu einem Vorort Bremens mutiert. Tagsüber ist hier kaum noch jemand anzutreffen, für Marmelade und Klönschnack bleibt keine Zeit mehr. Und genau genommen ist die eigentliche Herausforderung nicht die Restaurierung des alten Hauses gewesen, sondern die Frage, wie das Leben auf dem Land sich überhaupt lebendig gestalten lässt. Jenes Lebensgefühl, von dem die Großstädter in Zeitschriften wie LandLust so gerne lesen, das in unzähligen Romanen oder auf dem Fernsehschirm in «Bauer sucht Frau» täglich idealisiert wird – ist das überhaupt zu verwirklichen? Oder ist das Land mittlerweile zur neuen Krisenregion Deutschlands verkommen – ein Nährboden für Verdummung, Verrohung und Vereinsamung?
Die Wahrheit ist: Die deutsche Provinz stirbt einen langsamen, schmerzvollen Tod. Und anstatt zu fragen, ob es überhaupt noch einen Sinn macht, in unsere Provinzen zu investieren, verklären wir die dörflichen Ghettos zu Inseln der Glückseligkeit.
Wie ist es tatsächlich um die deutschen Dörfer bestellt? Sind sie noch zu retten oder längst von allen guten Geistern verlassen? Was bieten die Dörfer, was die Städte nicht haben – außer größerer Armut, mehr Frust und Einfältigkeit? Diese Fragen erscheinen auf den ersten Blick sicherlich sehr subjektiv und provozierend und verlangen nach genauerer Betrachtung und stichhaltiger Analyse.
Wie soll man das Leben auf dem Land deutlich erfassen? Ich habe mich für drei Varianten entschieden, die zusammen ein schärferes Bild ergeben sollen: für den Roman, den Essay und die Reportage.
So ist die Idee entstanden, die 13 Kapitel dieses Buches über das Leben auf dem Land mit einer fortlaufenden fiktiven Geschichte, mit einzelnen Recherchen sowie mit Reisebeschreibungen durch die deutschen Provinzen auszustatten.
Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Wahrheit. Es sollte eher als eine Melange aus Gefühlen, Gedanken und Beobachtungen betrachtet werden. Ich bin mir sicher, dass Verklärungen, Mythen und Selbstbetrug uns nicht weiterbringen, wenn wir dem Landleben – und uns selbst – noch eine Chance geben wollen.
Dieses Buch verlangt nach keiner Regel, wie es gelesen werden soll. Lust und Laune mögen Ihnen die Richtung weisen. Vielleicht kann es so zu einer Entdeckungsreise werden, die Ihnen einen Blick auf eine ganz andere Wirklichkeit gestattet.
Ich liebe übrigens mein Leben in der Provinz. Aber ich weiß auch, dass eine Idealisierung des Landlebens seinen sicheren Tod bedeutet. Davor sollten wir unsere Augen nicht verschließen.
Ich habe auf meinen Reisen festgestellt, dass es oft nur einzelne Menschen sind, die ihre Dörfer lebendig gestalten, dass aber jeder Landbewohner mitverantwortlich ist: verantwortlich dafür, dass die Dörfer nicht zum Krisenherd Deutschlands werden, sondern zu verwirklichten Lebensträumen, an deren Gelingen wir täglich arbeiten müssen.
«Die Menschen, die hier leben, sie tun ihr Bestes.
Unter sehr, sehr harten Bedingungen.»
Grace in Lars von Triers «Dogville»
Erstes Kapitel, das uns das Dorf Überall und seine Bewohner vorstellt.
Hier beginnt die merkwürdige Geschichte des kleinen Dorfes Überall. Es liegt irgendwo in Deutschland, weiträumig eingekreist von zwei Autobahnen, auf denen der Verkehr von Norden nach Süden und von Osten nach Westen fließt. Für Fremde mag diese Lage etwas unwirtlich erscheinen, doch die Bewohner von Überall sind stolz auf ihr Dorf. Von der Autobahn aus kann man sogar den goldenen Wetterhahn der Kirche erkennen. Man muss nur an jener Stelle über die im Tal versinkenden Baumwipfel des Überaller Waldes spähen, wo die neuen Schallschutzmauern für einige hundert Meter unterbrochen sind. Allerdings passieren die meisten Autofahrer Überall, ohne es zu wissen.
Die Kirche steht auf einer Anhöhe am Anfang der Hauptstraße. Sie ist die einzige Straße in Überall. Selbst jene Häuser, die an den kleinen Seitenwegen stehen, gehören zur Hauptstraße. Auch die alte Mühle, die seit vielen Jahren unbewohnt und ungenutzt ist, der kleine Kaufmannsladen, der inzwischen die gelbe Leuchtreklame einer Großmarktkette trägt, und der Gasthof Zum Hirschen, der so heißt, obwohl sich keiner in Überall daran erinnern kann, je einen Hirsch gesehen zu haben.
Am Ende der Hauptstraße wohnt Frank, der junge Mann mit blauer Latzhose und Dreitagebart, der gerade seine Kühe melkt und leise darüber flucht, dass er all das nur seinem Großvater zu verdanken hat.
Frank bestellt den kleinsten der drei Milchhöfe von Überall. Sein Großvater war ein eigenbrötlerischer Bauer, den eigentlich niemand mochte. Nachdem Franks Eltern bei einem Autounfall kurz hinter der Ortsausfahrt von Überall ums Leben kamen, nahm sich der Großvater des Jungen an und erzog ihn zu seinem Erben. Dabei ging er nicht zimperlich vor. Als Frank 16 Jahre alt wurde und in die Großstadt ausbüchsen wollte, kettete ihn der Opa zur Strafe eine Woche lang in einem Koben des Stalls an – so lange, bis er beim Andenken an seine verstorbenen Eltern schwor, den Hof zu übernehmen.
Nachdem sein Großvater gestorben war, fand Frank sich damit ab, den Hof zu bewirtschaften, und gab alle Großstadtpläne auf. Vielen Einwohnern kommt Frank ebenso merkwürdig vor wie sein Großvater. Ganz besonders regt es die Überaller auf, dass er behauptet, sein Hof läge nicht am Ende der Hauptstraße, sondern an deren Anfang. Dabei ist Franks Erklärung durchaus einleuchtend: Sein Hof ist das älteste Gebäude in Überall, älter sogar als die Kirche. Aber diese Sicht der Dinge teilt kein anderer Überaller mit ihm. Nicht einmal Hans, der direkt gegenüber wohnt und sich sehr für die Geschichte des Dorfes interessiert.
Hans ist ein gemütlicher Mann, der gerade auf der Eckbank am Küchentisch sitzt, Chopins Präludien im Radio lauscht und die Aufzeichnungen sortiert, die er von seinen Gesprächen mit den Bürgern von Überall angefertigt hat. Hans schreibt an der ersten Überaller Chronik, worüber nicht alle Dorfbewohner erfreut sind. Denn es gibt einige Dinge, die mancher im Dorf lieber für sich behalten würde. Hans’ Vater war Arzt, so wie Hans auch. Beide kümmerten sich sowohl um die Tiere von Überall als auch um seine Menschen. Inge – das ist Hans’ Frau, die gerade in die Küche kommt, um neuen Kaffee aufzusetzen – glaubt nicht daran, dass ihr Mann seine Chronik je beenden wird. Während sie das Kaffeepulver in den Filter schüttet, fragt sie ihn, ob er nichts anderes zu tun hat, als ewig in der Vergangenheit zu wühlen. Ob sie nicht lieber ihren Urlaub planen wollen, den er ihr versprochen hat, als er seine Praxis schloss. Aber Hans schweigt, als hätte er Inges Frage gar nicht gehört.
Hans und Inges größter Wunsch, dass ihr jüngster Sohn irgendwann studieren und die Praxis des Vaters übernehmen würde, hat sich nicht erfüllt. Tim entwickelte sich zum Sorgenkind und zum Rumtreiber, der nun gelegentlich etwas Geld damit verdient, dass er Frank auf dessen Hof hilft. Einige Überaller sagen, dass Tim geistig ein wenig zurückgeblieben sei. Umso erstaunter waren sie, als er neulich im Hirschen erzählte, dass er sich bei «Landwirt sucht Dame» beworben hätte, der beliebten Fernsehsendung zum Verkuppeln heiratswilliger Bauern. Ausgelacht haben sie Tim, bis er wutschnaubend das Lokal verließ.
Tims Schwester, Dorothea, ist bereits vor neun Jahren verschwunden. Sie hatte einmal eine kurze Affäre mit Frank. Doch nachdem dessen Großvater die beiden an ihrer Lieblingsstelle im Überaller Wald erwischt und seinen Enkel vor Dorotheas Augen windelweich geschlagen hatte, machte Frank einen großen Bogen um sie. Niemand in Überall weiß, wohin Dorothea gegangen ist und was sie heute treibt. Wenn Inge manchmal über ihre Tochter spricht, schweigt Hans.
Einige Häuser weiter, neben der alten Mühle, wohnen Fritz und Waltraud. Sie betreiben den kleinen Kaufmannsladen, mit dem es bergab geht, seit das Industriegebiet an der Autobahn eröffnet hat. Obwohl es über 20 Kilometer von Überall entfernt liegt, bevorzugen viele Überaller den dortigen Supermarkt selbst für die kleinen Dinge des täglichen Lebens. Fritz und Waltraud sind die beiden, die gerade im Garten mit ihrer Enkeltochter Jaqueline Ball spielen. Dass Michaela ausgerechnet von Ulrich, dem Betreiber des Autohofes im Industriegebiet, schwanger geworden ist, konnten die beiden anfangs nicht verstehen – aber wenigstens hat er sie schließlich ohne großen Widerspruch geheiratet. Ihr Sohn Stefan betreibt mit den Eltern gemeinsam den Kaufmannsladen. Er wohnt mit seiner Frau Susanne und ihren beiden Kindern, Paula und Max, gegenüber seiner Schwester, allerdings in einem viel kleineren Haus.
Es würde ausufern, alle einhundertvierundzwanzig Einwohner von Überall vorzustellen, allesamt rechtschaffene Menschen, die ihr Tagwerk noch auf den Feldern von Überall verrichten oder früh am Morgen in die nahegelegenen Städte fahren, um am Abend nach getaner Arbeit ins ländliche Idyll zurückzukehren.
Außerdem ereignet sich im Hirschen gerade eine nicht alltägliche Szene, die weitaus spannender ist.
Pfarrer Witte ist einer der ersten Gäste. Er steht an der Theke und bestellt ein Kirschwasser. Günter, der Wirt, stellt es ihm schweigend auf den Tresen und poliert dann weiter seine Gläser. Günter weiß, dass es besser ist zu schweigen – das ist in Überall seit langem Brauch. Die frühen Nachmittagsstunden an Günters Tresen sind die seltenen Momente, in denen Pfarrer Witte es mit seinem Beichtgeheimnis, das ihm meist überaus heilig ist, nicht ganz so genau nimmt. Aber heute schweigt auch er. In letzter Zeit hat Pfarrer Witte Günter immer wieder darüber berichtet, dass die Diözese plane, seine Kirche zu schließen, da selbst die Schäfchen aus den Nachbardörfern, deren Kirchen bereits geschlossen wurden, nicht mehr ausreichen, um die Kirche zu den Gottesdiensten zu füllen.
Als sich die Tür öffnet und eine Frau den Hirschen betritt, heben die Männer die Köpfe. Die Fremde hat lange rote Haare und trägt ein gelbes Sommerkleid. Ihre ebenfalls gelben Schuhe und ihre strumpflosen Beine sind von Staub bedeckt. Sie trägt einen für Überall ungewohnt aufreizenden Lippenstift.
«Das ist die Sünde», flüstert der Pfarrer, und Günter kichert leise.
Die Fremde stellt sich an die Theke. «Bitte ein Bier, Günter», sagt sie mit erstaunlich gelassener Stimme. Ihre Bestellung klingt etwas weniger rau als die Bestellungen, die Günter üblicherweise erhält.
«Sie kennen mich?», fragt der Wirt.
«Ich kenne euch alle. Und jetzt das Bier, Günter – bitte. Es war ein langer Weg, und es ist heiß bei euch, wie in der Hölle.»
Günter zapft das Bier und schweigt. Der Pfarrer starrt die Fremde an.
Als Günter das Bier auf den Tresen stellt, fragt er: «Du bist also zurückgekehrt?»
«Nun, das habe ich mir vorgenommen – ein Leben lang. Seit ich Überall verlassen habe», antwortet die Fremde.
«Warst du schon bei deinen Eltern?»
«Nein – und deshalb bin ich auch nicht gekommen.»
«Zum Wohl, Dorothea. Schön, dass du da bist.»
«Noch ein Kirsch, Günter», sagt Pfarrer Witte. Als der Wirt es dem Seelsorger vor die gefalteten Hände schiebt, hebt Dorothea ihr Glas und prostet ihm zu: «Zum Wohl, Herr Pfarrer.» Dabei schauen sich die beiden einen Moment lang tief in die Augen.
Deutschlands Provinz wird zur nationalen Gefahr.
Meist passiert es auf Vernissagen, in Theaterpausen oder während einer Besprechung in den Schickimicki-Restaurants der Metropolen – im Grill Royal in Berlin oder beim Käfer in München. Irgendwann, das ist so sicher wie das Läuten der Dorfkirche, beginnt irgendjemand von der Idylle der Provinz zu schwärmen. Er erzählt von einer besonders hübschen Antiquität, die er auf einem Bauernhof gefunden hat, vom letzten Urlaub, den er beim Klettern in den Alpen verbracht hat, oder von der Landpartie im neuen Cabrio. Architekten, Galeristen oder Chefredakteure stellen ihre Lofts mit Vintage-Möbeln voll, fahren mit Hermès-Decken zum Picknick oder mit Gucci-Stiefeln auf die Datsche. Sätze wie «Deutschland ist schöner, als man denkt» gehören zum Small Talk der Großstädter. Die Provinz war, ist und bleibt salonfähig.
Die Liebe der Städter zum Land ist kulturell angelernt. Seit jeher zeichnen Unterhaltungsromane ein verklärtes Bild der Provinz, Kino- und Fernsehfilme inszenieren die alltägliche heile Welt auf dem Lande. Im Dorf unserer Phantasie geht es hart, aber herzlich, ruppig, aber ehrlich, hinterwäldlerisch, aber bauernschlau zu. Hier befindet sich die psychologische Keimzelle unserer Gesellschaft. Hier versammeln sich die urdeutschen Tugenden: Fleiß, Redlichkeit, Stolz und Natürlichkeit. Aber hier schlummert auch die dunkle Seele unserer Nation: das Spießertum, die Ausgrenzung von Minderheiten und die naiv-patriotische Heimatliebe. Entweder ist das Land eine schöne heile Welt, die für ein paar Groschen als Roman zu haben ist, oder es wird zum Albtraum, der seinen Einwohnern – oder denen, die es werden wollen – teuer zu stehen kommt. Entweder leben die Dorfbewohner unterm wolkenlosen Sonnenhimmel, oder sie kämpfen sich durch Nebelschwaden, Berggewitter und Meeresstürme. Sowohl die Stimmungen auf dem Land als auch das Personal scheinen fest definiert. Es gibt «Dorfdeppen», die das Erbe von «Alexis Zorbas’» Idioten bis zum Behinderten aus dem «Weißen Band» antreten. Es gibt den Dorfarzt, der in die Fußstapfen von Professor Brinkmann aus der «Schwarzwald-Klinik» tritt, den Dorfpfarrer, der meist an «Pater Brown» erinnert, die Erben des «Dorflehrers Lämpel» und die Dorfbürgermeister, die für den Aufstieg ihrer Gemeinden in der Regel über Leichen gehen. Und natürlich dürfen die Dorfbauern nicht fehlen, die «Tonis» und «Jan-Hinnerks», die in Krimis gern unschuldige, menschliche Urgewalten mit harter Schale und weichem Kern abgeben. Doch mit der modernen Wirklichkeit auf dem Land hat all das nichts zu tun.
Pater Brown, Lehrer Lämpel und Professor Brinkmann haben die Provinz längst verlassen. Viele Bauern mussten ihre Gehöfte aufgrund der EU-Agrarpolitik aufgeben, oder ihre Betriebe wurden von Großagrariern aufgekauft. Der Bürgermeister ist oft nicht mehr für ein einzelnes Dorf zuständig, sondern für mehrere Ortschaften, und der demokratische Willensprozess der Gemeinden wird durch die kommunale Finanznot fast unmöglich. Der massive Mangel an Landärzten wird zwar überall als nationaler Notstand debattiert, aber noch immer kommt ein Großteil der Landpraxen kaum über die Runden, weil sie zu wenig Patienten und einen zu hohen Zeit- und Kostenaufwand bei den Hausbesuchen haben. Auch der Dorfpfarrer gehört schon lange nicht mehr zu den Instanzen auf dem Land. Der katholische Rheinische Merkur berichtet von kircheninternen Szenarien, nach denen jedes dritte der 24 000 deutschen Gotteshäuser mittelfristig in Frage steht. Im Osten der Republik ist der Kreuzzug bereits verloren, und auch im Westen verliert die Kirche auf dem Land zunehmend an Einfluss – allein im Bistum Essen wurden bereits 100 Kirchen geschlossen. Immer weniger Menschen sehen auf dem Dorf eine Zukunft für ihre Kinder und Familien. Viele Schulen wurden aufgegeben oder kurzerhand in die Kreisstädte oder in die Speckgürtel der Großstädte verlegt – mit ihnen verschwinden die Lehrer. Vom guten alten Romanpersonal der deutschen Provinz bleiben also nur noch die Alten und die Dorfdeppen zurück. Heile Dorfwelten gibt es fast nur noch im Fernsehen.
Die Fernuniversität Hagen hat herausgefunden, dass 25,3 Prozent der Haushalte auf dem Land mit einem Einkommen von unter 1300 Euro im Monat leben. In Großstädten liegt der Anteil der Geringverdiener bei nur 17,7 Prozent. Auch die Bildung ist auf dem Land wesentlich schlechter als in der Stadt. Während 30,4 Prozent der Landbevölkerung einen niedrigen Bildungsstand haben, sind es in der Stadt nur 26,4 Prozent. Noch deutlicher wird die Schere im Vergleich der klugen Menschen. Fast 30 Prozent der Städter haben einen hohen Bildungshintergrund, auf dem Dorf sind es nur 20 Prozent.
Dennoch ist der magische Mythos des Dorfes ungebrochen. Je komplizierter die Welt in den Städten wird, je weiter sich der Handel globalisiert und je unpersönlicher unsere Metropolen sind, desto mehr scheint das ideale Dorf als Modell einer heilen Welt herhalten zu müssen. Es erscheint wie eine letzte Trutzburg gegen die unaufhaltsame Globalisierung oder wie die Renaissance eines urromantischen deutschen Traumes. Aber das Dorf ist auch zu einer der größten modernen Legenden geworden.
So wie wir es uns vorstellen, hat jedes Dorf einen Tante-Emma-Laden, die Verkäuferin (natürlich mit weißer Schürze) kennt ihre Kunden persönlich und deren ganz spezielle Wünsche: fünf Scheiben Landschinken, ein Krustenbrot und 200 Gramm frischen Käse von Bauer Mayer – dann darf’s auch gern ein bisschen mehr sein. Im Zentrum steht die Dorfkneipe (natürlich rustikal vertäfelt und mit Stammtisch). Sie ist das allabendliche Ziel der Dorfgemeinschaft. Hier werden Freuden und Sorgen geteilt und am Ende des Tages der Ärger mit einem Korn heruntergespült. Außerdem hat das ideale Dorf eine funktionierende Nachbarschaft. Die junge Familie (natürlich mit zwei oder mehr Kindern) bringt der alleinstehenden Oma von nebenan eine Wasserkiste aus dem Supermarkt mit, und der Handwerker repariert kurzfristig die Heizungsrohre seines Nachbarn, wenn’s im Winter mal klemmt. Das ideale Dorf ist ein Fleckchen Erde, an dem jeder Tag zum Groschenroman wird. Ein Stückchen heile Welt, die viel zu schön ist, um wahr zu sein. Das ideale Dorf ist der Ort unserer Träume – und es existiert tatsächlich. Tante-Emma-Läden, Dorfkneipen und nette Nachbarn gibt es mitten in Deutschland. Allerdings kaum noch auf dem Land. Das ideale Dorf unserer Gegenwart heißt: Schöneberg. Einer der lebhaftesten Stadtteile Berlins.
Zugegeben, die Schöneberger Tante-Emma-Läden sind eigentlich 24-Stunden-Türken oder Feinkostläden mit exquisitem Käse- und Wurstsortiment. Die Dorfkneipe ist in Wirklichkeit eine Bar unter vielen, in der das Leben erst um Mitternacht beginnt. Und die Nachbarschaft findet nicht von Hof zu Hof, sondern von einer Altbau-Etage zur nächsten statt. Und trotzdem: Während der Geist des Guten in der deutschen Provinz nur noch spukt, feiert er ausgerechnet in den Metropolen seine Auferstehung. Die Großstädter bauen sich ihre eigenen intimen City-Villages, und so sind die Metropolen zu den vielleicht letzten Orten geworden, an denen das deutsche Landleben noch intakt ist.
Die Städter errichten ihre Dorfstrukturen sogar in der virtuellen Welt. Bei Facebook, Twitter und Co. finden die Cyberdorfbewohner Klatsch und Tratsch, jeder kennt hier jeden, solange er von den anderen Village-People «geaddet» wird. Das Dorf der Zukunft heißt Großstadt oder Community. Derweil kommt den echten Dörfern auf dem Land das Idyll abhanden. Ihnen gelingt es nicht, neue, reale Freunde zu «adden». Sie sind die Loser der Moderne. Wir haben es mit einer gigantischen Landflucht zu tun: Die klugen jungen Frauen sind bereits in die Städte gezogen, die klugen jungen Männer folgen ihnen. Die deutschen Dörfer sind hoffnungslos überaltert, zunehmend kriminell und in manchen Teilen des Landes kaum noch intakt.
Weite Teile Ostdeutschlands sind bereits entvölkert. Nach Berechnungen des Berlin-Instituts werden im Jahre 2020 schon 20 Prozent weniger Kinder im Vorschulalter in den neuen Bundesländern leben als 1991. Und auch in Westdeutschland stirbt das Land einen schnellen Tod. Teile von Hessen werden bereits «Deutsch-Sibirien» genannt, und nach einer Studie der NBank haben 40 von 49 Gemeinden in Südniedersachsen in den letzten Jahren massiv an Bevölkerung verloren. Leicht steigend sind nur die Einwohnerzahlen in der Nähe von Göttingen.
Auch kleineren Städten in der Provinz geht es inzwischen an den Kragen. Orte wie Hoyerswerda wollten nach der Wende eigentlich wachsen, haben ihre Plattenbauten saniert und stellen nun erschrocken fest, dass sie wieder schrumpfen müssen. Statt für 70 000 Menschen wie einst plant man inzwischen für 39 000 Bewohner und reißt einen Großteil der teuer sanierten Gebäude wieder ab. Ähnliche Trends sind in Halle, Magdeburg, Cottbus oder Neubrandenburg zu beobachten. Gelsenkirchen verzeichnet bereits eine Arbeitslosenquote von über 15 Prozent und rechnet damit, dass es bis 2020 11 Prozent seiner Einwohner verlieren wird – dann wird die Stadt an der Ruhr nur noch halb so groß sein wie 1959.
«Deutschland leert sich in seiner Mitte und an den Rändern», beobachtet das Berlin-Institut, und Susanne Dahm vom Karlsruher Uni-Institut für Städtebau prognostiziert: «Mittelfristig wird die Bevölkerung aller Bundesländer sinken, und es wird zumindest im europäischen Umfeld kein ausreichendes Zuwanderungspotenzial zur Verfügung stehen, um diese Entwicklung auch nur annähernd auszugleichen.» Deutschlands düstere demographische Zukunft ist auf den Dörfern bereits zum Alltag geworden.
Das Problem ist die Heterogenität der Provinz. Sie unterteilt sich heute in die klassischen Dörfer, die bereits tot sind oder im Sterben liegen, in die Kleinstädte, die mit massiven Finanzengpässen zu kämpfen haben, und in die neuen Pendlerdörfer und Speckgürtel, die zwar Wachstum verzeichnen, in denen das dörfliche Leben aber längst unter städtischen Vorzeichen abläuft. Sozialwissenschaftler behaupten, dass die Provinz in Deutschland gar nicht mehr existiert, dass jedes Dorf inzwischen Teil einer Metropolregion sei. Und tatsächlich orientieren sich Dörfer längst an den nächstgrößeren Orten und die größeren Orte an den Metropolen. Die Süddeutsche Zeitung warnt, dass die Provinz in die Randgebiete von München, Stuttgart, Hannover, Hamburg oder Leipzig wandere und sich hinter den Stadttoren schon jetzt ein «Ozean von Armut und Demenz» öffne. Es wird eine der wichtigsten Fragen der kommenden Jahre sein, ob wir die Provinz in Deutschland noch reanimieren oder ob wir sie vollkommen aufgeben wollen.
Derzeit tendiert die deutsche Politik zum Landsterben. In Niedersachsen bekommen Landgemeinden pro Bürger einen Euro aus Steuergeldern zugewiesen, während den Städten 1,80 Euro verrechnet werden. Statt dem finanziellen Ruin der Dörfer und der Abwanderung der Bevölkerung entgegenzuwirken, wird das Land ausgehungert und die Dorfflucht begünstigt. Durch die Gemeindereformen werden die kleinen Gemeinden gezwungen, sich an den Kreisstädten zu orientieren, und die Schieflage der Haushaltsstruktur zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sorgt dafür, dass die kommunalen Haushalte kaum noch Spielraum für eigene politische Perspektiven lassen. Bürgermeistern und Gemeinden fehlt das Geld, um ihre Heimat durch Investitionen attraktiver und zukunftsfähig zu machen. Die politisch gewollte Entprovinzialisierung des ländlichen Raumes ist ein Teufelskreis, der in Wirklichkeit zu einer weiteren Provinzialisierung führt und das Land zum neuen Krisenherd der Nation werden lässt: Das deutsche Dorf wird ärmer und dümmer und damit zum Brennpunkt der Zukunft.
Dabei war die Provinz stets das Herz der Nation. Noch immer wohnt fast die Hälfte aller Deutschen in ländlichen Regionen. 93 Prozent der Gemeinden und 80 Prozent der Fläche des Landes werden als ländlich eingestuft. Jenseits der Großstädte haben sich mehr als die Hälfte der 3,5 Millionen deutschen Betriebe angesiedelt. Doch die Landflucht ist unaufhaltsam. Und eins ist klar: Wenn die Provinz stirbt, gerät die ganze Bundesrepublik aus dem Gleichgewicht. Die Städte werden die wachsende Armut des Landes in Zukunft kaum noch aufnehmen können.
Doch all das hindert die Großstädter nicht daran, vom Bergdorf in den Alpen, vom Fischerdorf an der Nordsee oder vom Bauerndorf in Brandenburg zu träumen. Für sie bedeuten die aufpolierten Naturerholungsgebiete Potsdam, Tegernsee oder Sylt Idylle pur; hier wollen sie für einige Tage entspannen. Mit der Tristesse in Nordhessen oder weiten Teilen Mecklenburgs kommen sie selten in Berührung. Die Metropolen-Yuppies erheben selbst die Blumenzucht auf ihrem Balkon zum Wohlstandshobby und schreiben Bücher über die heile Welt auf dem Land: Ironische Reflexionen über die eigene Kindheit in der Provinz, Aussteigerbücher oder Erfahrungsberichte von professionellen Medienmachern, die sich als leidenschaftliche Freizeitbauern verwirklichen. Viele Städter setzen sich die rosarote Rosamunde-Pilcher-Brille auf, wenn sie an Land und Dorfgemeinschaft denken. Doch in Wirklichkeit lässt sich das Landleben in Deutschland nur noch als Gruselroman beschreiben – nur leider nicht so spannend.
Das real existierende Drama unserer Tage ist, dass die wachen Geister der Provinz, die uns in der Literatur, im Kino oder im Fernsehen begegnen, die Dorfgemeinschaft längst verlassen haben. In den Großstädten träumt man derweil weiter vom ländlichen Mythos. Deutschland hat seine Provinz im Stich gelassen. Die Demarkationslinie zwischen Arm und Reich, zwischen zukunftsfähigen Regionen und Landstrichen ohne Perspektive liegt heute nicht mehr zwischen Ost und West – sie verläuft zwischen Stadt und Land. Hier entwickelt sich die Lebenswirklichkeit der Deutschen auseinander. Und mittelfristig droht uns ein neuer Kulturkampf zwischen den immer mächtiger werdenden Städten und den zunehmend entrechteten Provinzen. Schon heute sind nicht die Ghettos der Großstädte die gefährlichen Krisenherde der Nation, sondern die Dörfer im deutschen Niemandsland. Wer über Integrationsprobleme von Migranten in Neukölln stöhnt, sollte sich einmal die Verdummung der Deutschen auf dem Land anschauen.
In Wollbach sieht alles nach heiler Welt aus – nur die Menschen sind weg.
Wenn man allein die Kulisse eines Dorfes betrachtet, kann man bereits viel über seine Einwohner erfahren. Welche Wege sie gehen, in welchen Gebäuden sie sich versammeln – die Dorfkulisse zeugt von der Lebensart seiner Bewohner. Deshalb suche ich auf meiner ersten Reise durch die deutsche Provinz keine Gesprächspartner, sondern bin als eine Art Gegenwartsarchäologe unterwegs, der das Landleben anhand der Architektur und der offensichtlichen Spuren seiner Bevölkerung rekonstruieren will. Mein Plan sieht vor, mir irgendein Dorf anzusehen, in einer Region, die nicht von Krisen geschüttelt ist. Ich will dorthin, wo das Landleben noch nicht erkennbar am Ende ist wie in Nordhessen, in Südniedersachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Meine Reise führt mich ins Markgräflerland, ins Dreiländereck an die Grenze zur Schweiz und zu Frankreich. Bei Efringen-Kirchen biege ich willkürlich von der A5 ab, passiere Schallbach und Rümmingen, aber keine dieser Gemeinden entspricht dem, wonach ich suche. In keinem dieser Orte finde ich typische Dorfstrukturen oder eine traditionell ländliche Architektur. Neubaugebiete und die Filialen von Billigmärkten haben das Idyll längst verdrängt. Und so ist meine erste Erkenntnis, dass es gar nicht leicht ist, ziellos durch Deutschland zu fahren, um heile Dörfer zu finden.
An einer Kreuzung nach Schallbach halte ich an, weil ich ein Holzkreuz am Straßenrand entdecke, vor dem ein Meer von Blumen und ein Dutzend Lebenslichter stehen. Als ich mir die Trauerstätte anschaue, sehe ich das Bild eines jungen Mädchens: schwarze Locken, große silberne Ohrringe, neugierige Augen. «LISA» ist in großen Lettern in das Holz gebrannt, vor dem Namen das Geburtsdatum: 03. 10. 1990. Hinter dem Namen das Todesdatum: 10. 03. 2010. Mich irritiert die mystische Anordnung dieser Zahlen und auch dass ich ausgerechnet am zweiten Oktober, also einen Tag vor Lisas 20. Geburtstag, auf diese Stelle stoße. Jemand hat zwei liegende Porzellanengel auf dem Querbalken des Kreuzes drapiert. Unter Lisas Bild vergilben in einem nicht wetterfesten Glasrahmen zwei Zitate aus «Herr der Ringe»: «Manche Dinge kann auch die Zeit nicht heilen, manchen Schmerz, der so tief sitzt und einen fest umklammert.»
Auf meiner Suche nach dem Landleben begegne ich also als Erstes dem Tod. Ein selbstgebasteltes Mahnmal, das von Lisas Familie und ihren Freunden vermutlich täglich besucht wird. Ein Ort, der Zusammenhalt symbolisiert, kollektive Trauer, Unverständnis über den Lauf der Welt. Ein Kreuz am Wegrand, das mich nicht ruhen lässt. Später habe ich in den Archiven der Zeitungen die Geschichte zu diesem Mahnmal herausgefunden: Lisa hat um halb acht am Morgen Schallbach in ihrem quietschgelben Renault verlassen. Auf der Landstraße überholte gerade ein silberner Ford einen Getränkelastwagen. Lisa übersah die Vorfahrt, der Ford raste in ihre Tür, sie starb noch am Unfallort. Ein typischer Verkehrsunfall auf dem Land: eine junge Pendlerin in ihrem Auto auf dem Weg in die Stadt. Eine Tragödie, die seit einem Jahr zur Kulisse des Lebens in Schallbach gehört.
Ich fahre weiter auf der L134, der sogenannten Kandertalstrecke, in Richtung Wollbach. Am Straßenrand sind Heuballen aufgestapelt und mit einer Plastikplane abgedeckt. Die Bauern haben aus den runden Seiten der Ballen mit gelben Plastikpunkten und roten Plastikstreifen lachende Gesichter gemacht. Als ich die Kirchturmspitze von Wollbach zur Rechten und den Bahnhof zur Linken sehe, beschließe ich, dass dieses Dorf der Anfang meiner Spurensuche sein soll.
Das Zentrum von Wollbach liegt auf der Westseite der Kandertalstrecke, die Häuser stehen an steilen, unübersichtlichen und schmalen Straßen, die auf einen Hügel hinaufführen, auf dessen Höhe sich nach zwei Kilometern das nächste Dorf befindet: Egerten. Die meisten Häuser in Wollbach sind alte Fachwerkhäuser und waren früher sicherlich in der Hand stolzer Bauern. Inzwischen sind die meisten der Gebäude reine Wohnhäuser. Weinbau und Ackerbau spielen in Wollbach kaum noch eine Rolle. Sie sind eher zum Hobby der Einwohner geworden, die ihre Erzeugnisse nicht zum Kauf in der Stadt, sondern vor der Tür ihres Hauses anbieten. Jeder kann sich Kürbisse oder anderes Gemüse nehmen und ein wenig Geld in die bereitgestellten Schachteln legen. Ich frage mich, wer dieses Angebot nutzt, schließlich steht vor fast jedem Haus ein solcher Stand.
Der Strukturwandel vom Landwirtschafts- zum Dienstleistungsdorf ist überall zu erkennen. Ein Holzhaus in der Dorfmitte trägt die Aufschrift «Herzlich willkommen im Pfaffenkeller». Daneben prangen ein doppeltes Wappen und die Jahreszahl 1618. Der landwirtschaftliche Betrieb von damals ist heute ein Restaurant, an dessen Fassade das grüne Bioland-Logo prangt. Die Speisekarte des «etwas anderen Restaurants» bietet eine Mischung aus lokalen Produkten wie Rinderfilet und moderner, mediterraner Küche, wie zum Beispiel gebratene Garnelen. Außerdem wird die «alte, fast vergessene, Markgräfler Küche» gepflegt: «Badische Ochsenbacken mit Knöpfli und Gemüse». Der Pfaffenkeller wirkt wie ein Etablissement, das gezielt Touristen ansprechen soll. Auf meinem Rundgang entdecke ich weitere ähnliche Restaurants.
Schon am Ortseingang von Wollbach weist ein Schild den Weg zum Max-Böhlen-Museum nach Egerten. Ich beschließe hinaufzuwandern, und schon nach einer halben Stunde stehe ich vor dem Haus des Landschaftsmalers. Sein Sohn und sein Enkel haben es zu einem Familienmuseum gemacht und hier, am Ende der Welt, das Gourmet-Restaurant Jägerhäuschen eröffnet, das Kochen und Kunst miteinander verbindet. Auf der Karte stehen «Gebratene Jakobsmuscheln auf einem Gemüsebeet mit Estragon-Noilly-Prat-Sauce und dazu Butterreis». Wichtig ist den jungen Köchen, dass sie den Schnickschnack der städtischen Schickimicki-Küche nicht mitmachen: Unter der Rubrik «Das gibt’s hier nicht» sind Froschschenkel, echter Kaviar, Schildkröten- und Walprodukte, Stopfleber und Hummer aufgelistet. Auf dem Weg zurück nach Wollbach passiere ich einen heruntergekommenen Hof, der einige Bierbänke aufgestellt hat und versucht, mit hausgemachtem Essen und Trinken Wanderer anzulocken, die den Naturpark Südschwarzwald durchqueren. Gegenüber steht ein weiteres Gehöft, der Kreiterhof, der mit einem handgemalten Schild darauf aufmerksam macht, dass er seit 1966 mit «frischen Weihnachtsbäumen» handelt. Die Wiese vor dem Hof erinnert an einen Schrottplatz: Eisenfässer stehen herum, ausrangierte Maschinen, ein altes Mühlrad und Gitterboxen, in denen Metall und unterschiedliches Brennholz gelagert werden. An der Fassade hängt ein verrosteter Basketballkorb, mit dem die Kinder des Kreiterhofs wahrscheinlich vor vielen Jahren zum letzten Mal gespielt haben.
Die gastronomischen Betriebe von Wollbach, der Pfaffenkeller, das Jägerhäuschen und der improvisierte Landhof, scheinen nicht für die Einheimischen zu kochen, sondern auf Touristen zu warten.
Beim Rundgang fällt auf, dass die Straßen und Häuser menschenleer sind. Es ist Freitagnachmittag, und die Wollbacher scheinen noch in Lörrach oder Basel zu sein und zu arbeiten. Wollbach ist ein Schlafdorf, das kaum Geschäfte hat: keine Post, keine Bank, keinen Geldautomaten. Im Zentrum, wo sich die Straßen kreuzen, steht eine alte Bäckerei, die sich Bachhysli nennt. Die Jalousien sind geschlossen, und über die vier Fenster ist der Spruch «Weil’s frisch besser schmeckt» mit Klebelettern angebracht. Darunter der Hinweis «Jeden Sonntag frische Brötchen von 8.00 bis 10.30 Uhr». Die Öffnungszeiten an der Tür («Dienstag bis Samstag 5.30 Uhr bis 12:30 Uhr») verraten viel über den Rhythmus des Dorfes – die Wollbacher sind Frühaufsteher! Das Bachhysli scheint das heimliche Zentrum des Dorfes zu sein. In den Schaufenstern werden auf zwei Zetteln der tigerfarbene Kater Felix und ein schwarz-weißer Kater, «der auf den Namen ‹Kleiner› hört», gesucht. «Wir sind umgezogen» steht unter dem Bild, «er ist noch etwas verwirrt. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie ihn irgendwo sehen, er fehlt uns sehr.» Das Bachhysli ist das Schwarze Brett und die Nachrichtenbörse von Wollbach. Hier spielt also am Morgen das Leben.
Neben der Bäckerei wirbt ein Poster für das «Feuerwerk der Volksmusik», ein Konzert, das im nahen Kurhaus von Badenweiler stattfinden soll. Chris Roberts wird kommen, die Wildecker Herzbuben und Anton aus Tirol. Außerdem plakatiert hier der Kunsthandwerksmarkt in Holzen, der Weberei, Tiffany, Patchwork, Floristik, Holzarbeiten und Malerei anbieten wird, und der Musikverein Wollbach, der zum Herbstfest in die Kandertalhalle lädt, zum Festgottesdienst, zu Chorkonzerten und zum Frühschoppenkonzert. Die Kandertalhalle ist ein nüchterner Zweckbau mit integrierter Dorfkneipe, dem Kandertalstüble. Hier wird hinter vergilbten Gardinen Stuttgarter Hofbräu ausgeschenkt.
Die Kirche thront groß, mächtig und evangelisch in der Ortsmitte. Im Pfarrgarten ist Friedrich Raupp gemeinsam mit seiner Frau Agnes begraben – der ehemalige Pfarrer von Wollbach starb 1899. Auf einem großen himmelblauen Zifferblatt der alten Kirchturmuhr wird für das Museum im Turm geworben – aber es ist geschlossen. Die Kirche scheint, neben dem Bachhysli, das gesellschaftliche Zentrum zu sein: Konfirmandengruppen, Kirchenchor, Krabbelgruppe, Jungschar und Kirchengemeinderat geben hier ihre Veranstaltungen bekannt. Im Schaukasten der Gemeinde wirbt ein Poster für eine Aufführung von Rossinis «Stabat Mater» in der Baseler Martinskirche. Und unter dem Bild eines bunten Gemüsetellers stimmt ein Gedicht die Gläubigen auf das Erntedankfest ein: «Ein Stück Brot in meiner Hand, mir gegeben, dass ich lebe, dass ich liebe, dass ich Speise bin für die anderen.» Die Konfirmanden werden zum Erntedankfest sammeln, nicht für Wollbach, sondern für die Kindertagesstätte Guter Hirte e.V. in Lörrach. Wollbach hat zwar eine große Grundschule, aber keinen eigenen Kindergarten und keine weiterführende Schule.
An der Hauptstraße verkehren zwei Buslinien der Südwestdeutschen Verkehrsaktiengesellschaft. Sie kommen aus Lörrach und Basel und fahren weiter nach Kandern. Auf der anderen Seite der Landstraße liegt der Bahnhof, ein kleines weißes Haus mit Satellitenschüssel und Geranienbalkon. Sechsmal am Tag hält die historische Dampflok der Kandertalbahn. Hinter den Gleisen wird Wollbach modern. Hier stehen der Sportverein mit Gaststätte und Fußballfeld und ein Neubau der Straßenmeisterei. Von hier aus werden 265 Kilometer Bundes-, Land- und Kreisstraßen betreut. Nur die alte Mühle, deren Mühlrad sich müde im Wasser dreht und die vor sich hin rottet, erinnert auf dieser Seite von Wollbach noch an die gute alte Zeit.
Auf meinem Weg zum Auto komme ich an einem merkwürdigen Haus vorbei, das aus einem Hügel hervorlugt. Der Giebel und die oberen Etagen sehen aus wie ein originales Schwarzwaldhaus, die Stockwerke darunter sind mit Solarpaneelen verkleidet, und unter alldem werden gerade neue Garagen gebaut. Eine Ingenieurgruppe für Solartechnik hat hier ihr Büro aufgeschlagen – eines der wenigen Unternehmen, die Wollbach als Standort gewählt haben.