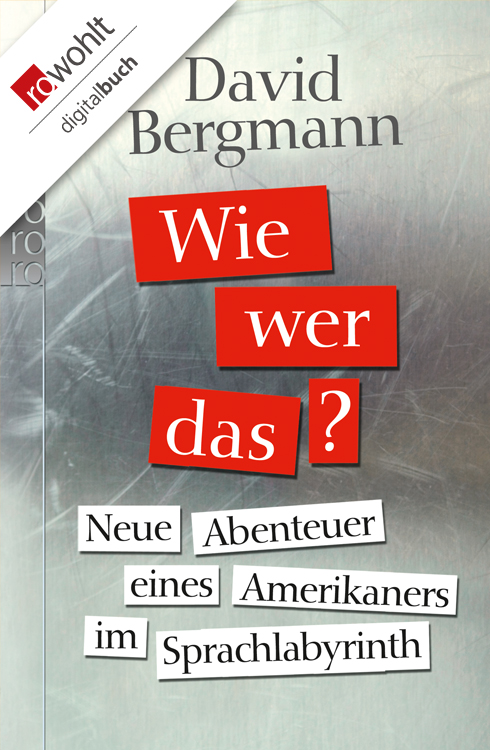
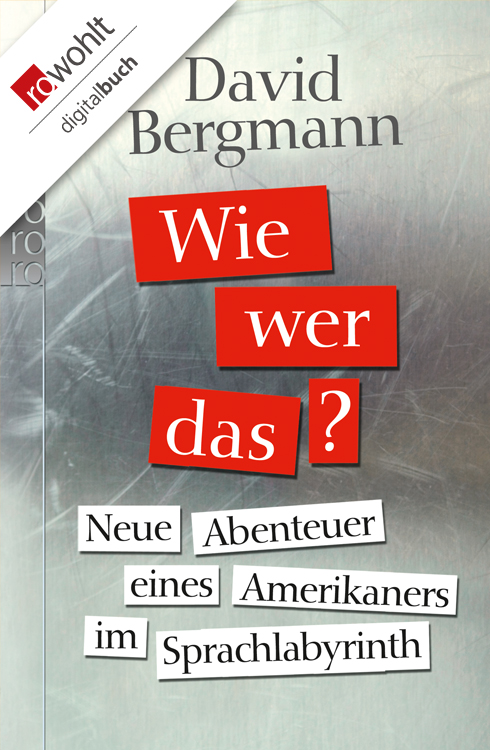
Wie, wer, das?
Neue Abenteuer eines Amerikaners im Sprachlabyrinth

Widmung
1 Die deutsche Inquisition
2 Harmonieren mit den Homonymen
3 Wer will schon seinen Scheiß backen?
4 Ich möchte betonen
5 Redewendungen und -drehungen
6 Ich dachte, du bist ein Native-Speaker?!
7 Der und Die sind dem Das sein Tod
8 Klingt cool!
9 Keineswegs nachrangige Nachsilben
10 Numerus Chaos
11 Uhrkomisch!
12 Liebesgrüße aus Deutschland
13 Das «Aha» und «Oje»
14 Feiertage zum Feiern
15 Die Großschreibung kleinkriegen
16 Radio-aktiv werden
17 Von Fräuleins und anderen Personinnen
18 Verständlich, jedoch nicht unmissverständlich
19 Total starke Verben
20 Das sagt man im Deutschen NICHT
21 Hier werde ich nicht geholfen
22 Please leave a message on my Kehlkopf
23 Donner, Blitzen, Milli, Vanilli, Arni und ich
24 So klingt man halt mal quasi irgendwie deutsch
25 Schönen Feierabend!
Dank
To my non-German-speaking friends and relatives: I realize that you are waiting for an English translation of my first book. But perhaps my second book in German will motivate you to learn more about this very cool language?
1
Am 6. September 1996 verließ ich freiwillig mein amerikanisches Heimatland in Richtung Süd-Niedersachsen, um ein Aufbaustudium an der Georg-August-Universität Göttingen zu beginnen. Während jenes ersten Jahres in Deutschland konnte ich die große Neugier der meisten Einheimischen bezüglich meiner Anwesenheit in ihrem Land mit einer relativ kurzen Erklärung befriedigen. Auf die übliche Frage: «Was hat dich nach Deutschland verschlagen?», antwortete ich nämlich in der Regel: «Ich wollte einfach ein Auslandsjahr hier absolvieren, um meinen Horizont zu erweitern.» Obwohl einige Deutsche diese Aussage eher skeptisch aufnahmen, sprengte sie zumindest nicht ihr Weltbild. Schließlich machen viele Deutsche ein Auslandssemester oder zwei, und das fast überall auf der Welt, sogar in vermeintlich trostlosen Gegenden wie Lappland, Sibirien oder Arkansas. (Zudem wirkte diese Antwort doch deutlich plausibler als: «Ein sehr starker Westwind …»)
Nach Ablauf meines ersten Jahres in Deutschland wurde die «deutsche Inquisition» allerdings zwangsläufig ständig schwieriger. Mein Aufbaustudium hatte ich schon nach einem lehrreichen Semester pleite abgebrochen, und ich wohnte mittlerweile in Hamburg, wo ich unter vielen Wirtschaftsprüfern in einem Bürogebäude arbeitete. Nach einiger Zeit konnte ich die inzwischen übliche Frage schon aus weiter Ferne auf mich zukommen sehen: «Wieso bist du denn immer noch hier?» Da ich nicht jedes Mal Zeit und Lust hatte, hierauf angemessen und ausführlich zu antworten, legte ich mir im Laufe der Jahre einige kurze Antworten zurecht, die das Verhör in der Regel im Keim erstickten:
«Ich mache ein Auslandsjahrzehnt.»
«Bis die schleppenden EU-Beitrittsverhandlungen mit den USA abgeschlossen sind, warte ich hier.»
«Ich will 200 km/h mit dem Auto fahren, ohne immer wieder in U-Haft zu landen.»
«Meine Kündigungsfrist in der Firma beträgt fünf Jahre zum Quartalsende.»
«Hier gibt es die meisten Deutschen.»
«Ich will in einem Land leben, in dem der Begriff ‹Bergmannsprämie› im Gesetz verankert ist.»1
«Zwei Silben: Schwarzbrot.»
«Ich erforsche, inwieweit amerikanisches Budweiser-Bier gegen das Reinheitsgebot verstößt – und das dauert.»
Es sind mir sogar noch einige etwas längere «dumme» Antworten eingefallen. Zum Beispiel sagte ich einmal: «Meine deutschen Vorfahren haben das Land, auf dem sich unsere Farm in den USA befindet, von den Indianern Mitte des 19. Jahrhunderts weder gestohlen noch gekauft, sondern lediglich geleast. 1996 lief der Vertrag ab, sodass ich zurück nach Deutschland musste.»
Noch weniger glaubwürdig war wohl die Antwort, die ich einem sehr politisch orientierten Deutschen gab: «Zur Zeit der Präsidentenwahl zwischen Gerald Ford und Jimmy Carter im Jahr 1976 war ich im Kindergarten. Als die Erzieherin nach unserer Meinung zum Wahlkampf fragte, antwortete ich: ‹Sollte eines Tages ein steinreicher texanischer Geschäftsmann mit dem Vornamen Ross in zwei aufeinanderfolgenden Präsidentenwahlen mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen erhalten, werde ich mich aus lauter Enttäuschung gezwungen fühlen auszuwandern, und zwar in ein Land, wo das Wort Ross Pferd bedeutet.› Als diese Voraussetzung dann im Herbst 1996 durch Ross Perot erfüllt wurde, zog ich nach Deutschland.» Erwartungsgemäß erwiderte mein Gesprächspartner nur: «Erzähl mir doch keinen vom Pferd!»
Schon eher glaubte man mir, als ich (ein ungewöhnlich ranker, schlanker Amerikaner) die Auskunft gab: «Kurz nach meinem 25. Geburtstag erhielt ich per Post von der amerikanischen Regierung die Aufforderung, entweder vor Ende des Kalenderjahres mindestens zehn Kilogramm zuzunehmen oder aber das Land zu verlassen. Ich schaffte nur fünf Kilogramm – und wohne seitdem in Deutschland.»
Während meine deutschen Gesprächspartner versuchen, diese Antworten zu verarbeiten, gehen unweigerlich ihre Augenbrauen in die Höhe, ihre Mienen werden skeptischer, und sie überlegen sich, ob ich sie etwa verarschen will. Diese Zeit der Unsicherheit nutze ich, um das leidige Gespräch wieder in die richtige Bahn zu lenken. Ohne meine kreativen Kurzantworten wäre ich manches Mal nämlich ganz schön aufgeschmissen, zum Beispiel wenn ich im Bahnhof eine Fahrkarte kaufen will und es dabei sehr eilig habe. Dann hat es verständlicherweise nicht die höchste Priorität, meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Folgende Situation ist nicht ungewöhnlich: Ein offensichtlich schon lange in Deutschland wohnender Ausländer, gut erkennbar aus der Ersten Welt kommend, steht am Schalter eines ländlich gelegenen, verschlafenen Bahnhofs und sagt: «Ich hätte gern eine einfache Fahrkarte nach Hamburg.». (Der Zug steht bereits auf Gleis 1 und soll in drei Minuten abfahren.)
Eingeborener Verkäufer: «Sind Sie Engländer?»
Freundlich, aber bestimmt auftretender Ausländer: «Nein, ich komme aus den USA, aber ich habe es jetzt relativ eilig. Könnte ich bitte das Ticket kaufen?»
Eingeborener Verkäufer: «Das ist aber komisch: Ich war mir eigentlich sicher, dass Sie Engländer sein müssten. Woher kommen Sie denn aus den USA?»
Angespannter Ausländer: «Chicago. Äh … sollte ich diesen Zug nicht kriegen, müsste ich zwei Stunden hier auf den nächsten warten …»
Eingeborener Verkäufer: «Ich war auch schon einmal in Chicago. Der Flughafen war gigantisch, die Autos waren riesig und die Pistolen der ausgiebig gepolsterten Polizisten enorm. – Nein, wenn Sie den Zug verpassen, müssen Sie drei Stunden hier warten. Und was machen Sie dann schon so lange hier in Deutschland?»
Verzweifelter Ausländer: «Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber …». (nicht mehr hörbar wegen des Lärms des gerade abfahrenden Zuges auf Gleis 1).
Natürlich will ich mich nicht jedes Mal bei einer drohenden «deutschen Inquisition» sofort aus dem Staub machen, denn es ist ja schließlich immer auch etwas schmeichelhaft, gefragt zu werden, wieso man überhaupt da ist. Man wird auf diese Weise immerhin wahrgenommen, was für das Ego gar nicht so schlecht ist. Wenn ich bei einer sich anbahnenden Fragestunde nicht sofort das Weite suche, nutze ich daher die Zeit, die mir eine meiner ausgewählten Kurzantworten üblicherweise verschafft, um mich seelisch auf das Folgegespräch vorzubereiten. Dies kann dann durchaus interessant sein und auch in der Länge sehr variieren, ist aber leider niemals abschließend. Es gibt so viele Gründe für einen Menschen, sich längerfristig mit dem deutschsprachigen Raum und der dort vorherrschenden Sprache zu beschäftigen, dass man dies niemals in nur einem Gespräch erklären kann. Man braucht dafür schon ein ganzes Buch – was mich dann auch direkt zu dem vorliegenden Werk bringt.
2
In wohl jeder lebendigen Sprache der Erde gibt es Wörter, die gleich klingen und auch gleich buchstabiert werden, jedoch sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese etwas überstrapazierten Wörter heißen Homonyme. Ein Beispiel im Deutschen ist das Wort «Strauß», dessen Mehrdeutigkeit mir klarwurde, als mir ein Bekannter sagte, er wolle seiner Freundin zum Geburtstag einen Strauß schenken, und ich ihn fragte, ob sie denn genügend Platz für so einen Riesenvogel hätte. Daraufhin schaute er mich an, als ob ich einen Vogel hätte.
Sollten die Wörter nur gleich klingen, jedoch unterschiedlich buchstabiert werden, heißen sie hingegen Homophone. Bei diesen hat man zumindest beim Lesen weniger Verwechslungsprobleme; die Gefahr bleibt aber beim mündlichen Kommunizieren bestehen. Ein Beispiel sind die Wörter «vage» und «Waage». Welches eigentlich gemeint ist, wage ich manchmal nicht einmal zu fragen …
Da diese sogenannten Homowörter das Risiko von Missverständnissen erhöhen, würde man eigentlich erwarten, dass die großen Kultursprachen dazu neigen würden, diese Wörter zu vermeiden beziehungsweise durch Neuschöpfungen zu ersetzen. Merkwürdigerweise ist dies jedoch weder im Englischen noch im Französischen der Fall. Die englische Sprache verfügt zum Beispiel über eine viel höhere Anzahl von Homonymen und Homophonen als die deutsche, auch wenn Englisch den größten Wortschatz aller Sprachen hat. Ein Beispiel ist das Verb «to spoil», das sowohl «verderben» als auch «verwöhnen» bedeutet! Weitere bekannte Beispiele sind die Wörter «there», «their» und «they’re», welche trotz unterschiedlicher Schreibweisen und Bedeutungen alle genau gleich ausgesprochen werden. Und sollte man einen Englischlehrer nach dem Grund für so etwas Unlogisches fragen, bekommt man sogar oft noch zu hören: «There, there!». (Na, na!)
Noch extremer ist die Lage im Französischen, wo es zahlreiche gleichklingende Wörter gibt, die mehrere Bedeutungen haben. Zum Beispiel werden die Wörter «vain». (eitel), «vint». (kam), «vin». (Wein) und «vingt». (zwanzig) alle gleich – etwa so wie «wä» – ausgesprochen! Als mir meine liebe Bekannte Claire mal wieder erzählte, dass Französisch die schönste Sprache der Welt sei, bat ich sie, den folgenden Satz ins Französische zu übersetzen: «Der eitle Franzose kam mit zwanzig Flaschen Wein.» Für mich klang das Resultat wie das Geschnatter einer energischen Ente.
Obwohl es im Deutschen weniger dieser Doppeldeutigkeiten gibt, lauern auch hier einige überstrapazierte Wörter, die Deutschlernenden Probleme bereiten. Im Folgenden einige der üblicheren Verdächtigten:
Schätze
Auch wenn ich das Wort «Schätze» schätze, schätze ich, dass es im deutschen Wortschatz leicht überschätzt wird.
Schein
Der Schein trügt nicht: Scheinbar kann die deutsche Sprache eine große Scheinwelt sein. Mir scheint es, dass nicht nur Studenten Scheine machen. Wenn man den Schein gut wahrt, kann man als ein Scheinheiliger bezeichnet werden. Man muss nur aufpassen, dass man nicht nach dem Motto «Mehr Schein als Sein» agiert. Meine Lieblingsantwort auf die Frage: «Ist dort gerade ein sonniger Tag, wo du bist?», lautet: «Ja, es scheint so!»
sie
Oft kann das Wort «sie» ein Buch mit sieben Siegeln sein. Sagt mir zum Beispiel ein Mann: «Ach, wenn ich sie wäre!», weiß ich nicht zwangsläufig sofort, ob er dabei mich meint, eine Frau oder vielleicht irgendeine unbestimmte Anzahl von anderen Dingen. Siehste?
klatschen
Manchmal erfährt man etwas dermaßen Interessantes beim Klatschen über andere Leute, dass man dabei spontan laut klatschen will.
Zug
Im Zuge der Zeit bemerkt der Deutschlernende Zug um Zug die Zugkraft des Wortes «Zug». Man kann schließlich in einem Zug im Zug in einem Zug in Zug sein Getränk austrinken (zumindest wenn man in der Bahn mit offenem Fenster durch die deutschsprachige Schweiz fährt). Deutsche Züge haben viele Vorzüge: Man fährt in Schnellzügen sowie Bummelzügen bequem umher und erfährt dabei sogar manchmal, was die Phrase «das Leben in vollen Zügen genießen» eigentlich bedeutet. Es gibt sogar eine Art «Zugsprache». Zum Beispiel ist der Bahnhof in Frankfurt ein Sackbahnhof, dafür aber keine Sackgasse. Und wenn man den Zug verlassen will, sagt man «Aussteigen!» – und NICHT «Auszug!». Sonst könnten die Mitreisenden ja denken, dass man einen Zug ins Lächerliche hat …
unter
Beim Wort «unter» werden nicht nur Ausländer irritiert, sondern auch Kinder, was mir an meinem ersten Weihnachten in Deutschland auffiel. Als der Familienvater nämlich erzählte, dass «das Christkind nun unter uns wohnt», fragte seine junge Tochter, ob es ein neues Schlafzimmer im Keller gebe.
reizen
Wenn mir jemand sagt, dass ihn etwas reizt, weiß ich nie, ob ich ihn nun beneiden oder bemitleiden soll.
Zeug
Manchmal wirkt die deutsche Sprache leicht überzeugt. Man hat alle möglichen Arten von Zeug: altes Zeug, solches Zeug, dieses Zeug und dummes Zeug. Als Kind hat man seine Spielzeuge, als Erwachsener seine Werkzeuge, und über beiden fliegen die Flugzeuge. Im Deutschen gibt es Zeughäuser, Zeugämter, Zeugenbänke und Zeugenstände. Und keiner freut sich über das Ablegen eines falschen Zeugnisses. Also, man legt sich ins Zeug, was das Zeug hält.
kosten
Wenn der Menageriebesitzer sagt: «Dieser Löwe hat mich leider zu viel gekostet», weiß man lediglich anhand der Narben und fehlenden Glieder, dass es sich dabei nicht um den Preis des Löwen handelte.
einstellen
Pessimisten behaupten seit Jahren, dass sehr viel in Deutschland eingestellt wird. Ich stimme ihnen zu, aber nicht weil es der Wirtschaft schlechtgeht, sondern weil das Wort «einstellen» überall auftritt … Dessen Vielfältigkeit wurde mir erst bei meiner Einstellung als Praktikant bei der Firma Wirtschaftsprüferpalast (kurz WP-Palast) in Hamburg im Januar 1997 bewusst. Zu jener Zeit hatte ich leider noch keine Arbeitserlaubnis. Die Firma war einfach davon ausgegangen, dass ich als Student für einen Hungerlohn arbeiten dürfte. Das Arbeitsamt hatte aber eine andere Einstellung, sodass WP-Palast deswegen Strafe bezahlen musste, während ich verschont blieb, was mir das Arbeitsamt später wie folgt mitteilte: «Herr Bergmann, das Verfahren gegen Sie wird eingestellt.» Ich wusste zunächst nicht, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Erst nachdem ich das Schreiben meinem damaligen Mitbewohner Bodo gezeigt hatte, verstand ich die Einstellung des Arbeitsamtes. Glücklicherweise entschied sich meine Firma daraufhin nicht für einen Ausländereinstellungsstopp, denn schließlich war ich inzwischen auf bezahlte Arbeit eingestellt …
***
Zum Glück war es dann Aufgabe meiner Firma, mir eine Arbeitserlaubnis für den Start als Festangestellter zum 1. Mai 1997 zu besorgen. Die Beschaffung dauert in der Regel ein paar Monate, da sich das Ausländeramt zuerst einmal in allen Ländern der EU erkundigen muss, ob es nicht doch eventuell irgendwo einen EU-Bürger gibt, der die Voraussetzungen für die offene Arbeitsstelle erfüllt. Für meine Stelle gab es bestimmt viele, auf die dies zutraf, allerdings war offenbar keiner von denen arbeitslos – oder sie hatten einfach keine Lust, sich unter so vielen Wirtschaftsprüfern aufzuhalten. Auch wenn ich schon ein wenig neugierig war, entschied ich mich doch dagegen, den Obdachlosen vor dem Ausgang des WP-Palastes zu fragen, ob sich das Ausländeramt wegen meiner Stelle auch bei ihm erkundigt hatte.
Ein paar Monate später bekam ich aus Versehen meinen Antrag auf Arbeitserlaubnis in die Hände – und war erstaunt, was ich doch alles konnte! Ich habe mich selbst kaum wiedererkannt. Mit einer Kopie davon wollte ich sofort neue Gehaltsverhandlungen starten, bis die Personaldame mir erklärte, dass «leichte» Übertreibungen seitens der Firmen üblich seien, um so das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Dann warf sie einen Blick auf das Papier in meiner Hand und sagte: «Na ja, manchmal reicht eine ‹leichte› Übertreibung eben nicht aus …»
In jenem ersten Jahr bei der Arbeit hatte ich noch mächtig mit den Homonymen zu kämpfen. Als mich einmal ein Kollege informierte: «David, der Kopierer ist nun repariert. Du kannst ihn jetzt anmachen», fragte ich ihn etwas verwundert: «Meinst du, ich kann ihn beschimpfen, jetzt, wo er wieder gesund ist?» Darauf erwiderte er: «Nein! Nicht so anmachen! Das andere ‹Anmachen›!» Ich zuckte die Schultern und begab mich, leicht skeptisch, zum Kopierer: «Ähm … he, du süßer Kopierer, machst du mir mal ein paar heiße Kopien?» Der Kollege seufzte verzweifelt: «Nein! Auch nicht so ‹anmachen›! Das Ding einfach einschalten!» Ach so … (Zum Glück gab es keine Salatsoße im Raum …)
Beim Wort «lecken» erging es mir ähnlich. Eine Kollegin erzählte mir, dass es ihrer Katze nicht gutginge, und ich fragte, woran sie das merken würde. Sie antwortete, dass ihre Katze lecke, worauf ich erstaunt erwiderte: «Aber alle Katzen lecken doch!» Ihre Antwort: «Ja, aber meine Katze leckt nicht nur mit dem Maul, sondern auch am anderen Ende.» Diese Vorstellung fand ich alles andere als lecker …
Das Wort «Spitze» fand ich damals auch sprachlich etwas auf die Spitze getrieben. Einmal, auf dem Weg aus der Mittagspause zurück ins Büro, zog mich ein Schaufenster magisch an, in dem vier hübsche, nur mit Dessous bekleidete Frauen standen. Offenbar waren sie Teilnehmerinnen eines Modell-Wettbewerbs. Obwohl die deutsche Sprache in dem Moment wahrlich nicht die höchste Priorität in meinem Kopf hatte, fragte ich meine Kollegin doch neugierig, wie der Stoff auf Deutsch hieß. Sie zeigte auf einen BH und sagte: «Das ist Spitze.» Ich dachte, sie wollte mich damit anspitzen, und erwiderte: «Ich finde es auch spitze, aber wie heißt das Zeug?»
Die meisten Probleme hatte ich allerdings mit dem Wort «Anlage», denn offenbar ist das «Anlagevermögen» der deutschen Sprache anlagebedingt. Von ganz kleinen Sachen wie Stereoanlagen oder EDV-Anlagen bis hin zu großen Dingen wie Grünanlagen, Parkanlagen, Sportanlagen oder Sanitäranlagen: Überall, wo man hinschaut, gibt es eine Art Anlage. Und immer wieder wird die Anlage weiterer Anlagen beschlossen. Um da durchzublicken, brauchte ich lange Zeit einen «Anlageberater» …
Aber im Laufe der Zeit wurde ich langsam besser im Spiel mit den Homonymen. So zum Beispiel als eine Managerin sich verzweifelt über die mangelnde telefonische Erreichbarkeit ihrer etwas korpulenten Sekretärin bei mir beschwerte: «Meine Sekretärin nimmt einfach nie ab!» Mit meinem arglosesten Gesicht erkundigte ich mich: «Meinst du das Telefon … oder grundsätzlich?» Sie schaute erst mich und dann das Telefon an, bis sie schließlich sagte: «Vielleicht besteht doch noch Hoffnung für dich hier in Deutschland …» Das nahm ich ihr gern ab!
Ich fing sogar an, mit den Homonymen kreativ zu werden, und dachte mir ein paar neue Wörter aus:
Loslos Was man ist, wenn man kein Lotto spielt.
Festfest Tanzfest, trinkfest und fressfest in einem Wort.
Ebeneebene Das Gegenteil von einer schiefen Lage.
Preispreis Wie viel es einen kostet, um etwas zu gewinnen.
Rockrock Was Nena auf der Bühne zusammen mit einem «Toptop» trägt.
Na ja, manchmal geht die sprachliche Kreativität eben etwas mit mir durch. Zumindest sorgte der folgende Witz bei den Einheimischen kaum für Lacher: Wie nennt man im Deutschen eine schnelle Gruppe von Schiffen? Eine flotte Flotte! Hahaha …
Im Gegensatz zur Arbeitserlaubnis war ich bei der Beantragung auf Verlängerung meiner Aufenthaltsgenehmigung leider ganz allein auf mich gestellt. Im Herbst 1997 hatte ich das Vergnügen, in der Warteschlange vor dem Ausländeramt zwischen einem Serben und einem Iraker zu stehen. Die beiden hatten herzlich wenige Gemeinsamkeiten – abgesehen von schlechten Deutschkenntnissen und einer Abneigung gegen den «großen Satan». (auch bekannt als mein Heimatland, die USA). Nichtsdestotrotz fanden sie mich irgendwie sympathisch, was daran gelegen haben mag, dass ich so tat, als sei ich Kanadier. Nach einiger Zeit war die Stimmung sogar so gut, dass wir uns gegenseitig etwas aufzogen. Der Iraker fragte mich, wie es sei, aus der größten Kolonie der Welt zu kommen. Der Serbe wollte seinerseits wissen, wie viele «Kanada-Dollar» man für einen «echten Dollar» bekäme. Es machte richtig Spaß. Nach einer Weile fing ich langsam an zu begreifen, weshalb viele Deutsche die Einwohner der kleinen deutschsprachigen Länder beneiden. Schließlich haben es Österreicher, Schweizer und vor allem Luxemburger und Liechtensteiner in manch potenziell heiklen Situationen eindeutig leichter.
Viel schneller habe ich hingegen begriffen, wie das Wort «ziehen» bei den Deutschen erstaunlich oft und in unterschiedlichster Weise zieht. Als ich mit den beiden anderen in unserem Bunde endlich ins Ausländeramt eingezogen war, machte der Serbe im muffigen Warteraum ein Fenster auf. Es dauerte wie erwartet nur wenige Sekunden, bis der Schrei von einem einheimischen Beamten kam: «Es zieht!» Als Ausländer lernt man zwar sehr früh, dass die Deutschen frische Luft schätzen (schließlich sitzen sie gerne bei 15 Grad zitternd draußen vor Cafés und gehen fröhlich während eines Orkans am Strand spazieren), jedoch sollte man sich nicht täuschen lassen: Frische Luft kann auch der Feind sein!
Am besten ist dieser Widerspruch der deutschen Mentalität in einer dunstigen Kneipe zu beobachten. Selbst wenn die Luft dort obermuffig ist: Sobald man ein Fenster nur ein bisschen aufmacht, werden die Gäste obermuffelig, und wie aus einer Kehle ertönt der Schrei: «Es zieht!» In Panik wird das Fenster sofort wieder zugemacht. Jedoch scheint es in Deutschland tatsächlich überall zu ziehen: Beim Schachspielen zum Beispiel fragt man: «Wer zieht?», und wenn man zu lange gespielt hat, kann es im Rücken ziehen. Während die Jahre ins Land ziehen, zieht man durch die Welt, in den Krieg oder einfach zu Hause an der Pfeife. Außerdem zieht man Kinder groß, Computerprogramme schwarz, Wein in Flaschen und Perlen auf eine Schnur. Bei diesen vielen Möglichkeiten kann der Deutschlernende manchmal nur eins machen: die Schulter hoch- und die Stirn krausziehen. Aber wenn er wie ein Einheimischer wirken will, muss er nur nach einem offenen Fenster Ausschau halten und schreien: «Es zieht!»
Zum Glück musste ich nur einmal im Jahr zum Ausländeramt ziehen – und nicht bei jedem Umzug. Der Umstand, dass man sich bei jeder räumlichen Veränderung «an-, ab- und ummelden» muss, war für mich als Amerikaner schon etwas ganz Neues. Schließlich muss man sich in den USA nirgendwo melden, wenn man umzieht. Eigentlich muss man sich dort überhaupt niemals melden. Die amerikanischen Behörden wussten zum Beispiel nicht einmal, dass ich das Land verlassen hatte – bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine Steuererklärung abgab. Und es gibt in den USA auch keinen Personalausweis. Hin und wieder wird zwar von der Regierung ein Vorstoß in diese Richtung gewagt, in der Regel dann allerdings schnellstens wieder zurückgerudert, da die Wähler so etwas sehr persönlich nehmen.
In der Warteschlange beim Ausländeramt träumte ich von dem Tag, an dem ich eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen würde, was zur Folge hätte, dass ich auch keine Arbeitserlaubnis mehr brauchen würde. Ich schätze, so einen Schatz würde ich wirklich zu schätzen wissen!
3
Diese arglose Frage stellte ich im Dezember 1997 Wolf, einem strengen Prüfungsleiter meiner Firma. Wie schon so viele andere Fragen von mir kam auch diese bei ihm nicht richtig gut an. Kurz zuvor hatte er nämlich im Hinblick auf den Mitarbeiter eines Mandanten missmutig geknurrt: «Er kriegt einfach seinen Scheiß nicht gebacken …»
Seinen Prüfungsassistenten gegenüber war Wolf manchmal so hart, dass man das Gefühl hatte, man würde durch den Wolf gedreht. Nur die niedlichen Kolleginnen hatten es in seiner Gegenwart relativ leicht – im Umgang mit ihnen war er eher ein Wolf im Schafspelz. Leider waren die Damen nicht besonders «schafsinnig». Hätte er tanzen können, wären Wolfs Chancen bei den Frauen vielleicht besser gewesen. Als ich dieses Thema irgendwann einmal ansprach, verzog er entsetzt das Gesicht. Offenbar wollte er kein «Steppen-Wolf» sein – wahrscheinlich fürchtete er, sich beim Tanzen wie ein «Deppen-Wolf» vorzukommen. Auf meinen Vorschlag erwiderte er jedenfalls: «So einen Scheiß mache ich nicht.»
Im Grunde genommen hätte ich mich also gar nicht so sehr über die Sache mit dem Scheißebacken wundern sollen, denn schließlich arbeiten in der deutschen Geschäftswelt jede Menge wortgewandte, hochqualifizierte und eloquente Menschen, die einfach viel Mist reden.
Ein typisches «Scheißgespräch» könnte wie folgt aussehen:
Wolf: «Komm hier nicht auch noch angeschissen, Jörg! Ich habe momentan so viel Scheiß bei mir auf dem Schreibtisch, und ich will den endlich mal ausmisten.»
Jörg: «Mach keinen Scheiß, Wolf!»
Wolf: «Ich verscheißere dich nicht. In der Steuerabteilung hat die Klugscheißerin Monika Mist gebaut, und jetzt ist hier die Kacke am Dampfen.»
Jörg: «Scheiß drauf, Wolf! Sag’s dem Manager, dem Mistkerl! Oder hast du Schiss davor?»
Wolf: «Nee, das ist eine beschissene Idee. Dann denkt er, der ganze Shit sei auf meinem Mist gewachsen, und dann habe ich selbst den ganzen Scheiß an der Backe.»
Jörg: «Ach du Kacke, das stimmt. Und dann würdest du noch tiefer in der Scheiße sitzen.»
Wolf: «Ach, scheiß auf alles!»
Und diese Ausdrucksweise war für einige meiner Kollegen offenbar stinknormal! Ich schien der Einzige zu sein, der sich daran störte. An einem Tag im Spätherbst 1997 platzte mir in einer größeren Arbeitsgruppe schließlich der Kragen, und ich rief verärgert in die Runde: «Meine Fresse!» – was ich noch verhältnismäßig harmlos fand. Doch plötzlich wurde es mucksmäuschenstill im Raum, und alle schauten mich an. Ein Kollege schüttelte vorwurfsvoll den Kopf: «David, so was sagt man aber nicht!» Bei mir lag offenbar ein Missverständnis vor – wenn auch kein «Mistverständnis».
Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Schließlich kommt es auch bei uns Englischmuttersprachlern selten gut an, wenn Nichtmuttersprachler «unsere» Schimpfwörter benutzen. Bei den harmloseren Kraftausdrücken mag es noch akzeptabel sein (so wie wenn ich «Mistkram» im Deutschen sage), aber beim stärkeren Zeug geht es gar nicht, besonders nicht das sogenannte «F-Word». Wenn ein Ausländer dieses Wort benutzt, wird uns sofort unbehaglich, irgendwie wird der «Schuldige» in unseren Augen dabei sozial abgestuft. Ungerecht? Ja. Unwahr? Nein.
Auch wenn ich es wohl immer total doof finden werde, wenn Deutsche englische Kraftausdrücke benützen, habe ich mich mit der Zeit an die deutsche Ausdrucksweise gewöhnt. Ich konnte mir sogar relativ schnell vorstellen, dass bei der Arbeit Mist gemacht werden kann. Etwas länger brauchte ich hingegen, bis ich mir vorstellen konnte, wie Mist gebaut und verzapft wird. Und ich habe immer noch Probleme damit, mir bildlich vorzustellen, was es heißt, Mist zu fahren. (Wenn überhaupt, geht das vermutlich am besten mit einem Mistkäfer.)
In meinem Freundeskreis in Hamburg lief es ganz ähnlich. Dort benutzte eine Norddeutsche namens Petra gern Kraftausdrücke bis zum Erbrechen, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Obwohl sie hochintelligent war und über einen großen Wortschatz verfügte, kamen oft Sätze über ihre Lippen wie «Das kotzt mich wirklich an!», «Ich kriege Kotzkrämpfe!», «Es ist zum Kotzen!», «Ich kotze teilweise ab!» und «Ich könnte einen Kotzanfall kriegen!». Wenn wir später nachfragten, wie es ihr inzwischen ginge, antwortete sie etwas wie in der Art: «Ich war bei meiner Schwester, wo ich ihr von einem bestimmten Großkotz erzählte, der mich neulich angekotzt hatte, und nachdem ich mich dann ordentlich auskotzte, ging es mir auch besser.» Ihre Ausdrucksweise änderte sich jedoch schlagartig, als wir Ausländer im Freundeskreis anfingen, sie scherzhaft «Frau Kotz» zu rufen.
Viel lustiger fanden wir die Redewendungen von Petra, die das Wort «Backe» enthielten. Relativ uninteressant war noch ihre Aussage: «Kann ich nicht: Ich habe zu viel Arbeit an der Backe.» Witziger wurde es jedoch bei: «Nein, den Typ an der Bar spreche ich lieber nicht an, sonst habe ich ihn die ganze Zeit an der Backe.» Oder: «Ich bin gestresst, da ich so viel Mist an der Backe habe.» (Und das hörte sich für uns in der Tat etwas stressig an.) Dank Petra wurde in unserem Freundeskreis sehr oft mit einem breiten Lächeln gesagt: «Kann ich jetzt nicht: Kacke an der Backe!» Zum Glück konnte Petra zu unserer Unterhaltung Redewendungen auf einer Backe aus dem Ärmel schütteln.
Über jemanden in einer unglücklichen Situation sagen Deutsche häufig, dass er «die Arschkarte gezogen hat». Allerdings wissen relativ wenige, wo diese Redewendung eigentlich herkommt. Als Fußballspiele noch im Schwarzweißfernsehen übertragen wurden, konnten die Zuschauer nicht erkennen, ob vom Schiedsrichter eine gelbe oder eine rote Karte gezogen wurde. Man kam also auf die Idee, die roten Karten in die Hosentaschen zu stecken. Hätte man das jedoch umgekehrt gemacht, würde die Redewendung heute lauten: «Boah, der Typ hat ja die Brustkarte gezogen!»
Apropos «Po». Zu jener Zeit erweiterte sich mein Wortschatz um ein besonders knackiges Wort: «Popo». Es war mir ja schon aufgefallen, dass Deutsche oft Ausdrücke mit dem Wort «Arsch» benutzen. Dieses Wort wollte ich selbst nicht verwenden, aber dennoch mitreden können. «Popo» war meine Lösung! An der Kasse im Supermarkt hatte ich dieses poetisch wirkende Wort auf der Titelseite mehrerer Frauenzeitschriften gesehen. Mit viel Freude benutzte ich fortan Sätze wie: «Das ist für ’n Popo», «Ich bin hier am Popo der Welt», «Ich werde ihm den Popo aufreißen», «Leck mich am Popo!» und «Ich habe ihn am Popo gekriegt». An der Lautstärke des darauf stets einsetzenden Gelächters wurde mir jedoch schnell und unmissverständlich klar, dass ich mit dieser «Lösung» wohl die «Popokarte» gezogen hatte.
Wie das Gesäß, das recycelte Essen und die gewisse braune Masse, so ist auch der Bock im deutschen Sprachgebrauch allgegenwärtig: Man hat ihn, man schießt ihn oder man macht ihn zum Gärtner. Er steht sogar in den Sternen, genauer gesagt: den Sternzeichen. Ich bin Krebs, was ich nicht sonderlich schön finde, denn im Deutschen bin ich so entweder eine tödliche Krankheit oder ein kleines Tier, das leicht von einem Steinbock zertreten werden könnte. Manchmal habe ich allerdings den Eindruck, dass einige Leute vom Sternzeichen her eigentlich «Keinböcke» sind. Egal, was ihnen vorgeschlagen wird, sie geben stets nur Variationen derselben Antwort: «Ich habe keinen Bock dazu», «Ich bin total bocklos», «Ich habe absolut null Bock darauf» oder «Ich bin in Bocklosigkeit verfallen». So weit es geht, mache ich als Krebs um solche Böcke einen großen Bogen.
***
Da ich in meinem ersten Jahr in Deutschland bei der Arbeit in Hamburg keinen großen Bogen um den im Sternzeichen Steinbock geborenen Wolf machen konnte, stellte ich ihm ohne Ende Fragen, um ihn so von krebszertretenden Aktivitäten abzulenken. Zum Beispiel wollte ich vom Wolf wissen, wieso der «Scheiße bauende» Mitarbeiter nicht schon längst gefeuert worden sei. Er antwortete: «Der ist ja unkündbar!», woraufhin ich wissen wollte, ob sein Vater die Firma besäße. Wolf erklärte: «Nein, er ist im Betriebsrat. Dazu ist er verbeamtet worden.» Obwohl er Deutsch sprach, verstand ich nun gar nichts mehr. Ich wusste nicht, was eine «Verbeamtung» war, aber es hörte sich in jedem Fall verdammt schmerzhaft an. Wolf betonte zwar, dass wir bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeiteten und nicht bei einer «Glaubensgemeinschaft», aber trotzdem musste ich ihm in dieser Sache einfach glauben.
Und dann sagte Wolf noch etwas, was ich komplett missverstand: «Und nicht nur das! Der Mistkerl hat für ’97 eine große ‹Tante Emma› erhalten!» Ich fragte Wolf irritiert, ob es üblich sei, dass ein Mitarbeiter am Ende des Jahres einen Krämerladen bekommt, worauf er knurrend erwiderte: «David, das heißt ‹Tantieme› und ist ein Bonusgehalt!» Wolf ergänzte: «Auf gut Deutsch gesagt, heißt das, der Kerl kriegt scheiße viel Geld.» In meinem Bestreben, auch dem Wolf etwas beizubringen, erklärte ich ihm nach einem Blick ins Wörterbuch, dass die Übersetzung von «auf gut Deutsch» in Zusammenhang mit einem Kraftausdruck im Englischen «If you’ll pardon my French». («Verzeih mir mein Französisch») heißt. Die Antwort von Wolf hätte ich kommen sehen sollen: «Scheiß auf dein Französisch.»
Dem Wolf zu viele Fragen zu stellen, konnte gefährlich sein, aber ich tat es trotzdem. So wollte ich auch von ihm wissen, wie es sich unsere Firma leisten könne, mir 27 Tage bezahlten Urlaub im Jahr zu gewähren. Als ich noch in den USA war, gab es zwar jede Menge Urlaubstage, aber davon wurden nur zwölf bezahlt. Und leider weisen unbezahlte Urlaubstage in mancherlei Hinsicht eine erschreckende Ähnlichkeit mit der Arbeitslosigkeit auf.
Wolf antwortete, dass es in anderen deutschen Firmen noch mehr Urlaubstage gebe. Die Gerüchte waren also doch wahr! Bei meiner Firma in Chicago hatte einmal ein Arbeitskollege einen Zeitungsartikel aus der New York Times
keit schweine
Nachdem ich dem Wolf offenbar eine Frage zu viel gestellt hatte, wurde mir klar, wie wichtig es ist, eine gute Krankenkasse zu haben. Da ich Wolf nicht mehr nerven wollte, fragte ich den anderen Assistenten, Richard, wie das mit den Krankenkassen in Deutschland funktionierte. Ich war erstaunt, dass es so viele davon gab, und kam natürlich prompt mit den ganzen Abkürzungen durcheinander. Richard schüttelte den Kopf, als ich ihn fragte, was die Unterschiede zwischen BKK, TKK, PKK, AOK, KOK und FKK seien. Schließlich fügte er noch hinzu: «Aber du solltest besser nicht krank werden, David, bis du einige Jahre lang gearbeitet hast. Dann wirst du nämlich vielleicht genug verdienen, um bei einer privaten Krankenkasse versichert zu sein.» Er führte weiter aus: «Die Versicherung bei den Privatkrankenkassen wird allerdings richtig teuer, wenn man erst mal Kinder hat. Da meine Frau nicht gesetzlich krankenversichert ist, muss ich wohl eines Tages meine Kinder outsourcen …»