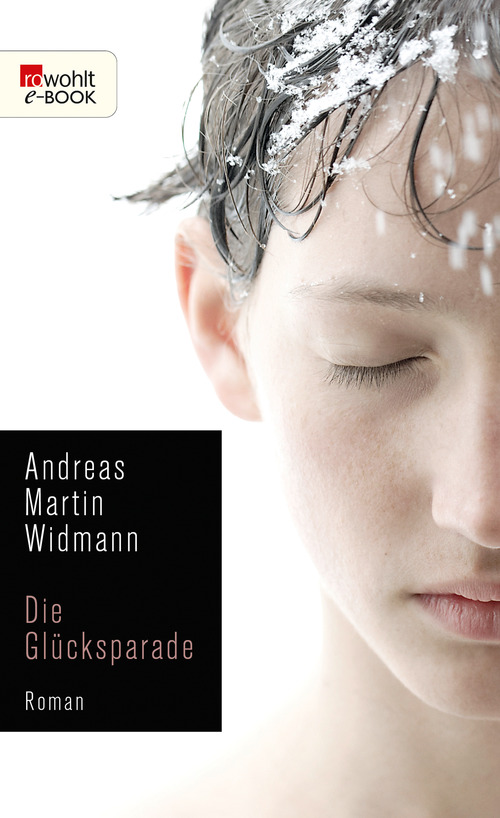
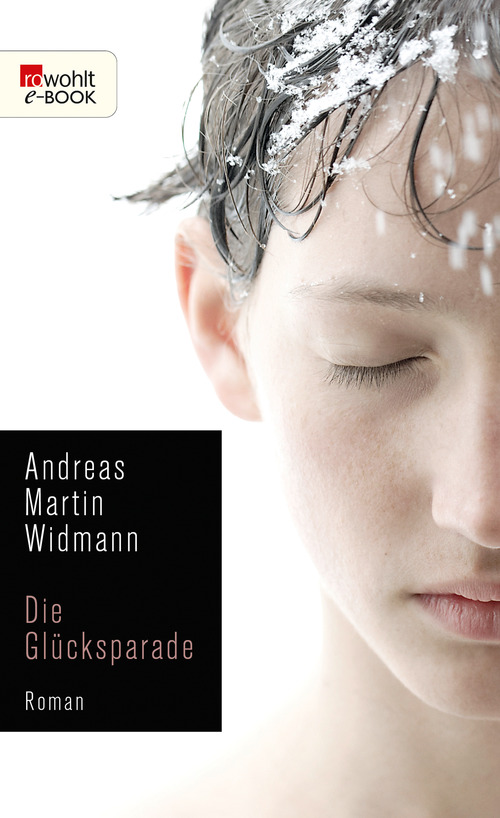
Andreas Martin Widmann
Die Glücksparade
Roman
Rowohlt E-Book

Andreas Martin Widmann, 1979 in Mainz geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Theaterwissenschaft, promovierte 2008 in Neuerer Deutscher Literatur und unterrichtet Deutsche Sprache und Literatur am University College London (UCL). Seine Arbeiten wurden unter anderem mit dem Robert-Gernhardt-Preis und dem Martha-Saalfeld-Förderpreis ausgezeichnet. Für seinen ersten Roman «Die Glücksparade» erhielt er den Mara-Cassens-Preis 2013.
Simon ist fünfzehn, als sein Vater – ein Mann mit vielen Plänen, die nie ganz aufgegangen sind – auf dem Campingplatz zu arbeiten beginnt. Ein Platzwart soll, sagt er, wo er arbeitet, auch wohnen, und so finden sich Simon und seine Mutter in einem Container wieder, inmitten von Dauercampern, die am Leben der neuen Nachbarn mal mehr, mal weniger Anteil nehmen. Auch sie sind Glücksritter, auf ihre Weise, und darüber ganz allmählich an den Rand der Gesellschaft gelangt. Da ist zum Beispiel «Bubi» Scholz, ein gutherziger Alter, der sich seinen Namen von dem berühmten Boxer geliehen hat. Oder Lisa, die hübsche Tochter der Hellers, von der es heißt, sie werde auf einem Regionalsender eine eigene Fernsehshow bekommen, die «Glücksparade». Zu Lisa fühlt Simon sich hingezogen. Bald unterstellt er seinem Vater eine Affäre mit ihr. Und tatsächlich verbindet die beiden ein Geheimnis, aber eines anderer Art.
«Ein Entwicklungsroman en miniature. Eben weil die Traurigkeit, von der dieses Dasein umhüllt wird, so flächig und allumfassend ist, strahlen die Kontrapunkte umso heller.»
Süddeutsche Zeitung
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung Anzinger|Wüschner|Rasp, München
(Umschlagabbildung: plainpicture/Leander Hopf)
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
ISBN Buchausgabe 978-3-499-24369-1 (1. Auflage 2013)
ISBN E-Book 978-3-644-01751-1
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-644-01751-1
Für Simone
I am just a poor boy
though my story’s seldom told
I have squandered my resistance
for a pocketful of mumbles
such are promises.
All lies and jest
still a man hears what he wants to hear
and disregards the rest.
Paul Simon
Alles, was zwischen dem letzten Frühjahr und dem Winter geschah, hat mit dem Container zu tun, weil es damit anfing, zumindest für meine Mutter und mich. Diese neun Monate waren die letzten, die wir alle zusammen verbrachten, und ich weiß nicht, ob ich irgendetwas daran ändern würde, wenn ich könnte. Vielleicht wünsche ich es mir irgendwann, wenn mehr Zeit vergangen ist und ich älter bin. Das Seltsame ist, dass es mir vorkommt, als wäre es wirklich schon sehr lange her, sobald ich anfange, davon zu erzählen.
Es war an einem Sonntag im Februar, und es fiel ein dünner Regen, in dem alles, was glatt war, kalt glänzte. Der Container sah aus wie ein riesiger weißer Schuhkarton. Er stand auf einem gemauerten Untersatz, fast einen Meter über dem Boden, eine Metalltreppe führte an die Eingangstür, und an einer Seite ragte eine Satellitenschüssel von der Wand wie ein Ohr. Am Fuß der Treppe hatte sich eine Pfütze gebildet, in der die erste Stufe gerade noch sichtbar war. Ein löchriges braunes Blatt schwamm darin und eine zertretene Zigarettenschachtel leuchtete daneben rot im nassen Gras.
«Seit diesem Tag hätten wir wissen müssen, dass die Geschichte nicht gut ausgeht», sagte meine Mutter später. Sie selbst hatte vor kurzem eine Umschulung abgebrochen und auch keine guten Argumente, aber sie wollte nicht das ganze Jahr über zwischen Zelten und Wohnwagen leben. Ich war fünfzehn, und ich ging noch zur Schule, deshalb stand fest, dass ich dabei sein würde, egal, wofür meine Eltern sich entschieden. Mehr als einmal fragten sie, was ich darüber dachte, aber ich sagte, ich wüsste es nicht. Und ich wusste es wirklich nicht.
Mein Vater war schon seit längerem unzufrieden damit gewesen, wie die Dinge für ihn liefen, und als ihm die Stelle auf dem Campingplatz angeboten wurde, glaubte er, es wäre das Beste, auch da zu wohnen, wo er arbeiten würde. Er war damals Aufseher bei einer Wach- und Schließgesellschaft, die auf Taxis und in der Zeitung mit dem schwarzen Schattenriss eines Mannes warb, der eine Taschenlampe hielt. Ein anderer schwarzer Mann zuckte vor dem Lichtstrahl zurück und hielt seine Hände vors Gesicht wie zwei Krallen. Darunter stand: CLAVIS. WERKSCHUTZ & OBJEKTSICHERHEIT. Nachts saß mein Vater vor einer Wand aus kleinen Monitoren und machte Runden auf dem Gelände einer Fabrik, die Küchentücher und Klopapier herstellte, und er sagte oft, das einzig Gute daran sei, dass wir so viel Klopapier umsonst haben konnten, wie wir brauchten. Ich wusste, dass er lange nach einer anderen Arbeit gesucht hatte. Er sagte, die Nachtschichten machten ihn krank und er sei keine Eule, die nur im Dunkeln rauskommt. Er brauche die Sonne.
Nur zwei Tage später entschloss mein Vater sich, das Angebot anzunehmen. Zuletzt hatte er gesagt, es sei die einzige Möglichkeit, das Auto zu behalten, das längst viel zu teuer geworden sei, aber offenbar hatte er schon um einiges früher von der Sache erfahren und darüber nachgedacht, ohne meine Mutter und mich einzuweihen. Er hatte den ehemaligen Verwalter getroffen und sich erklären lassen, was er zu tun hätte, und er sprach darüber so, als wäre es eigentlich nichts Neues mehr. Die Ärmel seines karierten Hemdes hatte er bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt, und während er uns von seiner Arbeit erzählte, rieb er sich das Kinn. Sein Kinn hatte ein Loch, eine Spalte in der Mitte, die besonders deutlich zu sehen war, wenn er sich frisch rasiert hatte. Es war keine Narbe, sie war einfach da und er hatte sie schon immer, seit er ein Kind war. Manche fanden sie markant.
«Ich soll für die Leute da sein. Reparaturen erledigen, im Winter ein Auge auf die Wohnwagen haben, den Rasen mähen, nach dem Rechten sehen eben», sagte er. Auch mit unserem Vermieter hatte er schon telefoniert und ihn gebeten, uns schnell aus unserer Wohnung zu lassen, trotz Mietvertrag, Kündigungsfrist und solchen Dingen, die er den täglichen Krieg gegen das Böse nannte. Das war seine Art. Wenn er redete, konnte mein Vater fast alles leichter oder besser aussehen lassen, als es eigentlich war. Und obwohl ich nicht wusste, wie er das schaffte, hatte ich oft erlebt, dass er recht behielt und dass ihm auch Leute glaubten, die ihn nicht kannten. «Der ist natürlich froh, uns loszuwerden», sagte er jetzt.
«Warum denn?», fragte meine Mutter.
«Weil er ein Arschloch ist, deshalb.»
Vielleicht dachte er, dass meine Mutter ihn durch ihr Schweigen zu einer Erklärung auffordere, jedenfalls erinnerte er uns wieder einmal daran, wie er den Vermieter angerufen hatte, weil es im Bad durch die Decke tropfte, und wie der erklärt hatte, wir müssten beim Duschen eben besser aufpassen. «Dabei kam das Wasser von oben», sagte mein Vater.
Meine Mutter schwieg dazu. Ich schaute auf den Fernseher, der schon während des Essens gelaufen war, ohne dass jemand darauf achtgegeben hätte, auf das Bild eines Mannes mit einem Mikrophon, der vor einer dunklen Stadt stand. Es war dieser Tick, den ich seit kurzem entwickelt hatte, mich einfach nicht auf das zu konzentrieren, was mich anging, sondern an etwas anderes, Abgelegenes zu denken, selbst wenn man mit mir sprach. Auf einmal griff mein Vater zur Fernbedienung und schaltete den Apparat aus, als wollte er damit klarstellen, dass die Angelegenheit für ihn erledigt war.
«Wir haben sogar einen Garten», sagte er in die Stille. «Nichts Großes, aber immerhin. Und in der heutigen Zeit.»
Die heutige Zeit hatte für meinen Vater irgendwann in den Achtzigern begonnen, bevor ich geboren wurde. Bevor er aufgehört hatte, Fußball zu spielen, und nachdem er meine Mutter kennengelernt und sich von seiner ersten Frau getrennt hatte. Zwei Jahre lang hatte er mit ihr in einem Hunsrückdorf gelebt, wo sie als Sekretärin in einem Versandlager arbeitete, während er, soviel ich wusste, nichts tat außer Fußballspielen und gleichzeitig so etwas war wie der Platzwart für den örtlichen Sportverein. Damals, sagte er einmal, sei er unentbehrlich gewesen, und wenn ich daran dachte, stellte ich mir einen Mann vor, der allein über den Rasen geht, eine Zigarette raucht und aussieht, als könnte ihm nichts etwas anhaben. Er sah aus wie der Mann auf dem Foto aus Portugal, das ich von ihm kannte, mit einem Bart, in roten Leinenhosen und Sandalen.
«Für dich ändert sich nicht viel», sagte er und stieß mich an der Schulter an, dann stand er auf, und nach ein paar Minuten hörte ich das Rauschen der Dusche aus dem Bad. Meine Mutter ging auch aus dem Zimmer, und ich sah sie an diesem Abend nicht wieder.
Eine Woche später fuhren wir zusammen zu dem Campingplatz. Mein Vater hatte einen Besichtigungstermin mit jemandem vereinbart, der, wie der Verwalter ihm mitgeteilt hatte, seinen eigenen Caravan auf dem Platz verkaufen wollte. Es war Sonntagnachmittag, über den Wohnblocks hing ein kalter Dunst, und die Straßen waren wie ausgefegt. Ich stellte mir vor, die Stadt wäre von einer Seuche befallen worden und wir wären die letzten Überlebenden. Wir fuhren an zugezogenen Gardinen vorbei, und ihr zerknittertes Weiß erinnerte mich an alte Zeitungen.
Vor zwei Jahren waren wir aus Hanau hierhergezogen, als meine Mutter ihre Stelle im Reisebüro verloren hatte und mein Vater anfing, beim Wachdienst zu arbeiten. Bis dahin hatte er für UPS Pakete ausgeliefert und als Hilfsfahrer auch Mietwäsche an Hotels und Autobahnraststätten. Ich weiß nicht, was damals dahintersteckte, aber er sagte, er wollte einen Schnitt machen und sich woanders umschauen. Jetzt war es wieder so weit.
Keiner sprach, während wir im Auto saßen. Meine Mutter schaltete das Radio an und suchte nach Musik, die ihr gefiel. Alle paar Minuten stellte sie einen neuen Sender ein. Normalerweise konnte mein Vater das nicht ertragen, aber heute beklagte er sich nicht. Er hielt das Lenkrad mit beiden Händen und starrte stumm geradeaus. Ich selbst schaute aus dem Seitenfenster auf die leeren Straßen und Gehwege. Die Siedlung lag am Stadtrand in der Nähe einer stillgelegten Fabrik für Lacke und Farben, und sie wurde von einer breiten Hauptstraße in zwei Teile zerschnitten. Auf unserer Seite gab es keine Einfamilienhäuser, überhaupt keine freistehenden Häuser, sondern nur Flachdachbauten mit fünf Stockwerken oder mehr, die alle weiß oder hellgelb gestrichen waren. Zwischen zwei Häuserblöcken stand je eine lange Flucht von Teppichstangen wie leere Fußballtore. Wegen der Bremsschwellen auf der Straße fuhr mein Vater sehr langsam, und ich sah die Teppichstangen immer einen Moment lang genau von vorn, ich schaute wie in einen Tunnel, bevor sie wieder auseinandersprangen und sich nach hinten verschoben, während wir über die nächste Schwelle rollten.
Der Campingplatz lag an der Spitze einer Insel. Davor gabelte sich der Fluss in zwei ungleiche Arme, deren einer breit und schnell war. Der andere war ein toter Arm, den man abgeschnitten hatte, als der Fluss begradigt worden war. Von einem Ufer zum anderen waren es kaum mehr als zwanzig Meter, das Wasser floss langsam, und eine Autobrücke aus schweren Holzplanken führte hinüber. Auf der anderen Seite der Brücke stand ein Wegweiser: FERIENANLAGE AUE. Die Straße endete an einem Schotterparkplatz. Vor der Schranke waren zwei Teile eines Bauzauns mit einer Kette zusammengeschlossen, dahinter begann der Campingplatz.
«Es gibt keinen Bus von dort. Wir werden dich mit dem Auto zur Schule fahren», sagte mein Vater. Er zeigte auf eine Reihe hoher Pappeln und sagte, die Bäume würden uns im Sommer Schatten geben. Jetzt besprühte ein feiner Nieselregen die Scheiben, und ich wäre gern einfach sitzen geblieben hinter dem langsam dichter werdenden Vorhang aus Nässe.
Stattdessen stiegen wir aus, gingen mit großen Schritten durch den Regen und drängten uns unter einem Schirm zusammen. Nach ein paar Minuten, in denen nichts geschah, klappte ich meine Kapuze über den Kopf und ging los, um mich allein umzuschauen. Das Gelände jenseits des Parkplatzes war von einem Zaun umschlossen, der mir bis über die Schultern reichte. Auf der anderen Seite ragte über den Wipfeln die Spitze eines Sendemasts auf, der schon von weitem zu sehen gewesen war. Ich ging ein Stück unter den Pappeln am Ufer entlang. Wie häufig im Februar, wenn das Schmelzwasser aus dem Süden herunterkam, hatte es Hochwasser gegeben, von dem auch hier noch etwas zu merken war. Lose Zweige und Müll waren in den über den Fluss ragenden Ästen einiger Büsche und an den zur Befestigung aufgeschütteten Steinen hängen geblieben. Das Wasser war seitdem wieder gesunken und hatte das Treibgut, das sich verfangen hatte, zurückgelassen. Wenn es noch weiter sänke, würde niemand wissen, wie das Zeug in die Bäume gekommen war, dachte ich.
Der Mann, der schließlich aus einem kleinen gelben Peugeot stieg, war von bulliger Statur, und seine dunklen Augenbrauen wuchsen so dicht zusammen, dass es aussah, als hätte er einen Schnurrbart über der Nase. Sein Haar war schütter, im Nacken lang, und er musste im Alter meiner Eltern sein. Er gab jedem die Hand, führte uns durch eine Tür im Maschendrahtzaun auf den Platz und entschuldigte sich dabei für die Verspätung. Er behauptete, es tue ihm wirklich wahnsinnig leid. Dann zeigte er ohne ein weiteres Wort auf den Container. Die Fenster wirkten dunkel, als wären sie von innen verhängt. In der näheren Umgebung standen mehrere solcher Kisten. Die meisten waren weiß, und eine schnitt jeweils die Sicht auf die dahinterliegende ab. Überall waren die Jalousien heruntergelassen oder die Läden vor den Fenstern geschlossen, wenn es welche gab. Nichts deutete darauf hin, dass Menschen hierherkamen, doch ich sagte mir, dass es an der Jahreszeit liegen musste, und versuchte, mir den Betrieb und das Leben hier vorzustellen.
«Gibt es noch andere Interessenten?», fragte meine Mutter.
Der Besitzer schüttelte den Kopf.
«Ihr seid die ersten», sagte er. «Aber nächste Woche flieg ich nach Spanien, dann übergeb ich alles an eine Agentur.»
Er schloss auf und ging hinter uns hinein. Drinnen gab es zwei Kammern, eine links und eine rechts von der Tür, und in der Mitte eine Küchenzeile und ein kleines Bad dahinter. Außer einem Tisch und zwei Klappstühlen waren keine Möbel da, und mein Vater begann, über die Einrichtung zu sprechen.
«Es ist mehr Platz, als man denkt», sagte er flüsternd, als verriete er ein Geheimnis, das wir unbedingt für uns behalten sollten. Einige von unseren Sachen wollte er in einem Geräteschuppen unterstellen, bei Bekannten im Keller oder in einem Mietlager, und ein paar Möbel, die wir nicht mehr brauchten, würde er verkaufen oder weggeben.
«Es ist nur für den Anfang, bis du wieder etwas gefunden hast und wir aus dem Gröbsten raus sind», sagte er leise zu meiner Mutter, bevor seine Stimme wieder laut wurde und er nach den Maßen fragte.
«Muss ich nachschauen», sagte der Besitzer. «Aber ich weiß, dass es der größte Kasten hier auf dem Platz ist. Solche gibt’s bei uns sonst gar nicht, den hat einer importiert und so.»
«Da haben wir ja Glück gehabt», sagte mein Vater.
Wir standen im linken der beiden Räume. Ich versuchte mit ausgestrecktem Arm die Decke zu berühren. Es gelang ohne weiteres, ich konnte sogar die Handfläche dagegenstützen, als balancierte ich ein Tablett über dem Kopf. Der Besitzer strich seine Haare im Nacken über den Kragen, er faltete einen Grundrissplan vor sich auseinander und drückte ihn mit den Fingern an die Wand, so fest, dass die Nägel an der Kuppe weiß wurden.
«Neunundzwanzig Quadratmeter im Ganzen», sagte er.
Ich schritt die lange und die kurze Wand ab und versuchte mir vorzustellen, wie viel Mal ich hier hineinpassen würde, wenn ich mich flach auf den Boden legte. Von der Vorderseite bis zur Rückseite der Kammer fast zweimal, von der Tür bis zur Seitenwand einmal und noch einmal bis zum Gürtel, dachte ich und musste fast lachen bei dem Gedanken. Ich drehte mich einmal um mich selbst. Im Türschatten war ein zwei Finger breites Loch in der Wand, wo die Klinke die weiße Hartfaserverkleidung durchschlagen hatte.
«Da gab es wohl mal Streit», sagte mein Vater, der die Stelle im gleichen Moment bemerkt haben musste. Ich befühlte sie und fasste in das Loch. Wenn ich die Finger zusammenschob, konnte ich meine Hand ein Stück in den Spalt stecken. Nicht sehr weit. Drei Zentimeter, vielleicht auch vier.
Wir zogen im März um. Es war ein kalter Monat, grau und eisig, mit einer Sonne, deren Strahlen immer durch Milchglas zu fallen schienen. Im Fernsehen hieß es, die niedrigen Temperaturen seien für diese Jahreszeit ungewöhnlich, und ob das die Wahrheit war oder nicht, wir spürten es, als wir unsere Sachen aus der Wohnung zum Campingplatz brachten. Schon nach wenigen Minuten im Freien hatte man steife Finger und an den Knöcheln Risse in der Haut, durch die das Blut schimmerte. Einiges transportierten wir in dem dunkelroten Passat, den meine Eltern fuhren, solange ich denken konnte. Mein Vater nannte ihn den Roten Blitz, nach einem Rennpferd, auf das er mal gesetzt hatte. Es hatte mit einer hohen Quote gewonnen, und wenn er gut gelaunt war, behauptete er, am liebsten hätte er das Pferd selber von dem Geld gekauft, aber ein Auto wäre praktischer in der heutigen Zeit. Wir bauten die Rückbank aus, brachten sie in unseren Flur, und dort wurde sie zur Ablage für alles, was man in dem Durcheinander aus Tüten und Kartons irgendwie loswerden musste.
Für die letzte Fuhre mietete mein Vater einen Kleinlaster. Außer mir hatte er noch einen Nachbarn gefragt, ob er uns zur Hand gehen könne. Er hieß Roland Berg, wohnte zwei Etagen unter uns, und ich konnte mich nicht erinnern, je ein Wort mit ihm gewechselt zu haben, wenn ich ihm im Treppenhaus begegnet war. Dass er mir überhaupt aufgefallen war, lag an seiner altmodischen Brille, die der glich, die mein Opa gehabt hatte, mit einem dicken braunen Gestell, und an den Henkelplastiktüten, in denen er seinen Müll über Nacht neben seine Tür stellte, bevor er ihn im Laufe des nächsten Tages nach unten trug.
An diesem Samstag hatte meine Mutter sich morgens von ihrer Schwester abholen lassen, um mit ihr in ein Einkaufszentrum zu fahren, das erst einige Wochen zuvor neu eröffnet hatte. Dort gab es nicht nur Geschäfte, sondern auch ein großes Kino, und mein Vater hatte darauf gedrängt, dass die beiden sich einen schönen Tag machten, während wir diesen Teil des Umzugs erledigten. Als die beiden mich allein gelassen hatten, wartete ich darauf, dass mein Vater mit dem Lastwagen kommen würde. Meine eigenen Sachen hatte ich schon gepackt. Es war nicht viel, vor allem Kleidung, Schulzeug und Spielsachen, die ich nicht mehr benutzte, und meine Comics. Ich ging durch alle Zimmer. Die Gardinen waren schon abgenommen, und dadurch veränderte sich alles, es kam mir vor, als wären nicht nur die Fenster kahl, sondern auch die Wände verschwunden und als könnte man einfach nach draußen gehen oder nach unten fallen, wenn man zu nah an den Rand kam.
Später standen wir in der Küche und sprachen darüber, in welcher Reihenfolge wir was in den Container bringen würden. Mein Vater sagte, er werde nächstens Tomaten pflanzen, auch anderes Gemüse und vielleicht sogar einen Kirschbaum. Er machte Witze über unseren Vermieter, und ich fühlte mich plötzlich wohl dabei und mit der Vorstellung, dass bald so etwas wie ein neues Leben für uns beginnen würde. Ich trommelte sogar kurz mit zwei Schraubenziehern auf die Platte des Küchentischs wie ein Schlagzeuger, und dazu trat ich den Deckel des Mülleimers mit dem Pedal hoch, sodass er gegen die Wand schepperte.
Gegen elf kam Roland und half uns, die Möbel und den Fernseher nach unten zu tragen und im Laster zu verstauen. Eine weiße Kommode brach bei dem Versuch, sie zu zerlegen, so auseinander, dass mein Vater sie für kaputt erklärte. Die Teile ließen wir am Rand des Parkplatzes liegen, wo alle paar Wochen neuer Sperrmüll auftauchte.
Dann fuhren wir zu einem Mietkabinendepot. Es lag auf dem Gelände des alten Schlachthofs, der vor ein paar Jahren abgerissen worden war, zwischen einem Gebrauchtwagenhändler und einer Automatenspielhalle. Über deren Tür blinkte eine Lichtreklame mit dem Schriftzug CASINO MAGIC, davor stand eine Imbissbude, die geschlossen hatte. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, war ein Tauchladen, auf dessen Dach ein gewaltiger Plastikschnorchel angebracht war wie ein gekippter Spazierstock. Die Fläche, auf dem die Schlachthofgebäude gestanden hatten, war viel größer und breiter als das Depot, und sie endete an den Bahngleisen. Im hinteren Teil ragten abgesägte Stahlträger und braune Stauden aus dem Schutt, Sommerflieder wahrscheinlich.
Das Lagerhaus hatte keine Fenster; nur drei Streifen aus trübem Plexiglas durchbrachen die Fassade zur Straße hin von oben bis unten. Mein Vater schnallte sich ab, öffnete seine Tür und sagte, ich solle im Wagen warten. Vier oder fünf Minuten später kam er zurück. Eine Frau ging neben ihm, sie hatte braunes, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenes Haar mit einer grün gefärbten Strähne darin, und sie trug eine dicke rote Steppweste. Roland starrte durch den Maschendraht auf die Autos, die bei dem Händler nebenan ausgestellt waren. Ich konnte sehen, dass die Scheiben seines eigenen Wagens von innen beschlagen waren. Es war ein metallicblauer Subaru, ein flaches und kantiges Ding, dessen linker vorderer Kotflügel mit Flecken aus einer grauen Paste übersät war.
«Da ist mir mal einer reingeknallt», sagte er zu mir. «Bin noch nicht dazu gekommen, es richtig machen zu lassen.»
Wir gingen zu einem hohen Tor; die Frau steckte einen Schlüssel an einer langen Kette in ein Schloss an der Wand, drehte ihn und drückte auf einen Knopf. Der Rollladen hob sich, dahinter begann ein langer Gang. Alles wirkte sauber und neu und hell hier drinnen. Der Boden war weiß, die Decke unverkleidet, man konnte Leitungen und Metallschienen sehen, Neonröhren hingen in kurzen Abständen, und zu beiden Seiten lagen die Kabinen, die aussahen wie Garagen. Roland pfiff klanglos vor sich hin und sah mich an.
«Gar nicht so dumm, was?», sagte er. «Wusste gar nicht, dass es so was gibt.»
Die Frau mit der grünen Haarsträhne zeigte uns Sackkarren, Möbelhunde und ein fahrbares Gerät, das sie Ameise nannte, mit zwei langen, schmalen Metallzungen dicht am Boden und einer geraden Stange mit Handgriffen an deren Ende. Dann ließ sie uns allein.
Aus dem Laster luden wir den leergeräumten Kleiderschrank meiner Eltern und den kleineren aus meinem Zimmer, meinen Tisch und den Drehstuhl, das Sofa, die Kommode, auf der der Fernseher gestanden hatte, und die Nachtschränke meiner Eltern. Ein Stück nach dem anderen wuchteten wir auf einen Untersatz, schoben es in die Halle und den künstlich beleuchteten Gang entlang bis zu der Kabine, die uns die Frau zugewiesen hatte. Dann zog mein Vater drei Flaschen Cola aus einem Getränkeautomaten, und wir tranken, an die zusammengerückten und gestapelten Möbel gelehnt.
«Seid ihr hungrig?», fragte er nach einer Weile.
«Ich könnte was essen», sagte Roland. «Wenn ich so gefragt werde.» Er sah schläfrig aus, seine Stimme war leise.
«Vorn am Automaten gibt es Schokoriegel», sagte mein Vater.
«Riegel sind gut», sagte Roland, noch leiser.
Mein Vater stellte seine Flasche auf den Boden und sagte, er werde uns welche besorgen. Roland und ich blieben, wo wir waren.
«Ich hab einen Bauchfellriss», sagte er plötzlich. «Ich sollte so Sachen nicht machen wie hier.» Er drückte auf seinem Pullover herum, der Stoff warf Falten, und dann zeichnete sich eine dicke Beule auf Höhe seines Bauchnabels ab. «Eine Plage ist das, das kann ich dir sagen», murmelte er und massierte die Beule. Ich wusste nicht, ob ich ihm zusehen oder wegschauen sollte, also schaute ich auf die Uhr, es war kurz vor halb zwei, dann trank ich noch einen Schluck Cola.
«Wie kann so was passieren?», fragte ich.
«Schwaches Bindegewebe», antwortete er.
«Ist das gefährlich?»
Er knautschte sein Gesicht wie einen weichen Lederball, sagte aber nichts, sondern nahm seine Brille mit dem dicken Gestell ab und putzte sie umständlich mit einem Zipfel seines Hemdes. Ich wollte ihn fragen, was er eigentlich für einen Beruf hatte, und überlegte, wie ich es anfangen sollte, während er die Gläser anhauchte, abrieb und gegen das Neonlicht hielt.
«Kann man damit arbeiten?», fragte ich. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn duzen oder siezen sollte.
«Sag ich doch», sagte er.
«Was?»
«Bist du schwer von Begriff?»
«Warum?»
«Ich bin krankgeschrieben. Darum.»
«Immer schon?» Ich wollte ihn nicht ärgern, merkte aber, dass es jetzt wahrscheinlich so wirkte. Gleichzeitig merkte ich, dass es mir egal war. Roland schüttelte den Kopf, aber ich hätte nicht sagen können, ob er damit auf meine Frage antworten wollte oder ob er es tat, um mir zu zeigen, wie albern er sie fand. Ich setzte mich auf den Boden, zog die Knie an und umschlang sie mit meinen Armen. So blieb ich, und erst beäugte er mich wie jemanden, der etwas Unfassbares getan hat, und irgendwann drehte er sich weg. Mein Vater kam zurück, reichte jedem ein Snickers und sagte, er hätte vorne im Büro erst noch Geld wechseln müssen, deshalb hätte es so lange gedauert. Wir aßen und tranken unsere Flaschen leer, und dann fuhren wir weiter.
Wir nannten die Räume Küche, Bad und Schlafzimmer, obwohl sie das kaum waren. Auch mein Zimmer war kein Zimmer, sondern nur eine Kammer hinter einer dünnen Tür. Es war die mit dem Loch in der Wand, links von der Küche. Um alles unterbringen zu können, stapelten wir die Kartons bis unter die Decke. Außer dem Bett passte so nichts mehr hinein.
«Gut, dass deine Mutter das jetzt nicht sieht», sagte mein Vater. Er zwinkerte mir zu. «Jenny, heirate nicht diesen Gammler», meckerte er, wie schon oft, wenn meine Mutter und er sich in einer Sache uneinig waren und sie ihm Vorwürfe machte. Weil er dabei seine Stimme verstellte und durch die Nase sprach, glaubte ich einige Jahre, er imitiere jemanden, vielleicht meine Oma, bevor mir klarwurde, dass er niemanden nachmachte. Er spielte einfach eine kurze Nummer und keifte mit dieser hohen Stimme herum. Das war entweder das Ende der Unterhaltung oder der Anfang eines sehr langen Gesprächs, und das, worum es dabei ging, war ebenfalls das Ende von etwas und der Beginn von etwas anderem. Doch bis ich das begriff, dauerte es noch lange.
Wir schoben alles so eng zusammen, wie es nur irgendwie ging, und trugen mehrere Kisten, das Bügelbrett und eine metallene Wäschetonne zu der Hütte, in der mein Vater sein Büro haben würde. Sie stand kurz hinter der Einfahrt. Ochsenblut, sagte mein Vater, und er meinte die Farbe, in der sie gestrichen war. Was am Ende übrig bliebe, würde Roland in seinen Keller stellen und für uns aufbewahren. Er sagte, falls wir eines Tages wieder etwas Größeres hätten, könnten wir die Sachen zurückhaben, wenn wir wollten, und ich merkte, dass mein Vater nicht glücklich aussah in dem Moment. Aber er wünschte Roland alles Gute, dankte ihm, und wir gingen in den Container, um noch etwas Ordnung zu machen, und probierten noch verschiedene Varianten aus, in denen sich kleinere Möbel oder Geräte aufstellen ließen, und darüber wurde es draußen dunkel.
Am Abend, als wir zurückfuhren zu unserer jetzt fast leeren Wohnung, sagte mein Vater, Roland stecke selbst ziemlich in der Klemme, und ich fragte, was das für eine Klemme sei.
«Er hat versucht, mich anzupumpen», sagte mein Vater. «Nur deshalb hab ich ihn gebeten, uns zu helfen. Er hat darauf spekuliert, dass was für ihn abfällt, und wenn man sich auf jemanden verlassen muss, ist das das Beste, was passieren kann. Aber wenn du mich fragst, ob wir unsere Sachen noch mal wiedersehen, würde ich sagen: Wahrscheinlich nicht.»
Die Wohnwagen und Hänger in der Ecke, in der unser Container stand, waren seit Jahren nicht bewegt worden. Einige hatten keine Räder mehr, sondern Fundamente aus Waschbetonsteinen, an denen schon Moos wuchs. Sie gehörten Leuten, die fast jedes Wochenende herkamen oder sogar den ganzen Sommer über blieben.
Die Ersten, die ich kennenlernte, waren Klaus und Petra Hoffmann. Es war Samstagvormittag, und wir waren dabei, den Geräteschuppen auszuräumen und sauber zu machen. Er war aus Brettern gebaut und sah aus wie eine kleine Berghütte mit schrägem Dach. Mein Vater wollte ihn benutzen, um die Kisten aus meinem Zimmer darin unterzustellen, und er hatte vor, ihn neu zu streichen. Vorher aber mussten der Schmutz und die alte Farbe runter, jedenfalls an den Stellen, an denen sie aufgeplatzt war und abblätterte.
«Ihr habt’s gut, könnt das ganze Jahr Urlaub machen hier», sagte Klaus zu meinem Vater. Er war zu uns herübergeschlendert wie jemand, der noch nicht genau weiß, was er vorhat, und weil ich in die Hocke gegangen war, um an der unteren Hälfte der Wand herumzuscheuern, hatte ich zuerst seine Füße gesehen, seine hellblaue Jeans ungefähr bis zu den Hüften, wo seine Hände in den Hosentaschen steckten. Er hatte kleine blaue Augen und zwei tiefe Furchen um den Mund, die seine Backen aus dem Gesicht herauszudrücken schienen. Mein Vater lachte, sagte tja oder etwas in der Art und machte weiter. Klaus schaute uns zu, und dann wiederholte er, was er gesagt hatte. Wir hatten zwei Drahtbürsten, einen mit Wasser gefüllten Eimer und Lappen hergebracht. Einen davon griff sich mein Vater jetzt, tauchte ihn ins Wasser, wrang ihn aus und wischte dann über die Bretter, mit denen er beschäftigt war.
«Wir hatten früher mal einen VW-Bully», sagte Klaus. «Hab ich auch ’ne Menge dran gemacht, aber wir wollten dann lieber was Festes, so wie hier.»
Ich schwitzte, und was schlimmer war, ich hatte Staub in den Haaren und im Gesicht. Meine Haut spannte, als wäre sie zu eng für mich. Auch mein Vater schwitzte, ich konnte es nicht nur sehen, sondern auch riechen. Seit wir hergekommen waren, ließ er sich wieder einen Bart stehen. Noch war er nicht sehr dicht, gerade dicht genug, dass das kleine Loch in seinem Kinn darunter verschwand. Genau da hatten sich jetzt ein paar winzige rote Farbsplitter verfangen.
«Ist gut, wenn man viel selber machen kann», sagte Klaus.
«Genau», sagte mein Vater. «Selbst ist der Mann.»
«Und der Sohn auch.» Klaus lachte.