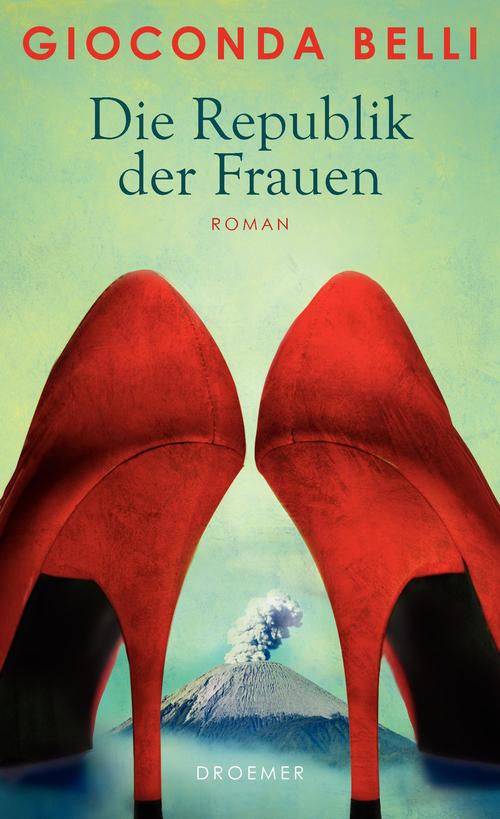
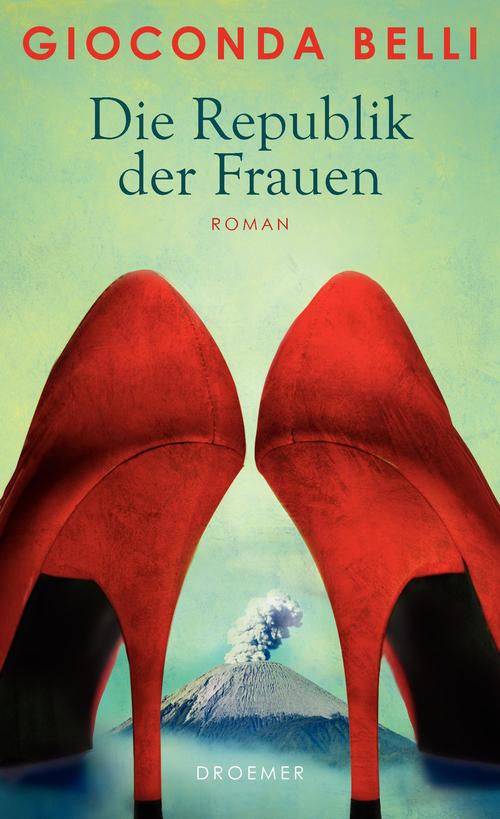
Gioconda Belli
Die Republik der Frauen
Roman
Aus dem nicaraguanischen Spanisch von Lutz Kliche
Knaur e-books
Gioconda Belli, geboren in Managua/Nicaragua, beteiligte sich ab 1970 am Widerstand der Sandinisten gegen die Diktatur in ihrem Land und ging 1975 ins Exil nach Mexico. Seit ihr 1988 mit »Bewohnte Frau« der internationale Durchbruch als Schriftstellerin gelang, hat sie mit zahlreichen Romanen, Gedichtbänden und ihrer Autobiographie ein millionenfach gelesenes Werk geschaffen. Heute lebt sie in Nicaragua und Los Angeles/USA.
Wer kennt Faguas? Faguas ist das Land, von dem ganz Lateinamerika spricht, denn hier ist Unerhörtes gelungen: Eine Handvoll entschlossener Frauen, angeführt von der charismatischen Viviana Sansón, hat den rückständigen Machos die Macht entrissen. Mit Hilfe ihrer »Partei der erotischen Linken«, mit Humor, Toleranz und Selbstironie (und mit Hilfe eines Vulkanausbruchs, aber das ist eine andere Geschichte …) haben Frauen jeden Bereich des öffentlichen Lebens übernommen. Das Land blüht auf – aber nicht alle sind von den Neuerungen restlos überzeugt …
Die spanische Originalausgabe erschien 2010
unter dem Titel »El país de las mujeres«
bei Editorial Norma, Bogotá.
Copyright © 2012 der eBook Ausgabe by Knaur eBook.
Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt
Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © 2010 by Gioconda Belli
Published by arrangement with
Guillermo Schavelzon & Assoc. Literary Agency
through UnderCover Literary Agents
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –
nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: Gettyimages/Michael Blann
ISBN 978-3-426-41665-5
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren spannenden Lesestoff aus dem Programm von Knaur eBook und neobooks.
Auf www.knaur-ebook.de finden Sie alle eBooks aus dem Programm der Verlagsgruppe Droemer Knaur.
Mit dem Knaur eBook Newsletter werden Sie regelmäßig über aktuelle Neuerscheinungen informiert.
Auf der Online-Plattform www.neobooks.com publizieren bisher unentdeckte Autoren ihre Werke als eBooks. Als Leser können Sie diese Titel überwiegend kostenlos herunterladen, lesen, rezensieren und zur Bewertung bei Droemer Knaur empfehlen.
Weitere Informationen rund um das Thema eBook erhalten Sie über unsere Facebook- und Twitter-Seiten:
http://www.facebook.com/knaurebook
http://twitter.com/knaurebook
http://www.facebook.com/neobooks
http://twitter.com/neobooks_com
Abkürzung für »Partido de la Izquierda Erótica«. PIE bedeutet im Spanischen gleichzeitig »Fuß« (weshalb die PIE einen Frauenfuß mit rotlackierten Nägeln als ihr Symbol wählte).
Der »Blog des Besserwissers« wurde jeden Montag auf der Titelseite der Zeitung »El Comercio« abgedruckt. Dieser Blog erschien am Montag, nachdem die Nationalversammlung Eva Salvatierra zur Übergangspräsidentin gewählt hatte.
Es war ein frischer Januarnachmittag. Die Passatwinde bliesen kräftig über das Land und wirbelten in der Hauptstadt das Laub von einer Straßenseite auf die andere. Der See, an dem der Präsidentenpalast von Faguas stand, sah aus wie Milchkaffee, seine Wellen trugen kleine Schaumkronen. Es roch nach windzerzausten Wildblumen, nach gedrängt stehenden, schwitzenden Körpern.
Auf der Bühne beendete Viviana Sansón, die Präsidentin, gerade ihre Rede und hob siegesgewiss die Arme. Auf dem Platz brandete wieder und wieder Applaus auf. Es war das zweite Jahr ihrer Regierung und das erste, in dem überall im Land der »Tag der vollständigen Gleichheit« gefeiert wurde, den die Regierung der PIE-Partei zu einem der wichtigsten Feiertage des Landes erklärt hatte. Der Präsidentin stiegen die Tränen in die Augen. Die vielen Menschen, die voll stürmischer Begeisterung zu ihr hochschauten, waren der Grund für ihr Glück. Die Energie, die ihr entgegenströmte, war so stark, dass sie am liebsten weiter von den verrückten Träumen erzählt und all denen widersprochen hätte, die nie geglaubt hätten, dass sie je an die Macht käme; dass ihre Kühnheit und die ihrer Gefährtinnen von der PIE, der »Partei der Erotischen Linken«[1] je zum Erfolg führen könnte.
Sie warf einen Blick in die Runde. Auf den Terrassen der umliegenden Gebäude drängten sich Mädchen, sie saßen in den Ästen der Bäume des benachbarten Parks und sogar auf dem Dach des Pavillons in seiner Mitte. Männer und Frauen hockten auf den Stufen vor dem Präsidentenpalast. Vor der Bühne wurden die Polizistinnen der Absperrkette von der anbrandenden Menge bestürmt. Die Armen, dachte sie, während sie weiter auf der Bühne ihre Runden drehte und mit erhobenen Armen winkte. Sie hatte keinen Polizeischutz gewollt, doch Eva hatte darauf bestanden. Sie machte sich immer Sorgen, wenn Viviana auf öffentlichen Plätzen sprach.
Nach den vergangenen zwei Stunden lief ihr der Schweiß in Strömen den Rücken herunter. Sie hielt ihre Reden nie von einem Pult aus. Ihr Rockstar-Stil – ganz in Schwarz und mit hohen Stiefeln – war ein Bruch mit der Tradition der alten Machopolitiker, die sich gern hinter Tischen und Balustraden verschanzten. Das war nicht ihr Ding. Sie wollte, dass die Menschen ihr nah sein konnten. Schon während der Wahlkampagne hatte sie immer mit dem Mikrophon in der Hand inmitten der Menge gesprochen. Der Kreis war für sie wie eine Umarmung, so hatte sie das erklärt, und das Zauberwort ihrer Regierung war KONTAKT; alle in Kontakt miteinander, sich berühren, sich spüren. Der Kreis war das Symbol, die Teilhabe, der Mutterleib, er bekräftigte ihren Glauben daran, dass man auch mit dem Herzen sehen musste, nicht nur mit dem Verstand. Die Veränderung, die sie der Politik ihres Landes gegeben hatte, erlaubte es ihr, sich von der Wärme einhüllen zu lassen. Es war dieselbe Wärme, die sie in der strahlenden Sonne schwitzen ließ, während dieser Tag zu Ende ging.
Immer weiter lief Viviana im Kreis. Mit ihren vierzig Jahren sah sie beneidenswert aus: der braune, muskulöse Körper einer Schwimmerin, die dichten schwarzen Locken, die ihr bis auf die Schultern fielen – das Erbe ihres Vaters, eines Mulatten, den sie nie kennengelernt hatte –, und das schmale Gesicht ihrer Mutter, mit feinen Zügen, großen, schwarzen Augen und einem breiten Mund mit sinnlichen Lippen. An diesem Tag trug Viviana ein schwarzes T-Shirt, aus dessen Ausschnitt sich ein üppiger Busen drängte, dessen Nützlichkeit sie erst akzeptierte, seit sie in die Politik gegangen war. In ihrer Jugend hatte seine Größe sie furchtbar gestört, und als sie feststellte, dass Schwimmerinnen so flach waren wie Bügelbretter, verschrieb sie sich dem Schwimmsport. Doch obwohl sie im Wasser Großes leistete und sogar Landesmeisterin wurde, bremste das die Entwicklung ihrer imposanten Brüste kaum. Schließlich blieb ihr nichts anderes übrig, als sich mit ihren Proportionen abzufinden und sie als Symbol ihrer Verpflichtung zu sehen. Sie wollte den Menschen ihres Landes jene Ströme von Milch und Honig schenken, die die Misswirtschaft der Männer ihnen vorenthalten hatte. Manchmal machte sie sich Vorwürfe wegen ihres Exhibitionismus, aber dass er funktionierte, stand außer Frage. Viviana war weder die erste noch die letzte Frau, die die hypnotische Wirkung einer üppigen Figur zu nutzen wusste.
Nachdem sie die Bühne noch dreimal umrundet hatte, dabei ab und zu innehielt und triumphierend winkte, beschloss Viviana, es jetzt gut sein zu lassen. Das Gefühl des Sieges war berauschend, aber sie wurde langsam müde. Genug Personenkult, dachte sie. Die Bewunderung der Menschen allzu sehr anzustacheln war gefährlich. Von Anfang an hatten Martina, Eva, Rebeca und Ifigenia darauf gedrängt, dass sie ihre magische Wirkung auf die Massen einsetzen sollte. Wieder und wieder stellte sie sich der Herausforderung und brachte die Menge auf den Höhepunkt der Begeisterung. Doch dann spürte sie den mütterlichen Drang, die Menschen zu beruhigen und ihnen Wiegenlieder zu singen oder Geschichten zu erzählen, so wie sie es mit ihrer Tochter machte, nachdem sie einander lachend durchs Haus gejagt und durchgekitzelt hatten. Als Celeste noch klein war, vermochte Viviana sie immer auf diese Weise zu besänftigen, bis sie schläfrig wurde und bereit war, sich die Zähne zu putzen und den Schlafanzug anzuziehen. Bei der Menge konnte sie nicht die gleiche Methode anwenden, deshalb probierte sie es jetzt auf andere Weise: Sie entspannte sich, fiel in einen ruhigeren Schritt und winkte sanfter, ging langsamer, immer langsamer im Kreis. Sie bedeutete ihren Gefährtinnen, die gemeinsam mit ihr die PIE gegründet hatten, auf die Bühne zu kommen und Hand in Hand mit ihr zu schreiten, wie Schauspieler am Ende eines Theaterstücks. Sie sollten auch diesen Sieg auskosten, der ihnen genauso gehörte. Eva Salvatierra, Martina Meléndez, Rebeca de los Ríos und Ifigenia Porta waren attraktive, energiegeladene Frauen wie Viviana. Die zierliche Eva hatte rotes Haar, Sommersprossen und eine hohe Mädchenstimme, die nicht zu ihrer resoluten Art zu passen schien. Martina war dunkelblond, eher vollschlank und hatte glattes Haar. Sie besaß einen extrem respektlosen Humor. Der Blick ihrer kleinen, dunklen Augen stellte grundsätzlich alles in Frage. Rebeca de los Ríos, großgewachsen, dunkel, gertenschlank (wie es eine Kitschautorin genannt hätte), war eine geheimnisvolle Schönheit und die eleganteste Erscheinung der Gruppe. Ifigenia oder Ifi, wie man sie nannte, hatte eine schmale Figur und ein ovales Gesicht mit großer Nase; allen gefiel, dass sie Virginia Woolf so sehr glich.
Der Applaus schwoll noch einmal an, ebbte jedoch schnell ab, als Viviana zu sprechen begann: Wir wollen nach Hause gehen, sagte sie ruhig und leise ins Mikrophon, lächelte und wiederholte mehrfach wie ein Mantra »Danke, danke«, voll Freude und Staunen, weil so viele Menschen Vertrauen in sie und ihre Regierung setzten.
In diesem Moment wurde die Begeisterung der Zuhörer normalerweise weniger, verließ Leiber, Kehlen und Münder, als wäre sie ein erschöpfter Geist, der sich am Ende eines Festes verflüchtigt. Sie war immer wieder fasziniert davon: Die Energie verließ die Körper wie Wasser, das um die Häuserecken verschwindet. Die Menge strömte auseinander, öffnete sich wie eine Hand beim Abschiedsgruß.
Dieser Tag hielt jedoch noch eine Überraschung bereit: ein Feuerwerk, gestiftet von der chinesischen Botschaft. In der Ferne waren die ersten Raketen zu hören. Die Menge hielt inne. Ein großer Schirm aus leuchtend rosa Sternen senkte sich auf den Platz. Dann folgten strahlend helle Blüten, grüne Kerzen, blaue Lichtdome und gelbe Bögen. Alle blickten nach oben, um das Schauspiel zu sehen, und Rufe der Bewunderung waren zu hören.
Viviana strahlte vor Freude, sie liebte Feuerwerke. Als Ministerin für Sicherheit und Verteidigung hatte Eva geplant, dass sie und die anderen die Bühne verlassen und dem Schauspiel von einem sichereren Ort aus zusehen sollten, doch Viviana rührte sich nicht von der Stelle, war gefangen vom Glanz der Lichter und dem hell erleuchteten Himmel über der Menge. Nur weil sie von ihrer Hauptrolle im Spektakel befreit war und sich ihr Adrenalinspiegel wieder zu normalisieren begann, bemerkte sie den Mann, der sich, eine blaue Baseballcap auf dem Kopf, einen Weg durch die Menge bahnte. Sie sah ihn näher kommen und dicht vor ihr die Arme heben. Zu spät begriff sie seine Absicht. Sie hörte den Schuss nicht. Eine Hitzewelle traf ihre Brust und den Kopf, und sie verlor das Gleichgewicht. Hilflos taumelte sie rückwärts und schlug der Länge nach hin. Sie hörte Schreie und sah einen Mann, einen guten Samariter, auch er mit einer Mütze auf dem Kopf, der sich erschrocken über sie beugte. Die Gesichter von Eva, Martina und Rebeca spiegelten sich wie in einem Teich in der schillernden Flüssigkeit, in der sie langsam versank. Als sie das klagende Heulen der Krankenwagen hörte, glitten ihre Gedanken schon in eine große Stille hinein, als habe ihnen jemand ein Tor geöffnet.
Vollständige Abschrift des Berichts von José de la Aritmética
Eva Salvatierra: Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihre persönlichen Daten.
J. A.: José de la Aritmética Sánchez, fünfzig Jahre alt, verheiratet, wohnhaft im Volga-Viertel … Reicht das oder soll ich noch mehr sagen?
E. S.: Das reicht. Don José, erzählen Sie mir bitte, was auf dem Platz geschehen ist. Wo waren Sie, als die Schüsse fielen? Und was haben Sie gesehen?
J. A.: Also gut, wenn ich Ihnen sagen soll, wer meiner Meinung nach die Schüsse abgegeben hat, dann müssen Sie meine Geschichte von Anfang an hören. Ich glaube nämlich, dass die Dinge nicht einfach so passieren, und ich möchte Ihnen meine Eindrücke erzählen von dem Tag an, als Viviana Präsidentin wurde. Damals war ich ja auch dabei, wissen Sie? Ich bin auf jeder Kundgebung, jeder Versammlung und jeder Demonstration. Ich lebe von jeder Art Menschenansammlung, die sind für mich wie Weihnachten für die Händler. Jeder, der in der prallen Sonne steht, mag schließlich ein Raspado, ein Raspeleis, und meins ist vom Feinsten. Sie wissen schon, einfach geschabtes Eis in einen Plastikbecher, schön dick Fruchtsirup drüber und fertig. Richtig lecker, Sie sollten mal eins probieren.
Aber ich schweife ab. Dass ihr Frauen uns mal regieren würdet, hätte ich mir nie träumen lassen. Ich gebe zu, als der Wahlkampf losging und eure Partei mit dem Frauenfuß auf der Fahne antrat, habe ich noch gelacht. Ihr hattet zwar mit Viviana Sansón eine bekannte Persönlichkeit als Kandidatin, aber das schien mir zu wenig. So wie die Kutte noch keinen Mönch macht, ist eine Fernsehsendung noch kein politisches Programm. Zugegeben, ich fand euch alle sehr klug. Als ihr sagtet, ihr hättet die Nase voll davon, dass wir Männer das Land zugrunde richteten, die Staatskasse plünderten und korrupt seien, da hab ich sofort verstanden, was gemeint war, auch wenn ich keine Frau bin. Warum sollte ich lügen: Mir gefiel die Idee, dass ihr die Mütter aller Notleidenden sein wolltet, dass ihr das Land reinigen wolltet wie ein schmutziges Haus, dass ihr es putzen wolltet, bis es wieder blitzblank war. Sie hätten sehen sollen, wie begeistert meine Frau und meine Töchter waren, als sie das hörten. Das mit der Erotik, das fand ich schon ein bisschen seltsam, erotisch nennt man ja eigentlich immer die Kalender, die zu Weihnachten an den Tankstellen verschenkt werden und auf denen leicht bekleidete, üppige Frauen zu sehen sind. Dass ihr darüber spracht, das fand ich nicht seriös. Es schien mir nicht in die Reden darüber zu passen, was für eine Regierung unser Land braucht. Ich will aber klarstellen, dass ich nicht zu denen gehöre, die euch kritisieren, weil ihr es in Ordnung findet, dass jeder ins Bett geht, mit wem er will: Männer mit Frauen, Frauen mit Frauen, Männer mit Männern. Da mische ich mich nicht ein. Jeder kann schließlich mit seinem Schlüpfer oder seinem Hosenstall machen, was er will. Das ist jedermanns eigene Sache, und die Erklärungen soll er dem Herrn da oben geben. Solange ich so was nicht selbst miterleben muss, macht’s mir nichts aus. Vielleicht liegt es an meinen fünf Töchtern, dass ich sage: Gott bewahre, ich mache den Mund nicht auf, sonst fallen sie über mich her. Ich darf ja nicht mal Tunten Tunten nennen … Das sind jetzt auf einmal Schwule, Gays oder so.
E. S.: Don José …
J. A.: Schon gut, entschuldigen Sie, aber ich glaube, es ist gut, dass Sie hören, was einer wie ich denkt, ein ganz normaler Bürger. Sie wissen ja, was los war, als der Vulkan ausbrach, und wie es uns Männern ging, als die dunklen Tage vorbei waren: Wir waren völlig fertig, total passiv. Niemand hat sich euch widersetzt. Mit den Stimmen der Frauen konntet ihr die Präsidentschaft und die Mehrheit in der Nationalversammlung erringen. Wir Männer hatten für nichts Energie, es war, als hätte man uns den Stecker rausgezogen. Ich erinnere mich noch gut an das merkwürdige Gefühl, das uns alle außer Gefecht setzte, uns ganz sanft machte, ganz unterwürfig. Großer Gott! Gütiger Himmel! Was waren das für Tage! Sie hätten nur sehen sollen, wie meine Nachbarinnen lachten, als sie mich mit meinem Raspado-Karren zu eurer Siegesfeier schleichen sahen wie einen Hund mit eingezogenem Schwanz. Damals schienen wir Männer nie wieder die Köpfe zu heben. Aber natürlich sollte das Beste noch kommen – bitte nicht ungeduldig werden –, nämlich als die Präsidentin ein Dekret erließ, dass ihr gesamtes Kabinett und auch die Führung von Armee und Polizei nur aus Frauen bestehen sollte; dass in eurer Verwaltung kein einziger Mann Platz haben sollte, nicht einmal als Fahrer oder Wachmann oder Soldat. Erinnern Sie sich? Viviana sagte damals, dass die Frauen eine Weile allein regieren müssten und dass die Männer sich derweil ausruhen, auf die Kinder aufpassen und sich um das Haus kümmern sollten. So könnten sie sich von den giftigen Gasen erholen und dem Mangel an diesem Hormon, wie heißt es doch gleich?
E. S.: Testosteron, Don José, der Rauch aus dem Vulkan hat eure Testosteronwerte gesenkt; so heißt das Hormon.
J. A.: Das kann ich gar nicht richtig aussprechen. Toston sagen sie bei mir im Viertel dazu. Auf jeden Fall hat man, wie Sie wissen, die Männer einfach nach Hause geschickt. Diesen Extremismus fand ich gar nicht gut. Als die meisten in der Regierung noch Männer waren, blieben die Frauen immerhin Sekretärinnen, Buchhalterinnen, Putzfrauen … Jetzt sollten wir Männer nicht mal mehr dafür taugen. Und ich denke, wenigstens die Chauffeure hätten bleiben sollen. Wenn einmal ein Wagen eine Panne hat, ein Reifen platt ist, dann können die Frauen das doch nie und nimmer so reparieren wie ein Mann. Es gibt Dinge, die können die einen eben besser als die anderen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich diskutiere ja auch nicht mit meiner Frau über die besten Zutaten für ihre Sirupsorten. Sie weiß eben besser als ich, welches die besten Ananas sind, wie viel Zucker in die Milch gerührt werden muss, wie lange sie kochen soll …
E. S.: Damit Sie’s wissen, Don José, die besten Köche der Welt sind Männer. Und außerdem ist diese Maßnahme ja nur vorübergehend.
J. A.: Aber Sie sehen ja, wie viel Unmut das bei einigen ausgelöst hat. Sicher war der, der auf die Präsidentin geschossen hat, einer, der sich gekränkt fühlt.
E. S.: Kann sein. Das werden wir noch herauskriegen. Erklären Sie mir mal eines, Don José: Weshalb heißen Sie eigentlich José de la Aritmética?
J. A.: Meine Mutter konnte nicht lesen und schreiben. Sie wollte mir den Namen jenes Heiligen geben, der Jesus ins Grab legte.
E. S.: Josef von Arimathia?
J. A.: Kann sein. Sie meinte jedenfalls, dass Aritmética wie ein kluger Mensch klingt.
E. S.: Jetzt frage ich Sie: Haben Sie den Mann gesehen, der schoss?
J. A.: Also, richtig gesehen habe ich ihn nicht. Ich passte ja vor allem auf meinen Karren auf. Wie Sie sicher wissen, treiben sich bei solchen Versammlungen auch immer viele Freunde fremden Eigentums herum, außerdem brennen mir vom Feuerwerk die Augen. Und wenn man eins gesehen hat, hat man ja eigentlich alle gesehen, nicht wahr? Ich kann nicht viel daran finden. Also habe ich mich langsam an der Bühne vorbei auf den Heimweg gemacht, bevor die Leute alle auf einmal loszogen, und da sah ich plötzlich, wie die Präsidentin wie angewurzelt stehen blieb. Und dann machte sie diese komischen Bewegungen von Leuten, die eins abgekriegt haben; ihr ganzer Körper wurde hin und her geschüttelt. Da hab ich keine Sekunde überlegt, wissen Sie. Mir war klar, dass es sie erwischt hatte. Ich sprang auf meinen Karren und von dort auf die Bühne und kam gerade rechtzeitig, um sie fallen zu sehen. Sie sah mich ganz erschrocken an. Mir läuft jetzt noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke.
E. S.: Was meinen Sie, woher kam der Schuss?
J. A.: Genau von vorn. Jemand stand vor ihr, auf der anderen Seite der Absperrung.
E. S.: Und haben Sie ihn gesehen? Können Sie ihn beschreiben?
J. A.: Als ich neben der Präsidentin kniete, habe ich mich umgedreht und in die Menge geschaut. Da sah ich, wie sich jemand zwischen den Menschen hindurchdrängte, er trug eine Mütze, eine dunkle Schirmmütze, ich glaube, sie war blau.
E. S.: Ein Mann also?
J. A.: Ich glaube ja. Es ging aber alles sehr schnell, ratzfatz, am besten glauben Sie mir nicht, was ich da erzähle; es kann gut sein, dass ich mich irre, das ging alles so schnell. Aber ich meine, dass ich das wohl so gesehen habe. Wenn mir noch was einfällt, sage ich Bescheid.
E. S.: Haben Sie einen Knall gehört?
J. A.: (Schweigen) Jetzt, wo Sie es sagen: Ich habe das Feuerwerk gehört, aber keinen Schuss. Komisch, nicht? Und entschuldigen Sie, dass ich frage: Wie geht es der Präsidentin?
E. S.: Sie ist im Hospital. Wir werden über ihren Zustand berichten. Ich möchte Sie um etwas bitten, Don José. Sie sind doch viel unterwegs und reden mit Leuten – könnten Sie da nicht ab und zu vorbeikommen und uns erzählen, was Sie so hören? Vielleicht steckt noch mehr hinter all dem, verstehen Sie? Und außerdem ist es, wie Sie selbst sagen, wichtig, Bürgern wie Ihnen zuzuhören. Hier, nehmen Sie meine Karte. Rufen Sie diese Nummer an. Wenn ich nicht da bin, fragen Sie nach Hauptfrau Marina García. Die kümmert sich dann um Sie, einverstanden?
Als Viviana Sansón erwachte, fuhr sie sich erschrocken an die Brust. Sie befühlte ihre Rippen und fürchtete, Blut zu spüren, doch als sie ihre Hand vor die Augen hob, war diese ganz trocken. Seltsam! Und seltsam auch diese Stille. Grabesstille. Sie erschauerte. Kein Krankenwagen war mehr zu hören und auch nicht die Schreie der Leute und die aufgeregten Stimmen von Eva, Martina und Rebeca. Sie war allein, völlig allein. Über sich sah sie ein Wellblechdach und darunter Holzbalken, dicke Drähte und Glühbirnen, die ein schummriges, gelbliches Licht verströmten. Wie war sie nur hierhergekommen? Trotz der merkwürdigen Umgebung verspürte sie keine Panik; eher Verblüffung, ein träges Gefühl des Staunens. Langsam richtete sie sich auf. Mir tut nichts weh, dachte sie erleichtert. Vor sich sah sie im blassen Schein der Glühbirnen einen langen Gang. Auf beiden Seiten des Gangs standen massive Holzregale, in denen Objekte aufgereiht waren, die sie nicht genau erkennen konnte. Es sah aus wie ein Abstellraum. Was machte sie in einem Abstellraum? Hätte sie nicht in einem Hospital sein müssen? Sie hatte Angst aufzustehen. Deshalb setzte sie sich aufrecht und schlug die Beine übereinander. Dann schloss sie die Augen.
Als sie sie nach einer Weile wieder öffnete, schien das Licht stärker geworden zu sein. Der Raum war in ein bleiernes Grau getaucht. Die Wände, der Boden, die Regalbretter sahen seltsam sauber aus. Wenigstens gab es keinen Staub. Sie war allergisch gegen Staub. Das Ende des Gangs war kaum auszumachen. Ob es da wohl eine Tür gab? Hinter sich konnte sie keinen Ausgang sehen, dort war es sehr dunkel. Langsam stand sie auf und stellte fest, dass sie keine Schmerzen verspürte, sondern eine ungewohnte Leichtigkeit. Ihre Bewegungen waren so fließend, dass sie ihr nicht fremd schienen. Als sie sich endlich erhoben hatte, sah sie sich erneut um. Die Regale waren jetzt deutlicher zu erkennen. Sie schaute nach rechts und links. Die Gegenstände kamen ihr bekannt, ja, vertraut vor, sie war sich sicher, sie schon einmal gesehen zu haben. Sie ging ein Stück, aber die Entfernung zwischen ihr und der Tür schien nicht geringer zu werden. Auf dem rohen Holz der Bretter sah sie Schlüsselbunde, Bücher, einen Schuh, ein Handtuch, einen Ring, ein Armband, eine Kaffeekanne, mehrere Sonnenbrillen, Lesebrillen, viele verschiedene normale Brillen, zahllose Regenschirme, Pullover, teuren Schmuck und Modeschmuck, Kosmetikartikel, kleine, schmale Taschenrechner, Geldbörsen, Mobiltelefone, Kameras, die Taschenlampe, die sie immer auf Flugreisen mitnahm – für den Fall, dass das Flugzeug abstürzte und sie den Weg aus dem zerbrochenen, rauchenden Rumpf finden musste –, Augentropfen, Kleenexpäckchen, Feuerzeuge, viele Feuerzeuge und Zigarettenetuis aus der Zeit, als sie noch rauchte, Brieftaschen, die man ihr gestohlen hatte, in Hotels vergessene Steckdosenadapter, Haartrockner, Reisebügeleisen, den Mantel von Sebastián, Schirmmützen, Hüte, die sie nie getragen hatte, Regencapes, Halsketten aus der Zeit, als sie gern schweren, bunten Schmuck trug, Kissen und Decken von den Wochenenden bei Freunden, Koffer, Taschen, Teller und Tassen, Dosenöffner und Korkenzieher, Bestecke, Gläser, Weingläser wie die, die man gern am Strand vergisst, gerahmte oder ungerahmte Fotos, Stofftiere aus ihrer Kindheit, ihre Solitaire-Karten, Handcremetuben … Dinge, die sie irgendwann mal verloren hatte. Wie waren sie hierhergekommen? Was hatte das zu bedeuten? Du lieber Himmel, dachte sie, alles, was ich jemals irgendwo verloren oder vergessen habe, liegt hier!
Nachdenklich schob José de la Aritmética den Raspado-Karren in sein Viertel zurück und hinterließ eine wässrige Spur von geschmolzenem Eis. Das Kopfsteinpflaster ließ die Deckel der Eiskübel klappern.
Er konnte es ja gar nicht fassen. Da zuckelte er nun bedrückt nach Hause, beklagte das Geschehene, war beschämt. Es stimmte wohl, was die Frauen sagten, nämlich dass Männer einen Hang zur Gewalt hatten. Warum musste denn jemand auf die Präsidentin schießen? Herrgott noch mal!
Vielleicht war er ja zu weich, aber ihm wäre so etwas nie in den Sinn gekommen. Er war unter lauter Mädchen aufgewachsen – der einzige Junge unter zehn Geschwistern –, vielleicht war er deshalb ein halber Feminist. Gott behüte, nie hätte er die Hand gegen eine erhoben, die anderen hätten ihn sofort fertiggemacht. Zudem mochte er sie alle, er liebte sie. Er mochte die Frauen so, wie sie waren. Als Kind fühlte er sich von ihnen beschützt. Später dann hatte ihn der Machokult dazu gebracht, sie zu beschützen, aufzupassen, dass keine anderen Männer an sie herankamen. Seine ältere Schwester – er war der Zweitälteste – trug ihm auf, die Jüngeren zu beaufsichtigen. Sie, die Mutter und die anderen sagten zwar immer wieder, dass er »der Mann im Haus« wäre, doch in Wirklichkeit waren sie es, die bestimmten. Ihn benutzten sie nur als Aushängeschild, damit die Welt sah, dass sie als Frauen nicht schutzlos waren. Der Vater arbeitete als LKW-Fahrer und war fast immer unterwegs. Diese Gewohnheit, Frauen zu beschützen, hatte ihn auch sofort reagieren lassen, als er die Präsidentin fallen sah.
Sie finden meinen Namen zum Lachen, stimmt’s? Ihrer klingt aber auch wie erfunden, hatte er zu Eva Salvatierra gesagt. Salva-tierra – die Retterin der Erde. Eine hübsche Frau. Schlank, gut proportioniert und rothaarig. Und man sah, dass ihre Haarfarbe echt war. Ein Mähne wie eine Feuersbrunst und die Lippen so wohlgeformt. Wo er gewesen war, als die Schüsse fielen? Ob er gesehen hatte, wer es war? So bedrängte sie ihn mit Fragen, denn man hatte den Täter nicht gefasst. Weil alle Leute, auch die Polizisten, vom Feuerwerk abgelenkt in den Himmel schauten, war man viel zu spät hinter dem Attentäter hergelaufen. Viele der Polizistinnen waren noch sehr jung und ohne Erfahrung. Außerdem war die Präsidentin nicht vorsichtig. Sie bewegte sich gern ungezwungen. Das war zwar ganz nett, aber eben auch gefährlich. Dieser Wunsch nach KONTAKT kostete die Arme jetzt hoffentlich nicht das Leben. Sie hatte ziemlich schlecht ausgesehen, als sie dort auf der Bühne lag. Er wusste gar nicht, wie er so schnell zu ihr hinaufgekommen war. Er war auf seinen Wagen gesprungen und von dort mit einem Satz auf die Bühne, als hätte er Sprungfedern an den Beinen. Er wollte so schnell wie möglich zu ihr. Alle anderen standen vor Schreck wie angewurzelt. Er schaffte es noch, sich über die Präsidentin zu beugen, dann packte ihn diese Eva Salvatierra höchstpersönlich am Hemdkragen. Weil er den guten Samariter gespielt hatte, war er sogar verdächtigt worden. Immerhin hatte die Ministerin sich bei ihm entschuldigt und sogar gebeten, er möge mit ihnen zusammenarbeiten.
Düsteren Gedanken nachhängend, schlurfte José de la Aritmética vorwärts. Er, der selten müde wurde, fiel jetzt fast um vor Erschöpfung. Er konnte sich nicht erinnern, jemals einen solch langen Tag erlebt zu haben, dabei war noch nicht mal Abend. Hinter der Kette der Vulkane, die die Stadt umgaben, wurde es dunkel, und die großen Wolken am Himmel sahen zerzaust aus, ihre bauschigen Rundungen waren zu diffusen grauen Streifen geworden. Schon von weitem sah er Mercedes, seine Frau, mit den Töchtern in der Haustür stehen. Auch er hatte nur Mädchen, insgesamt fünf. Alle trugen die Namen von Blumen: Violeta, Daisy, Azucena, Rosa und Petunia. Die Jüngste wies mit dem Finger auf ihn, kaum dass sie ihn entdeckt hatte, kam zu ihm hergelaufen und schickte sich an, das Wägelchen zu schieben. Mercedes’ Gesicht hellte sich auf, als sie ihn kommen sah. Sie war wirklich gut, seine Frau. Er hatte sie geheiratet, weil sie schwanger geworden war, doch er hatte es nie bereut. Sie aß gern und war entsprechend rundlich, aber sie hatte ein hübsches Gesicht und ein fröhliches Wesen, war angenehm und zupackend. José überließ Petunia den Karren und tätschelte ihr dankbar den Kopf. Nachbarn standen in Gruppen auf der Straße und sprachen über das Geschehene. Sicher hatte sich schon herumgesprochen, dass er auf die Bühne gesprungen war. Mehr als einer hatte gesehen, wie er versuchte, der Präsidentin zu helfen. Außer Azucena, die bei der Polizei arbeitete, waren seine Töchter alle da. Seine Familie und die Nachbarn umringten ihn. Don José, was haben Sie gehört? Was ist mit der Präsidentin, ist sie tot?
»Keiner weiß Genaues«, sagte er. »Entschuldigt, aber ich muss mich setzen.«
Er setzte sich auf den Stuhl, den Rosa ihm hinschob. Dann steckte er sich eine Zigarette an und stieß eine Rauchwolke aus. Mercedes brachte ihm ein Glas Wasser. Er konnte sehen, dass sie geweint hatte.
»Das ist alles ganz schrecklich«, sagte sie. »Furchtbar, dass man auf eine Frau schießt. Es ist, als habe man auf uns alle geschossen. Hat man den Attentäter gefasst?«
»Nein«, antwortete José, »er ist ihnen entwischt.«
»Dass sie eine Frau ist, spielt keine Rolle«, sagte ein Nachbar mit weitem Hemd und gelben Latschen. »Auf Präsidenten sind immer schon Attentate verübt worden. Man hätte besser nachdenken sollen, bevor man nur Polizistinnen zu ihrem Schutz abstellt. Männer haben mehr Erfahrung mit so was.«
»Also hören Sie mal, als ob das eine solche Tat rechtfertigen würde!«, regte sich Daisy auf. »Und die Präsidenten, die man umgebracht hat? Die sind doch von Männern beschützt worden, oder? Denken Sie bloß an Präsident Kennedy!«
»Wir müssen abwarten«, sagte Violeta, die älteste Tochter, knochig von Statur und spröde im Wesen. Sie trug ein gelbgrün gestreiftes Kleid und hatte ihr langes Haar mit einem ausgefransten Band zusammengebunden. »Ich hoffe, dass die nächste Regierung wenigstens die Volksküchen und die Kindertagesstätten beibehält.«
»Weshalb meinst du denn, dass es eine andere Regierung geben wird?«, fragte Daisy. »Es müssen einfach noch mal dieselben gewinnen. Das hängt doch von uns ab.«
»Ihr seid ein bisschen voreilig«, warf José de la Aritmética ein, ganz überrascht, wie schnell sich jeder eigenen Sorgen zuwandte.
»Und wenn sie nicht gewinnen? Meinst du denn, dass die Männer noch mal für sie stimmen werden?«
»Ich würde wieder für sie stimmen, damit ihr Frauen weiter so gut arbeitet«, sagte José mit schiefem Grinsen.
»Also, ich weiß nicht«, mischte sich der Mann mit den gelben Latschen ein. »Ein paar Sachen haben sie ja ganz gut gemacht, aber uns Männern haben sie die Welt ordentlich auf den Kopf gestellt. Früher änderte sich das Leben nicht so, wenn es eine andere Regierung gab, aber die hier haben sich total ins Privatleben eingemischt.«
»Aber das finde ich doch gerade gut«, ereiferte sich Violeta. »Sie wollten, dass wir zu Hause glücklich sind.«
Und so ging die Diskussion weiter, bis vom benachbarten Speisesaal die Glocke zu hören war. Schon seit einem Jahr gab es im Viertel einen Plan, um die Hausarbeit für alle zu erleichtern. Die Familien – Männer und Frauen – kochten abwechselnd das Abendessen für die Nachbarn. Es wurde im Gemeinschaftshaus ausgegeben, das sie alle zusammen gebaut hatten und das auch als Versammlungsraum und Klassenzimmer für den Schreibunterricht diente. Die Regierung hatte das Baumaterial gestellt, nachdem die Bewohner des Viertels einen Vertrag unterschrieben, der die Erwachsenen, die nicht lesen und schreiben konnten, dazu verpflichtete, an der Alphabetisierung teilzunehmen. Die anderen gingen einmal die Woche zum Lesekreis. Dort las einer der Jugendlichen, die schon in der Oberstufe waren, aus einem Buch vor, das die Teilnehmer vorgeschlagen hatten.
Während des Essens wurde für die Präsidentin gebetet, einige weinten, und die meisten zogen sich nach dem Abräumen und Geschirrspülen früh nach Hause zurück, in der Hoffnung, in den 22-Uhr-Nachrichten etwas über den Gesundheitszustand der Präsidentin zu erfahren.
José de la Aritmética wartete mit Mercedes auf die Nachrichten und tröstete sie, weil sie immer wieder in Tränen ausbrach. Sie konnte einfach nicht fassen, was geschehen war. Schließlich ging sie schlafen, und er blieb und rätselte weiter, weil es keine offiziellen Informationen gab. In den Nachrichten hatte man nur Bilder vom Attentat und von dem Menschenauflauf gebracht, der vor dem Hospital auf Neuigkeiten wartete.
In der Stille des Abstellraums ging Viviana verwirrt und nachdenklich hin und her. Sie vermochte sich nicht zu erklären, wie sie dorthin gelangt war, was sie dort sollte. Jemand hatte auf sie geschossen, aber sie blutete nicht und verspürte auch keinen Schmerz. Ob sie tot war? Aber sie konnte doch nicht tot sein, wenn sie sich so wach fühlte. Und Celeste, wo war Celeste? Sie nahm sich vor, ruhig zu bleiben und abzuwarten. Vielleicht war es ja ein Traum, eine Ohnmacht.
Sie fragte sich, ob es in dieser Ansammlung verlorener und vergessener Gegenstände irgendeine Ordnung, irgendeine Absicht gab, und trat an das linke Regal. Dort sah sie eine Sonnenbrille, einen Seidenschal mit Klatschmohnmuster, ein Paar weiße Stiefel, einen Schlüsselbund und einen von Martinas Steinen. Sie musste lachen. Es war ein Stück Lava, ein dunkler Bimsstein. Martina, immer zu Späßen aufgelegt, hatte daraus eine Art Trophäe anfertigen lassen: Der Bimsstein war auf ein Stück Holz montiert, dazu eine kleine Metallplatte mit der Inschrift »Herzlichen Dank«. Das ist die Siegeslava, hatte sie gesagt, während sie einer jeden der fünf eine solche Auszeichnung überreichte. Viviana nahm das Souvenir zur Erinnerung an den Ausbruch des Mitre-Vulkans in die Hand.
Welche Ironie der Geschichte. Sie hatten ja verkündet, dass es ihr Auftrag war, zu reinigen, zu putzen, das Land wieder auf Vordermann zu bringen. Aber nie hätten sie sich träumen lassen, dass Mutter Natur ihnen den großen Dienst erweisen würde, etwas geschehen zu lassen, das ihnen den Weg wie mit Bimsstein freischrubben würde.
Als sie den Gegenstand umschloss, spürte sie ein leichtes Kribbeln in den Fingern. Urplötzlich hüllte sie die Erinnerung ein wie ein Hologramm, das man von außen und innen gleichzeitig betrachten kann. Das Licht, die Gerüche, die Zeit, die der Stein wieder aufleben ließ, nahmen Gestalt an. Sie fühlte sich in das Land ihrer Erinnerung zurückkatapultiert.
Sie sah ihre Füße, die braunen Sandalen, den gelben Rock, das weite weiße T-Shirt, das sie an jenem Tag trug, als sie das Wahlkampfbüro der Partei betrat. Das Haus, das sie gemietet hatten, war alt, aber gemütlich, es besaß einen Innenhof, in dem Rasen wuchs, den bunte Büsche einrahmten. Die Fassade war im Kolonialstil gehalten, und um den Innenhof führte ein wunderschöner Bogengang. Das größte Zimmer mit Balkon im oberen Stockwerk war ihr Büro.
Sie betrat die Halle, die sie als Besprechungsraum nutzten, sah die Wahlplakate an den Wänden und setzte sich zu den anderen an den Konferenztisch. Juana de Arco, ihre Assistentin, stach farbige Nadeln in die Landkarte an der Tafel, während sie selbst, Martina, Eva, Rebeca und Ifigenia über die beste Route für die Wahlkampftour diskutierten. Die Daten der letzten Volkszählung zeigten ihnen, wo die Gegenden mit der größten Bevölkerungsdichte lagen, sie jedoch hatten sich vorgenommen, die entlegensten Weiler und Landstriche zu besuchen, dorthin zu gehen, wo sonst niemand hinging.
»To go where no man has gone before«, zitierte Martina die Fernsehserie Star Trek.
»Meine Mutter war ein totaler Fan dieser Serie«, meinte Eva und summte die Filmmelodie.
Wie kam es, dass sie sowohl in ihrem früheren Körper war als auch außerhalb?, fragte sich Viviana, streckte die Hand aus und konnte sie quer durch Martinas Bluse führen. Ich sehe eine Erinnerung, wurde ihr klar, ich sehe sie wie eine Filmvorführung. Ich sehe mein eigenes Bild, aber es ist nur meine Erinnerung. Vielleicht sollte sie mit ihrer Vergangenheit verschmelzen, sie noch einmal leben.
Sie lachten gerade ausgelassen, als sie plötzlich das Grollen eines Erdbebens unter ihren Fußsohlen hörten. Sie sprangen auf, bereit, auf die Straße zu laufen. Viviana spürte, wie furchtbare Angst ihr das Adrenalin in die Adern schießen ließ.
»Es hat sich nichts bewegt«, sagte Ifigenia. »Das hörte sich an wie ein Erdbeben, aber es hat sich nichts bewegt.«
Viviana sah auf die Uhr: zehn nach drei am Nachmittag.
»Es hat wohl nur so geklungen«, sagte sie und atmete hörbar aus, bemühte sich, ruhiger zu wirken, als sie sich fühlte. »Wirklich seltsam, aber lasst uns weitermachen.«
Juana de Arco griff wieder zu ihren bunten Nadeln und begann mit dem Wo, Wie, Mit wem und Wozu jeder Wahlveranstaltung. Doch Minuten später grollte die Erde erneut, und jetzt wurden Tisch, Stühle, das ganze Haus durchgerüttelt, als litten sie unter furchtbarem Schüttelfrost. Anstatt hinauszulaufen, schauten sie sich nur entsetzt an. Martina griff nach ihrer Hand und drückte sie fest. Habt ihr das gemerkt?, fragte sie, als könne sie nicht fassen, dass sie immer noch so ruhig dasaßen.
»Keine Panik«, sagte Viviana und machte beruhigende Handbewegungen, obwohl sie ihren Herzschlag in den Ohren dröhnen hörte. »Rennt nicht einfach los, bewegt euch ganz ruhig.«
Eva lief in ihr Büro, um ein Radio zu holen und zu erfahren, ob es Nachrichten von der Erdbebenkontrolle gab. Ifigenia griff zu ihrem Laptop und wollte im Internet nachschauen.
»Es kommt vom Mitre-Vulkan«, meldete sie nach kurzer Zeit.
Dann kam Eva mit dem Radio zurück, sie hatte es schon eingeschaltet. Man verlas gerade einen Bericht. Vom Vulkan waren das Getöse eines Ausbruchs und eine schwarze Rauchsäule über dem Krater gemeldet worden. Viviana schlug vor, die Unterlagen wegzulegen. Sie dachte an Celeste, an Consuelo. Als hätten sie sich abgesprochen, griffen Ifigenia, Rebeca und sie selbst zu ihren Mobiltelefonen. Alle drei hatten sie Kinder.
Die hohen, feuerspeienden Berge von Faguas hatten keinen kleinen Prinzen, der ihnen ab und zu den Schlot kehrte, so wie der es mit den kleinen Vulkanen seines Landes gemacht hatte; sie spien Asche und Lava aus und reinigten sich selbst. Der Vulkan Mitre war ein wunderschönes Exemplar, das die Stadt jahrhundertelang wie ein riesiges, kegelförmiges Mammut bewacht hatte. Der Vulkan war Ursprung vieler Legenden in Faguas. Die Chronisten der Kolonialzeit berichteten, dass die ersten spanischen Siedler Mitte des 16. Jahrhunderts vor einem seiner Ausbrüche geflohen waren. Nach einem überstürzten Exodus mit Pferd und Wagen ließen sich die Siedler schließlich am See nieder und gründeten dort die Hauptstadt des Landes. Allzu weit waren sie nicht gezogen. Von der Stadt aus konnte man den perfekten grauen, hier und da von rötlichen Streifen überzogenen Kegel gut erkennen. Wie ein hoher Wächter am Horizont fing der Mitre die Wolken, wand sie sich wie eine Stola um den Hals und ließ in der untergehenden Sonne lange rosa- und purpurfarbene Fahnen wehen.