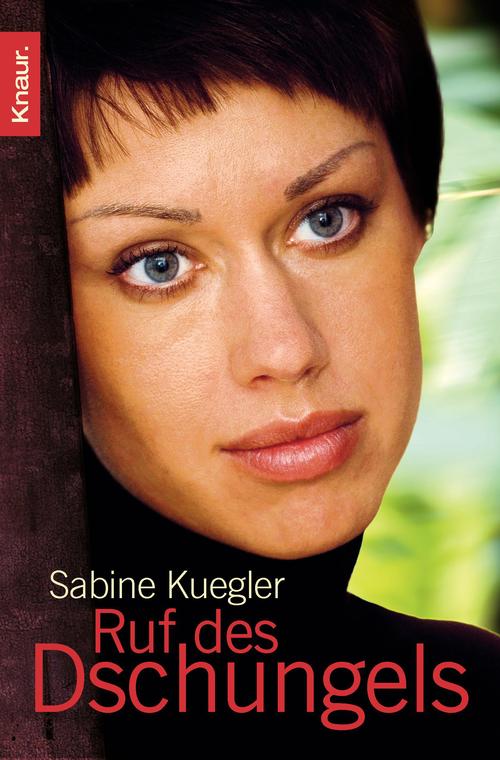
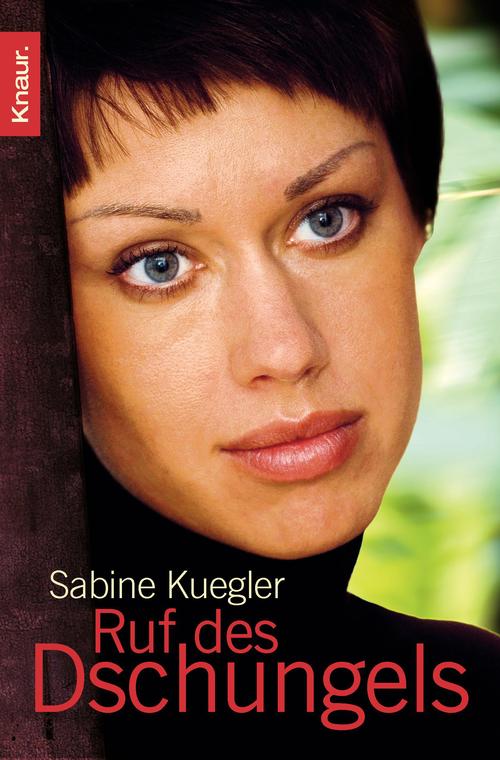
Sabine Kuegler
Ruf des Dschungels
Knaur e-books
Bei den Fayu, einem vergessenen Stamm in West-Papua, war sie einst glücklich, hat gefühlt und gehandelt wie eine Eingeborene. Mit vielen der Freunde von einst feiert sie nun ein ergreifendes Wiedersehen. Doch der magische Ort von damals hat sich verändert. Als erwachsene Frau kann Sabine Kuegler die Augen nicht davor verschließen, was in West-Papua geschieht: Das abgeschiedene Leben der Fayu ist bedroht. Menschen verschwinden, Menschen sterben. Und Sabine Kuegler erkennt: Sie muss das Kind in sich zurücklassen, um das Land und die Menschen zu schützen, die ihr so viel gegeben haben.
Sie war »das Dschungelkind« – doch seit Sabine Kuegler das Paradies ihrer Kindheit verlassen musste, ließ die Sehnsucht sie nicht mehr los. Nun ist sie zurückgekehrt, um herauszufinden: Wo gehöre ich hin?
Bei den Fayu, einem vergessenen Stamm in West-Papua, war sie einst glücklich, hat gefühlt und gehandelt wie eine Eingeborene. Mit vielen der Freunde von einst feiert sie nun ein ergreifendes Wiedersehen. Doch der magische Ort von damals hat sich verändert. Als erwachsene Frau kann Sabine Kuegler die Augen nicht davor verschließen, was in West-Papua geschieht: Das abgeschiedene Leben der Fayu ist bedroht. Menschen verschwinden, Menschen sterben. Und Sabine Kuegler erkennt: Sie muss das Kind in sich zurücklassen, um das Land und die Menschen zu schützen, die ihr so viel gegeben haben.
Aus Sicherheitsgründen wurden die Namen einiger Personen im Text geändert. Sie sind bei der ersten Erwähnung mit einem Sternchen gekennzeichnet.
eBook-Ausgabe 2012
Knaur eBook
© 2006 Droemer Verlag
Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt
Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic, München (Helmut Henkensiefken)
ISBN 978-3-426-41854-3
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren spannenden Lesestoff aus dem Programm von Knaur eBook und neobooks.
Auf www.knaur-ebook.de finden Sie alle eBooks aus dem Programm der Verlagsgruppe Droemer Knaur.
Mit dem Knaur eBook Newsletter werden Sie regelmäßig über aktuelle Neuerscheinungen informiert.
Auf der Online-Plattform www.neobooks.com publizieren bisher unentdeckte Autoren ihre Werke als eBooks. Als Leser können Sie diese Titel überwiegend kostenlos herunterladen, lesen, rezensieren und zur Bewertung bei Droemer Knaur empfehlen.
Weitere Informationen rund um das Thema eBook erhalten Sie über unsere Facebook- und Twitter-Seiten:
http://www.facebook.com/knaurebook
http://twitter.com/knaurebook
http://www.facebook.com/neobooks
http://twitter.com/neobooks_com
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Namen der besuchten Orte nicht erwähnt und Namen von Menschen geändert, die wir getroffen und die uns geholfen haben.
Der Stamm der Fayu setzt sich aus vier Clans oder Gruppierungen zusammen: den Tigre, den Tearü, den Sefoidi und den Iyarike, mit denen wir lebten.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Namen der besuchten Orte nicht erwähnt und Namen von Menschen geändert, die wir getroffen und die uns geholfen haben.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Namen der besuchten Orte nicht erwähnt und Namen von Menschen geändert, die wir getroffen und die uns geholfen haben.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Namen der besuchten Orte nicht erwähnt und Namen von Menschen geändert, die wir getroffen und die uns geholfen haben.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Namen der besuchten Orte nicht erwähnt und Namen von Menschen geändert, die wir getroffen und die uns geholfen haben.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Namen der besuchten Orte nicht erwähnt und Namen von Menschen geändert, die wir getroffen und die uns geholfen haben.
Aus Sicherheitsgründen habe ich die Namen der besuchten Orte nicht erwähnt und Namen von Menschen geändert, die wir getroffen und die uns geholfen haben.
Gewidmet denen,
die im Kampf um ihre Freiheit
ihr Leben gelassen haben
Ich habe eine Freundin, sie heißt Mari. Sie ist eine Papua.
Wir wohnten damals in der Hauptstadt von West-Papua, Indonesien. Meine Eltern waren mit meiner Schwester Judith, meinem Bruder Christian und mir nach Jayapura gezogen, um dort als Sprachforscher und Missionare zu arbeiten. Wenige Wochen nach unserer Ankunft lernte ich Mari kennen.
Ich weiß nicht mehr genau, wo und wie wir uns zum ersten Mal trafen, eines Tages war sie einfach da. Mari ernannte sich kurzerhand selbst zu meiner Freundin und Beschützerin. Von diesem Tag an verbrachten wir jede freie Minute miteinander und erkundeten eine für mich neue, faszinierende Welt. Eine Welt, die ich vom ersten Moment an liebte, so bunt, so lebendig und so voller Abenteuer war sie.
Wir wohnten in einem einfachen Haus aus Zement, dessen Fenster mit Fliegengittern bespannt waren. In dem kleinen Garten stand eine hochgewachsene Palme, die sich unter dem Gewicht der vielen Kokosnüsse bog. Eine lange, ungepflasterte Zufahrt führte zu unserem Grundstück und trennte uns von unseren Nachbarn, deren Haus direkt an die Hauptstraße grenzte. Meine Eltern hatten dieses Haus ausgesucht, weil es etwas abseits von der Straße, dem Lärm und den Abgasen lag.
Auf der anderen Seite der Hauptstraße stand Maris Haus. Sie wohnte dort mit ihrem Vater, ihrer Schwester und den zwei Brüdern. Ich kann mich nicht an ihre Mutter erinnern, ich glaube, sie lebte nicht mehr. Maris Haus war ebenfalls aus Zement und Holzbrettern errichtet, aber einfacher als unseres. Es gab fast keine Möbel und keinerlei Wandschmuck bis auf ein altes, ausgeblichenes Poster an der Innenseite der Haustür.
Direkt neben Maris Haus war ein kleiner Laden, wo es fast alles zu kaufen gab. Der Besitzer war sehr nett zu uns. Hin und wieder schenkte er uns Süßigkeiten, und dann saßen Mari und ich auf zwei Plastikstühlen in einer Ecke seines Ladens und beobachteten die Leute beim Einkaufen.
Die meiste Zeit aber verbrachten wir draußen und erkundeten die Umgebung um Maris Haus. Wir spielten Verstecken zwischen den Bäumen, zwischen heruntergekommenen Häusern und in schmutzigen Höfen. Heimlich pflückten wir Obst von den Bäumen, bis uns die wütenden Besitzer verjagten und uns mit Prügel drohten oder damit, es unseren Eltern zu erzählen.
Eines Tages, wir hatten uns ziemlich weit von Maris Haus entfernt, hörten wir plötzlich Schreie. Erstaunt sahen wir uns an und rannten, neugierig geworden, in die Richtung, aus der die Schreie kamen. Da so gut wie nie etwas wirklich Aufregendes passierte, wollten wir dieses Ereignis auf keinen Fall verpassen. Rasch erreichten wir einen größeren Gebäudekomplex, und ich spähte um die Ecke, Mari direkt hinter mir. Vor mir sah ich einen grasbewachsenen Hof, umgeben von mehreren einstöckigen Wohnhäusern. Ich weiß noch, wie sauber alles auf mich wirkte, ganz im Gegensatz zu den unordentlichen und überfüllten Höfen, die ich sonst so kannte.
Mehrere Männer in Uniform standen in der Mitte des Hofes. Ich war durchaus an Polizisten und Militär gewöhnt, sie gehörten zum alltäglichen Straßenbild und waren für West-Papua nichts Außerordentliches. Aber etwas an dieser Situation war anders. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen, der Platz wirkte bis auf die Männer wie ausgestorben. Da ertönte erneut ein Schrei, der Schrei einer Frau. Sie klammerte sich an einen Mann, den die Polizisten in die Mitte des Platzes trieben, dorthin, wo schon zwei andere Männer auf der Erde knieten. Ich wusste in diesem Moment, dass hier etwas Schreckliches geschah, etwas, vor dem ich fliehen, die Augen verschließen sollte. Aber ich war wie erstarrt, unfähig, mich zu bewegen, unfähig wegzusehen.
Einer der Uniformierten drehte sich zu der schreienden Frau um und trat mit seinen Stiefeln so lange auf sie ein, bis sie den Mann losließ. Dann zwangen die Polizisten ihn, sich neben den beiden anderen Männern niederzuknien. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, nur seinen schwarzen, krausen Haarschopf. Einer der Polizisten stellte sich hinter die drei Männer und begann mit lauter Stimme zu sprechen. Ich weiß nicht mehr, was er sagte, ich starrte nur wie gebannt auf das Szenario, das sich wenige Meter von mir entfernt abspielte. Plötzlich zog der Polizist eine Pistole, stellte sich hinter den ersten der drei Männer und drückte ab. Ein lauter Knall hallte durch die Luft. Ich zuckte zusammen, mein Herz setzte für einen Moment aus, und ich spürte, wie mir das Blut aus dem Kopf wich. Der Uniformierte wandte sich dem nächsten Mann zu und drückte erneut ab. Ein Knall, und er schritt zum dritten, der nächste Knall, dann Stille. Ich starrte auf die drei leblosen Körper in der Mitte des Platzes und auf das Blut, das stoßweise aus ihren Köpfen quoll.
Die Zeit schien stillzustehen, ich war wie gelähmt. Plötzlich zog Mari mich zurück, ich blickte sie an und sah Entsetzen in ihren Augen. Da ertönten Rufe im Hof, Schritte kamen auf uns zu.
Wir sprangen hoch und rannten los, alles um mich herum verschwamm, ich merkte nur, dass Mari direkt vor mir lief.
Schließlich, ich kann mich nicht erinnern, wie, erreichten wir den kleinen Laden neben Maris Haus. Als hätte der Besitzer uns erwartet, winkte er uns rasch zu sich hinter die Ladentheke. Er schob einen Vorhang beiseite, der ein Regal unter der Theke verbarg, wir krochen hinein, und er zog den Vorhang hinter uns zu. Stille.
Kurz darauf hörten wir Schritte, Männer rannten auf den Laden zu und traten ein. Ich blickte zu Mari und sehe noch heute vor mir, wie sie mich mit ihren großen, dunklen, vor Schreck weit aufgerissenen Augen anstarrte. Vor Angst wie gelähmt, wagten wir nicht zu atmen, zwei kleine, dünne Mädchen, zusammengekauert in ein Holzregal unter der Ladentheke.
Der Wortwechsel über unseren Köpfen drang nur undeutlich zu uns durch. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis der Ladenbesitzer endlich den Vorhang zurückzog und wir herauskrabbeln konnten. Er hob uns hoch, setzte uns auf unsere Plastikstühle und gab jeder von uns eine Hand voll Bonbons. Dann kniete er sich vor mich hin und nahm mein Gesicht in beide Hände. Seine Worte brannten sich in mein Gedächtnis, als er sagte: »Vergiss, was du gerade gesehen hast. Es ist nicht wichtig. Es waren bloß ein paar Trinker. Sie haben den Tod verdient.«
Als ich später nach Hause kam und meine Mutter mich fragte, was ich den Tag über erlebt hatte, sagte ich nur: »Ach, ich hab heute bloß ein paar Trinker gesehen.«
Ich war damals sechs Jahre alt und hatte eine Freundin. Sie hieß Mari.
Inzwischen ist es über drei Jahrzehnte her, dass meine Eltern beschlossen haben, in Indonesien, genauer: im Dschungel von West-Papua, bei einem gerade entdeckten Eingeborenenstamm zu leben. Ich verbrachte meine Kindheit in der Abgeschiedenheit des »Verlorenen Tals«, mitten im Gebiet der Fayu, bevor ich im Alter von siebzehn Jahren in die Schweiz auf ein Internat kam, um meinen Schulabschluss zu machen. Den Schock, den ich damals empfand, als ich die Welt meiner Kindheit verließ und mit einer mir völlig fremden Welt konfrontiert wurde, habe ich bis heute nicht verwunden. All die Jahre, die ich inzwischen in der westlichen Zivilisation lebe, begleitet mich das Heimweh nach West-Papua, treibt mich der Wunsch, endlich nach Hause zurückzukehren. Ich brenne vor Sehnsucht, den Dschungel wiederzusehen, damit die Wärme dieses Landes und der dort lebenden Menschen von neuem in meine Seele dringen und sie erfüllen kann.
Ich möchte Sie mit auf die Reise nehmen, auf eine Reise durch die Zeit, auf eine Reise, die mitten in die Herzen derjenigen führt, deren Schreie ungehört verhallen.
Es war Ende Oktober 2005. Ich saß im Zug. Neben mir auf der Sitzbank standen ein großer Alukoffer und ein gelber Rucksack. Müde starrte ich aus dem Fenster. Es war noch immer dunkel, die aufgehende Sonne ließ sich nicht mal erahnen. Ich war auf dem Weg von München nach Frankfurt, zum Flughafen.
Eigentlich hätte ich vor Freude außer mir sein sollen, aufgeregt und gespannt, doch mein Herz war schwer. Ich spürte, wie eine schleichende Angst von mir Besitz ergriff. Was, wenn ihnen etwas passiert, während ich weg bin? Was, wenn sie mich schrecklich vermissen und die ganze Zeit weinen? Ich schloss die Augen. Vor mir sah ich die Gesichter meiner Kinder, von denen ich mich gerade verabschiedet hatte. Am liebsten wäre ich am nächsten Bahnhof aus dem Zug gesprungen und umgehend zu ihnen zurückgekehrt.
Energisch verbannte ich die besorgten Gedanken aus meinem Kopf. Ich verließ sie ja nicht für immer; in genau einem Monat würde ich meine Kinder wieder in die Arme schließen können. Außerdem waren sie bestens aufgehoben, bei Menschen, die sie liebten. Ich musste mich jetzt auf das konzentrieren, was vor mir lag. Nicht umsonst hatte ich gut fünfzehn Jahre lang gekämpft, um endlich an dem Punkt zu sein, an dem ich heute war.
Um auf andere Gedanken zu kommen, holte ich die Zeitschrift aus dem Rucksack, die ich in München am Bahnhof noch schnell gekauft hatte. Ich begann die glänzenden Seiten durchzublättern – perfekte Models, farbenfrohe Mode, Werbung für die neuesten Cremes, die in vier Wochen deutlich weniger Falten versprachen. Dann blieb mein Blick hängen – an einem Artikel über mein letztes Buch, Dschungelkind. Mein Gesicht sprang mich geradezu vom Buchumschlag an. Ich starrte darauf und fühlte mich mit einem Mal seltsam entfremdet von der jungen Frau auf dem Foto. Mir fiel die Reaktion meiner Mutter ein, als ich ihr am Telefon erzählte, dass mein Buch auf der Bestsellerliste stehe. »Oh wie schön, Sabine«, antwortete sie beiläufig und fuhr dann fort: »Weißt du, was der Arzt heute zu mir gesagt hat?«
Die Erinnerung an diese Situation brachte ein Lächeln auf mein Gesicht. Natürlich wusste ich, dass meine Eltern stolz auf mich waren, doch wie sagte Mama mal so schön? Ihr sei es wichtiger, dass ich privat glücklich bin, das bedeute mehr als beruflicher Erfolg, und sei der noch so groß. Und überhaupt, nach all den Jahren, die sie im Dschungel verbracht hatte – was mochte ihr da schon eine Bestsellerliste sagen?
Meine Gedanken wanderten nach West-Papua zurück, zu meiner Zeit bei den Fayu.
Ich habe meine Kindheit nie als ungewöhnlich empfunden, schließlich kannte ich nichts anderes. Erst die Reaktionen auf mein Buch haben mir gezeigt, wie einzigartig meine Kindheit gewesen sein muss. Immer wieder werde ich gefragt, ob ich es meinen Eltern verüble, dass ich ihretwegen in der Wildnis aufgewachsen bin. Warum aber sollte ich diese aufregende und wunderschöne Phase meines Lebens bedauern? Natürlich war es für mich nicht leicht, mich nach einer Kindheit im Dschungel in der westlichen Welt zurechtzufinden. Es hatte mehr als zehn Jahre gedauert, mich in dieser fremden, sonderbaren Kultur zurechtzufinden – an sie gewöhnt habe ich mich immer noch nicht. Das, was ich in meinem bisherigen Leben tatsächlich bedaure, ist, dass ich nicht zurück nach Hause zu meinem Stamm gegangen bin, als ich mit der Schule fertig war. Wann immer ich dies jedoch meiner Mutter gegenüber erwähne, erinnert sie mich daran, dass man erst am Ende seines Lebens anfangen sollte, dies oder jenes zu bedauern. »Schließlich weißt du nie, was dich alles noch erwartet und welche Aufgaben du noch zu erfüllen hast.«
Als ob ich irgendetwas wahrhaft Bedeutendes tun könnte, dachte ich mir, ich habe ja noch nicht mal mein eigenes Leben im Griff. Das einzig wirklich Gute, was ich bisher zustande gebracht hatte, waren meine Kinder.
Ich beobachtete, wie sich die Sonne allmählich hervorwagte, wie sich die ersten gelben Strahlen ihren Weg durch den dichten Morgennebel bahnten. Ein herrlicher Anblick, aber noch war es ziemlich kalt. Ich schauderte und zog meine Jacke fester um mich. Die Augen fielen mir zu, und der Schlaf ergriff von meinem Körper Besitz.
Wenige Stunden später erreichte ich mein Ziel, den Frankfurter Flughafen. Ich nahm meinen Rucksack, hievte den Koffer vom Sitz neben mir, stieg aus dem Zug und machte mich auf den Weg in die Abflughalle. Da ich sehr früh dran war, waren die Check-in-Schalter für meinen Flug noch nicht geöffnet. Also stand ich herum und wartete. Ich beobachtete die Menschenmassen, die sich an mir vorbeischoben, hektisch, ungeduldig, ständig in Bewegung. Selbst nach all den Jahren, die ich nun schon in Europa lebe, habe ich mich nicht an diese Geschäftigkeit und diese Eile gewöhnen können. Wieder musste ich an meine Mutter denken und fragte mich, wie sie das damals mit uns drei Kindern bewältigt hat. Zuerst von Nepal nach Deutschland, und zwei Jahre später dann nach West-Papua. Immer wenn wir darüber sprechen, betont sie, wie wohlerzogen wir waren – ganz im Gegensatz zu meinen eigenen Kindern. Ich musste lächeln. Ja, meine vier sind in der Tat wild, aber sie sind wunderbare Kinder, die mein Leben mit so viel Freude und Fröhlichkeit füllen.
Ich holte mein Handy hervor und tippte die ersten SMS-Abschiedsgrüße an ein paar Freunde. Endlich wurde mein Flug aufgerufen, und ich reihte mich in die Schlange am Check-in ein.
Nach dem Start lehnte ich mich in meinem Sitz zurück und schloss die Augen. Der Flug würde voraussichtlich elf Stunden dauern.
In Bangkok legten wir einen zweistündigen Zwischenstopp zum Auftanken ein, und die Passagiere verließen die Maschine, um sich die müden Beine zu vertreten. Dabei fiel mir ein junger Chinese auf, der mich schon seit einer Weile beobachtete. Ich fragte mich, wie er wohl aufgewachsen war. Eher traditionsbewusst oder modern?
Andere Menschen und ihre Geschichte haben mich schon immer fasziniert, ein jeder mit seiner individuellen Vergangenheit, Persönlichkeit, Erziehung und Kultur. Ein Buch über meine eigene Kindheit und Jugend zu schreiben war befreiend für mich, weil ich mich dadurch von außen betrachten konnte. Manchmal vor dem Einschlafen denke ich an die vielen Menschen, die mein Buch gelesen haben und nun wissen, wie hart ich darum gekämpft habe, in der mir fremden westlichen Welt Fuß zu fassen. Durch Dschungelkind habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, wie sehr die Fayu mein Denken geprägt haben. Sie haben mich als eine der ihren aufgezogen und mich auf das Leben in der Wildnis vorbereitet, auf das Überleben in einer Welt, in der die Natur die Regeln bestimmt und nicht die moderne Technik. Den Einfluss dieser Erziehung auf mein Leben spüre ich bis heute.
Wieder zurück an Bord, setzten wir unsere lange Reise nach Brunei und anschließend Bali fort, wo ein weiterer Zwischenstopp von mehreren Stunden geplant war. Bei der Landung sah ich aus dem Fenster und betrachtete den kristallblauen Ozean, die endlos langen Strände, wo sich ein Hotel ans nächste reihte. In mir wuchs langsam die Aufregung.
Als ich die Maschine in Bali verließ, umfing mich die heiße Luft wie eine tosende Welle. Wie wunderbar die Hitze sich anfühlte. Tief atmete ich den süßen Duft der Tropen ein. Wie sehr hatte ich genau das vermisst, diese Wärme, diesen herrlichen Geruch.
Im Taxi auf dem Weg zum Hotel betrachtete ich die vorbeiziehende Landschaft und wunderte mich über die leeren Straßen, Restaurants und Geschäfte. Auf Englisch fragte ich den Fahrer, warum die ganze Stadt wie ausgestorben wirkte. Er erklärte mir, dass der Tourismus seit dem Bombenanschlag auf eine Diskothek abrupt nachgelassen hatte. Vor allem die Australier und Japaner mieden das einst so beliebte Urlaubsziel.
Angekommen im Hotel, sprang ich schnell unter die Dusche und versuchte, die wenigen Stunden bis zum Weiterflug zu nutzen, um ein bisschen zu schlafen.
Um ein Uhr nachts stand ich wieder am Flughafen. Ich war müde und schlecht gelaunt. Außerdem hatte ich Durst, und nach einer längeren erfolglosen Suchaktion stellte ich genervt fest, dass sämtliche Läden bereits geschlossen waren. Wieder zurück am Schalter, musterte ich die anderen wartenden Passagiere. Bis auf einen stammten sie alle aus Indonesien oder West-Papua. Die meisten wirkten gelassen, während sie auf einen alten, dröhnenden Fernseher starrten, in dem irgendeine Show lief.
Endlich durften wir an Bord, und ich ließ mich erleichtert auf meinen Platz sinken. Nach wenigen Minuten fiel ich in einen tiefen Schlaf und wachte erst wieder auf, als der Pilot zur Landung ansetzte. Ich blickte aus dem Fenster, in der Hoffnung, etwas wiederzuerkennen, aber ich sah nichts als Wolken vor mir. Mein Herz hörte für einen Moment auf zu schlagen, als die Maschine die Wolkendecke durchbrach. Was ich nun sah, verwirrte mich völlig. Nichts, aber auch gar nichts wirkte vertraut. Das hatte ich nun wahrlich nicht erwartet. Wo zum Teufel war ich hier? Sollten wir nicht in Jayapura landen?
Als die Stewardess an meiner Sitzreihe vorbeiging, erklärte sie mir, dass wir zunächst in Timika landen würden, einer Stadt im Süden von West-Papua, und dass wir in etwa einer Stunde nach Jayapura weiterflögen. Ich nickte nur stumm und schaute erneut aus dem Fenster.
Da blieb mein Blick unvermittelt an etwas hängen. Eigenartig. Was war das unter mir? Es sah aus wie ein riesiger Fluss, ungemein breit, der sich auf seinem Weg aus den Bergen ins Meer durch die Landschaft schlängelte. Doch das da unten konnte beim besten Willen kein Fluss sein. Es hatte die Farbe von hellgrauem, glänzendem Lehm. Das Wasser darüber wirkte glasklar, und was das Absonderlichste überhaupt war: Ich erkannte nicht einen Baum, kein Grün, nicht einmal einen Grasstreifen, der in dieser Zone wuchs. Es sah aus wie Brachland. Ich konnte den Blick während der Landung nicht von diesem seltsamen Phänomen abwenden und fragte mich, was mit diesem Stück Natur nur passiert sein konnte.

Die Inselwelt vor Jayapura
Mit etwa einer Stunde Verspätung ging es zurück an Bord, und der letzte Teil meiner Reise begann. Was erwartete mich wohl in den kommenden Wochen? Würde ich alles wiedererkennen, oder hatte sich die Welt, die mir einmal so vertraut war, im Laufe der Zeit völlig verändert? Und inwieweit hatte ich mich selbst verändert?
Beim Landeanflug auf Jayapura hielt ich den Atem an. Dann sah ich sie, meine geliebten Hügel, deren helle, grasbewachsene Kuppen nun in Sicht kamen, und gleich dahinter das traumhaft schöne dunkelblaue Meer, das sich bis zum Horizont erstreckte. Mein Atem ging schneller, ich vergaß die Welt um mich herum und hörte auch nicht, als über Lautsprecher die bevorstehende Landung angekündigt wurde. Wie lange hatte ich von genau diesem Augenblick geträumt! Wie hart hatte ich dafür gekämpft, jetzt hier zu sitzen, mit Blick auf diese vertraute Landschaft!
Ein Ruck durchfuhr mich, als die Maschine auf der Landebahn aufsetzte, als die Bremsen das Flugzeug zum Stehen brachten. Völlig versunken starrte ich aus dem Fenster. Allmählich erkannte ich die einzelnen Gebäude am Rande der Piste wieder. Ja, es waren ein paar neue dabei. Aber dort drüben, zu meiner Linken, stand noch immer der Hangar, wo ich als Kind so oft gespielt hatte. Dort hatten die kleinen Flugzeuge gestanden, mit denen wir nach Danau Bira geflogen waren, der Dschungelbasis, wo wir anfangs lebten. Und jetzt sah ich eine dieser Propellermaschinen, die, weiß und hellblau, in der Sonne schimmerte. Ich konnte den Blick einfach nicht abwenden, alles war wie damals – angefangen von dem Berg, auf dem man ein Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden hatte, über die Grashügel, die vertrauten Bäume und die Holzhäuser bis hin zu den Menschen! Das Herz schlug mir bis zum Halse, als ich die Papua sah. Wie schön sie waren mit ihrer dunklen, schimmernden Haut, dem schwarzen, lockigen Haar, den großen dunklen Augen und charakteristischen Nasen. Auch wenn ich es gar nicht wollte, ich musste sie einfach anstarren und hätte am liebsten gar nicht mehr aufhören mögen.
Jemand schob mich den Gang zwischen den Sitzreihen entlang, und ich setzte mechanisch einen Fuß vor den anderen, bis ich den Ausgang der Maschine erreicht hatte. Endlich! Mein erster Schritt nach draußen. Ein heißer Windstoß erfasste mich, eine Wolke von Düften, so aufregend, so heimatlich. Langsam ging ich die Gangway hinunter, Stufe für Stufe, und betrat nach mehr als fünfzehn Jahren erstmals wieder vertrauten Boden.
Ich lief los. Und mit jedem Schritt veränderte ich mich. Mit jedem einzelnen Schritt fiel eine Last von mir ab, mit jedem Schritt ließ ich einen anderen Schmerz hinter mir, eine andere Angst. Je näher ich meinem Ziel kam, desto leichter fühlte ich mich. Ich hob den Kopf, straffte den Rücken, und auf einmal spürte ich, wie mein Herz zu fliegen begann. Jede Zelle in meinem Körper erwachte zu neuem Leben, Wärme durchfloss mich, und als ich in den klaren blauen Himmel hinaufsah, hatte ich nur einen Gedanken: Ich bin wieder zu Hause!
Im Hauptgebäude wurde ich sofort von einer aufgeregt umhereilenden Menschenmenge erfasst, ein jeder auf der Suche nach seinem Koffer. Ich ließ mich im Getümmel mittreiben. Wie in Trance beobachtete ich die Einheimischen, ihre farbenfrohen Kleider, die sich deutlich vom Grau und Braun der Wände im Hintergrund abhoben. Ich war völlig entspannt, so ganz ohne Zeitnot und Termindruck, atmete tief ein und saugte alles in mich auf: die tropische Luft, die Gerüche, die Atmosphäre.
Eine vertraute Stimme riss mich aus meiner Versunkenheit. Ich entdeckte Papas hoch aufragende weiße Gestalt, die sich durch die Menschenmenge einen Weg zu mir bahnte. Wie ich mich freute, ihn wiederzusehen! Wir schlossen uns in die Arme, er fühlte sich verschwitzt an, und ich hatte den Eindruck, dass er ein paar Kilo zugelegt hat. Ich konnte nicht aufhören zu lächeln, eine freudige Aufregung hatte von mir Besitz ergriffen.
Nachdem wir uns begrüßt hatten, fragte Papa mich nach meiner Gepäcknummer.
Verwirrt sah ich ihn an, ich konnte mich beim besten Willen nicht erinnern, eine solche Nummer bekommen zu haben.
»Sie müsste auf der Rückseite deines Tickets stehen«, sagte Papa.

Das lange erwartete Wiedersehen mit Papa
Ich kramte in meiner Tasche und holte den Flugschein hervor. Und tatsächlich, auf der Rückseite klebte ein kleiner Zettel mit einer Nummer.
Papa grinste. »Na siehst du. Dies hier ist übrigens der einzige Flughafen, den ich kenne, bei dem man das Gebäude erst verlassen darf, wenn das Gepäck anhand der Nummer kontrolliert wurde.«
»Ist ja strenger als in Deutschland«, murmelte ich nur, da rief er auch schon nach einem Einheimischen, der ein orangefarbenes T-Shirt trug. Papa gab ihm den Zettel, und der junge Mann drängelte sich durch die dichte Menschenmenge bis vor zum Gepäckschalter. Nach einer Weile kam er mit meinem Alukoffer zurück, und wir gingen zum Ausgang, inmitten einer Traube von Menschen, die mit Unmengen an Gepäck in die gleiche Richtung drängte. Neben der Tür stand ein Flughafenangestellter in Uniform und verglich mit größter Sorgfalt jeden Zettel mit der jeweiligen Nummer auf den Gepäckstücken.
Das kann dauern, dachte ich und beobachtete, wie ihm die Menschen ihre Koffer genau vor die Nase stellten. Endlich waren wir dran, mein Ticket wurde kontrolliert, und wir konnten ins Freie treten.
Ein Einheimischer kam uns entgegen, auf dem Gesicht ein breites Lächeln. Er nahm meine Hand und schüttelte sie kräftig. Papa stellte ihn mir vor. Er hieß Jacop und war einer der Fahrer von YPPM (Yayasan Persekutuan Peninjilan Mairey), der Entwicklungshilfe-Organisation, für die meine Eltern arbeiten. Noch immer lächelnd, griff er sich meinen Koffer und ging zum Parkplatz voran. Als ich mich umdrehte, stand ich direkt vor einem Papua mittleren Alters.
»Weißt du, wer das ist – kannst du dich an ihn erinnern?«, fragte Papa.
Ich sah genauer hin, dann schlang ich mit einem lauten Jubelschrei die Arme um Aron[1], den Dani-Jungen, den wir vor Jahren in unsere Familie »adoptiert« hatten. Aron vollführte einen echten Freudentanz mit mir und strahlte dabei übers ganze Gesicht, Tränen der Rührung in den Augen. Ein Gefühl der Liebe durchströmte mich. Wie viele Jahre war es nun schon her? Was war nicht alles passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten! Auf einmal spürte ich es wieder, das Band zwischen uns, das in all den Jahren nicht zerrissen war.
Nachdem sich die erste Wiedersehensfreude gelegt hatte, setzten wir unseren Weg zum Wagen fort. Jacop verstaute mein Gepäck, und Aron und ich quetschten uns zusammen auf die Rückbank. Ich konnte den Blick einfach nicht von ihm abwenden. Wie sehr hatte ich ihn vermisst! Er hatte mich und meine Geschwister immer wie ein großer Bruder beschützt, war mit uns schwimmen gegangen und hatte uns getröstet, wenn wir traurig waren. Wie ich so neben ihm saß, fühlte ich sie wieder, diese Vertrautheit und Geborgenheit meiner Kindertage.
Die Fahrt vom Flughafen nach Waena, wo unser Haus stand – eine kleine Stadt auf halbem Wege nach Jayapura –, dauerte eine knappe halbe Stunde. Als wir die Hauptstraße erreichten, brauste eine schier endlose Kolonne von Pkws, Minivans und Mofas auf beiden Fahrspuren an uns vorbei, die meisten von ihnen mit einer Geschwindigkeit, die man den ebenso rostigen wie betagten Fahrzeugen gar nicht zugetraut hätte.
Wie um Himmels willen sollen wir da jemals einfädeln?, fragte ich mich.
Doch schon trat Jacop das Gaspedal durch, und der Wagen quetschte sich zielsicher zwischen einen herannahenden Minivan und ein Motorrad. Während des ganzen Manövers hörte Aron nicht auf zu lächeln, und auch Papa führte seinen gerade begonnenen Satz zu Ende, als wäre nichts gewesen. Nur ich klammerte mich ängstlich an meinem Sitz fest, denn natürlich hatte keiner von uns Sicherheitsgurte angelegt. Niemand außer mir schien das Hupkonzert, das in unserem Rücken lostönte, zu bemerken.
Na wunderbar!, dachte ich, als wir davonflitzten – und staunte über mich selbst, die ich lange Zeit sogar Angst gehabt hatte, in einer Großstadt wie Hamburg eine gesicherte Ampelkreuzung zu überqueren!
Während der Fahrt nach Waena starrte ich nach draußen, starrte durch die Windschutzscheibe, die Seitenfenster, die Heckscheibe, um ja keine Einzelheit zu verpassen. Als Papa das bemerkte, sagte er: »Keine Sorge, Sabine. Wir haben noch jede Menge Zeit, die schöne Landschaft zu genießen.« Und wie auf Kommando flogen wir alle in die Luft, als wir mitten durch ein riesiges Schlagloch fuhren.
»Na, die Straßenverhältnisse haben sich jedenfalls nicht geändert«, sagte ich amüsiert und drehte mich zu Aron um, der noch immer vor sich hin lächelte. »Aron«, fragte ich ihn in meinem gebrochenen Indonesisch, »wie viele Kinder hast du mittlerweile?«
Voller Stolz erzählte er mir, dass es inzwischen acht waren.
»Wow!«, rief ich aus. »Und ich dachte immer, ich sei kinderreich mit meinen vieren.«
Endlich bogen wir in unsere Straße ein und schnitten dabei mehrere entgegenkommende Fahrzeuge, die uns ein weiteres Mal mit einem Hupkonzert bedachten. Jacop bremste ab, und wir fädelten in eine winzige Gasse ein, gerade mal so breit wie der Wagen.
Ich musste lächeln, als ich die Gruppe von Einheimischen entdeckte, die uns erwarteten, in traditionelle Gewänder gehüllt. Ja, ich wusste genau, was nun passieren würde: Das war das Begrüßungskomitee vom YPPM. Noch bevor ich einen Fuß auf den Boden gesetzt hatte, setzten die Trommeln ein, und die Männer und Frauen fingen an zu singen. Ich sah Pfeil und Bogen, phantasievoll verzierte Federn, bemalte Gesichter – und mit einer temperamentvollen papuanischen Tanzeinlage begleitete man mich die Einfahrt hinauf.
Da entdeckte ich eine Gruppe Kinder, die Willkommensbänder in die Luft hielten. Was für ein rührender Anblick – ich musste sofort an meine Kinder denken, die viele tausend Kilometer von mir entfernt waren.
Nach mehreren Begrüßungsreden und einigen weiteren Liedern lernte ich endlich die Familie von Aron kennen. So viele Kinder! Und alle so unglaublich schön! Mit strahlendem Lächeln umarmten sie mich aufs Herzlichste, als wäre ich von jeher Teil ihrer Familie gewesen, als wäre ich niemals weggegangen.
Ich fühlte mich total entspannt, überglücklich und zufrieden.
Schließlich ebbte der Rummel ab, und alle gingen wieder ihren alltäglichen Arbeiten nach. Es war inzwischen Mittag, die Sonne brannte auf uns herab, es wurde Zeit für eine Siesta. Doch an Schlaf war nicht zu denken, dafür war ich noch immer viel zu aufgeregt. Während Jacop mein Gepäck hineinbrachte, wollte Papa mir das kleine aus Beton gebaute Haus zeigen.
Meine Eltern sind umgezogen, nachdem ich damals mit siebzehn in die Schweiz ins Internat gegangen bin. Daher betrat ich nun zum ersten Mal unser neues Zuhause in Waena. Ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen, als Papa mich mit stolzgeschwellter Brust herumführte.
»Was gibt’s denn da zu grinsen, Sabine?«, fragte er schließlich leicht irritiert.
»Papa«, antwortete ich amüsiert, »es ist so offensichtlich, dass Mama nicht da ist.«
Mama war in Deutschland bei meiner Großmutter geblieben, der es gesundheitlich nicht gut ging.
»Was soll das denn heißen?«, rief er.
»Nichts«, antwortete ich und musste nun endgültig losprusten.
»Jetzt sag schon«, beharrte er.
»Na ja«, begann ich vorsichtig, auf der Suche nach den richtigen Worten. »Bitte nimm das jetzt nicht persönlich, aber dein Hang zu modernen Haushaltsgeräten ist nicht gerade sonderlich stark ausgeprägt. Sieh dir doch nur mal diesen Wasserfilter an, der ist ja mindestens sechsundzwanzig Jahre alt. Den hatten wir doch schon damals in Danau Bira, soweit ich mich erinnern kann.«
»Ja, ich weiß, und immer wenn deine Mutter hier ist, wirft sie ihn weg. Doch ich hole ihn jedes Mal wieder zurück. Also wirklich, wieso soll ich etwas austauschen, was noch tadellos funktioniert?«, verteidigte er sich.
»Papa, du glaubst nur, dass die Dinge noch heil sind, weil du sie jedes Mal mit Klebeband zusammenflickst, genau wie diesen Wasserfilter hier«, erklärte ich ihm.
Wir fingen beide an zu lachen; es war wunderbar, wieder bei Papa zu sein. Ich bin selten jemandem begegnet, der so wenig Wert auf Besitz legt wie er. Ich weiß noch, wie Mama einmal furchtbar wütend ins Haus kam, als die beiden in Deutschland zu Besuch waren. Ich fragte sie, welche Laus ihr über die Leber gelaufen sei.
»Ach, dein Vater! Das ist mal wieder so typisch für ihn!«, wetterte sie los. »Da kaufe ich ihm einen neuen Pulli, den einzigen schönen, den er je in seinem Leben besessen hat. Und was macht er? Zieht das gute Stück doch gleich zur Gartenarbeit an!«
Das sind meine Eltern, wie ich sie kenne und liebe.
Beim Anblick all der vertrauten Gegenstände, die ich bei unserem Rundgang durchs Haus wieder entdeckte, lief mir ein wohliger Schauer über den Rücken. Sogar meinen alten Schreibtisch, an dem ich als Teenager stundenlang über den Hausaufgaben gebrütet hatte, gab es noch. Jeder einzelne Gegenstand löste eine ganze Welle von Erinnerungen aus. So schwelgte ich für den Rest des Tages in meiner Kindheit, bis mich die Müdigkeit übermannte. Es war eine lange, anstrengende Reise gewesen. Als ich völlig erschöpft ins Bett fiel, war mein Körper erfüllt von Wärme und mein Geist von glücklichen Gedanken. So zufrieden hatte ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt, und ich sank in einen tiefen, traumlosen Schlaf, kaum dass mein Kopf das Kissen berührte.
In der zweiten Nacht nach meiner Ankunft passierte es dann. Am Abend hatte ich mir in einem indonesischen Restaurant ganz in der Nähe ein Reisgericht geholt. Ich liebe das indonesische Essen und hatte die Warnungen in den Wind geschlagen, dass sich mein Körper noch nicht ausreichend an die hiesige Bakterienflora gewöhnt haben könnte.
Mitten in der Nacht erwachte ich mit schrecklicher Übelkeit. Die nächsten Stunden verbrachte ich im Badezimmer, mein Magen revoltierte. Eine Lebensmittelvergiftung, dachte ich entsetzt. Nun plagte mich also nicht nur der Schlafentzug wegen meines andauernden Jetlags, sondern ich war auch noch ernsthaft krank.
Als Papa mich am nächsten Morgen wecken wollte, traf er mich jammernd im Bett an. Natürlich konnte er es sich nicht verkneifen, mich daran zu erinnern, dass man mich gewarnt hatte, bevor er mir ein Glas Wasser holte. Ich sah aus dem Fenster, die Sonne war schon aufgegangen, die Vögel zwitscherten, und das Geschrei von Arons Kindern, die draußen spielten, drang durch die Jalousien zu mir herein.
Dass ich nun dank meiner Magenverstimmung das Bett hüten musste, machte alle meine Pläne zunichte, und ich war schwer enttäuscht. Schließlich hatte ich heute mit Jacop und seiner Familie an den Strand gehen wollen und würde nun einen wunderbaren Tag verpassen. Doch es half nichts: Mein Kopf schmerzte, mein Körper war geschwächt, und ich fühlte mich elend. Erschöpft schloss ich die Augen und ließ meine Gedanken wandern.
Heute sollten meine Papiere zur Polizeistation gebracht werden, damit ich ein surat jalan bekam, ein Visum, das mir Zutritt zum Gebiet der Fayu verschaffte. In West-Papua ist Fremden der Zutritt zu bestimmten Regionen, darunter auch das Tal, in dem die Fayu leben, ohne die entsprechende polizeiliche Genehmigung nicht erlaubt. Papa meinte, es könne durchaus ein paar Tage dauern, bis meine Einreise bewilligt wäre und wir ein Flugzeug mieten könnten, um nach Quisa zu gelangen. Quisa, das im Gebiet des Fayu-Stammes der Tigre[2] liegt, hatte seit einiger Zeit eine neue Landebahn. Früher gab es einmal eine Landebahn in der Nähe von Foida, dem Ort, an dem meine Geschwister und ich aufgewachsen sind. Doch weil es immer wieder zu Überflutungen und Erdbeben gekommen war, war dieser Landeplatz inzwischen nicht mehr in Betrieb.
»Und wann werden wir deiner Meinung nach endlich im Dschungel sein?«, fragte ich Papa frustriert. Ich konnte schließlich nicht ewig hier in West-Papua bleiben und wollte so viel Zeit wie nur möglich mit den Fayu verbringen.
»Das kann noch eine Woche dauern.«
Papas Gelassenheit brachte mich in Rage, doch als er meine wütende Miene bemerkte, sagte er nur: »Sabine, wir sind hier in Papua und nicht in Deutschland.«
Er hat ja Recht, gestand ich mir mit einem leisen Seufzen ein. Offenbar hatte ich schon zu lange im Westen gelebt, und der schnelle Lebensrhythmus dort hatte mein Denken mehr beeinflusst, als mir bewusst war. Ich war noch voll und ganz auf Eile programmiert und hatte völlig vergessen, was es heißt, geduldig zu sein. Ich musste also schnell einen Weg finden, mein Denken und Handeln zu verlangsamen.
Wie ungewohnt es war, hier im Bett zu liegen und einfach gar nichts zu tun – keine Verabredungen, keine Termine, kein enger Zeitplan. Eigentlich fühlte es sich wunderbar an, so völlig ohne jeden Druck, doch mein Körper und Geist hatten sich noch nicht daran gewöhnt und lehnten sich gegen die Ruhe auf. Immer wieder wälzte ich mich von einer Seite auf die andere, ohne eine bequeme Position zu finden. Am Nachmittag schlief ich endlich ein, während eine laue Brise durchs offene Fenster hereinwehte.
Zwei Tage später war ich wieder auf den Beinen. Wir wollten heute nach Jayapura fahren, um unsere Reise zu den Fayu vorzubereiten. In den frühen Morgenstunden machten wir uns auf den Weg, um die Mittagshitze zu meiden, und stürzten uns einmal mehr in den chaotischen Verkehr. Geschmeidig reihte sich unser Van ein in die Schlange aus rostigen Lastwagen, vorbeiflitzenden Motorrädern und alten Autos, die mit ihren Abgasen die Luft verpesteten. Ich saß mit Aron auf der Rückbank, während Papa vorne auf dem Beifahrersitz neben Jacop Platz genommen hatte.
Vor Schreck hielt ich die Luft an, als Jacop einen dahinkriechenden Lastwagen überholen wollte, der mit riesigen Metallkisten beladen war und an dessen Seiten sich mehrere junge Männer festhielten. Der entgegenkommende Verkehr hatte uns fast erreicht, und mein einziger Gedanke war: Das war’s! Jacop wird niemals rechtzeitig an dem Truck vorbeikommen. Doch meine Befürchtungen waren unbegründet, wir erreichten unsere Fahrbahnhälfte unversehrt. Um mich abzulenken, beschloss ich, die vorbeiziehende Landschaft zu genießen.
Als wir Abepura, einen Ort zwischen Waena und Jayapura, erreichten und ich das eine oder andere wiedererkannte, begann mein Herz schneller zu schlagen. Hier hatten wir gewohnt, als wir 1978 zum ersten Mal nach Indonesien kamen.
»Sieh nur, Papa«, rief ich aufgeregt. »Dort ist mein Kindergarten.« Neugierig musterte ich die Mauern der katholischen Kindertagesstätte, in der ich damals im Alter von fünf Jahren ein paar Monate verbracht hatte, bevor wir in den Dschungel zogen. Kurz danach bogen wir links ab, in eine kleine, schmale Straße.
»Weißt du, wo wir hier sind?«, fragte Papa.
Ich sah genauer hin, kniff die Augen gegen die blendende Sonne zusammen und betrachtete die Gegend eingehend. Ja, nun konnte ich mich erinnern: Wir hatten damals hier gelebt. Hier, genau, der Zementbau, die einfachen Häuser, die verwahrlosten Gärten – in diesem Haus hatten wir gewohnt, als ich Mari kennen lernte.
»Papa, können wir bitte kurz anhalten und aussteigen?«, fragte ich.
»Das geht jetzt leider nicht«, antwortete er. »Du musst mit Jacop ein andermal herkommen. Wir haben noch viel in der Stadt zu erledigen heute.«
Mit einem enttäuschten Seufzen lehnte ich mich gegen die Rückbank, sagte jedoch nichts.
Eine halbe Stunde später erreichten wir endlich Jayapura. Es überraschte mich, wie wenig sich das Stadtbild verändert hatte. Die Geschäfte waren vielleicht etwas größer geworden, und auch das Warenangebot hatte sich erweitert. Aber nach wie vor gab es die kleinen Bretterbuden am Straßenrand, die alles Mögliche verkauften, von Plastikeimern bis hin zu von Hand zubereiteten Snacks, die in Folie eingewickelt waren. Eines war dagegen deutlich anders als damals, und das war die enorme Auswahl an westlichen Produkten. Sogar eine Filiale von Kentucky Fried Chicken hatte irgendwie ihren Weg zu diesem Fleckchen Erde am anderen Ende der Welt gefunden. Läden mit westlicher Musik und Computershops beherrschten inzwischen die einst so ursprünglichen Straßen.
Als ich kurz darauf im Supermarkt stand, wollte ich meinen Augen kaum trauen. Dort gab es jetzt Milch, Butter und Obstsorten, von denen ich als Kind nur hatte träumen können. Äpfel, Orangen und sogar Trauben waren in großen Kühlboxen gestapelt. Doch zu meiner Freude entdeckte ich auch all die Dosengerichte und Kekse wieder, die mir in meiner Kindheit so vertraut gewesen waren. Ich packte meinen Einkaufswagen voll mit den geliebten Sachen von damals: Kekse mit künstlichem Vanillegeschmack, Gemüse in Dosen, das mehr nach Metall als nach Gemüse schmeckte, tropische Früchte und löslicher Kaffee. Wir zahlten und traten aus der klimatisierten Luft hinaus in die Mittagshitze, die über den staubigen Straßen lag. Ich spürte, wie mir der Schweiß über den Nacken rann.
Wir beschlossen, eine Kleinigkeit essen zu gehen, und ich beharrte so lange auf einem indonesischen Lokal, bis die anderen nachgaben. Zufrieden folgte ich ihnen auf dem holprigen Gehweg und betrachtete meine Umgebung. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass erstaunlich wenige Einheimische zu sehen waren. Stattdessen waren hauptsächlich Leute aus Java unterwegs, leicht zu erkennen an der helleren Haut und den glatten Haaren. Ich fragte mich, warum. Als ich klein war, waren deutlich mehr einheimische Papua auf den Straßen gewesen. Irgendetwas hatte sich verändert auf dieser Insel.
Als wir das Restaurant erreichten, brachte mich der köstliche Duft nach Reis und gebackenen Bananen, der aus der Küche drang, schnell auf andere Gedanken. Ich genoss das Essen in vollen Zügen und war begeistert, dass mein Lieblingsgetränk es jeruk – frisch gepresste Mandarinen mit Wasser und gestoßenem Eis – noch immer so lecker schmeckte, wie ich es in Erinnerung hatte.
Satt und zufrieden trat ich durch die Glastür des Restaurants ins Freie und blinzelte. Eine Gruppe Papua stand wenige Meter entfernt an einer Straßenecke und beobachtete uns. Ihre Augen waren dunkel, düster, und ein bitterer Zug beherrschte ihre Mienen. Schnell wandte ich den Blick ab und fühlte mich dabei irgendwie schuldig. Wir sehen es nicht, wir hören es nicht, wir reden nicht darüber. Ein ungeschriebenes Gesetz, das sich uns bereits in der Kindheit ins Gehirn gebrannt hat. Ich musste an die Unterlagen denken, die ich ins Land geschmuggelt hatte, versteckt zwischen den Plastiklaschen in meinem Rucksack. Informationen über das Unausgesprochene, das Verbotene. Ich wandte mich ab und versuchte, all dies aus meinem Kopf zu verbannen. Das hier ist nicht mein Krieg, sagte ich mir wieder und wieder auf dem Weg zum Wagen. Die Sonne strahlte auf mich herab, die Luft war erfüllt von vertrauten Gerüchen.
Auf dem Rückweg nach Waena hatte ich keinen Blick mehr für die Schönheit der vorbeiziehenden Landschaft, so sehr beschäftigten mich meine Gedanken. Die Sätze, die ich vor wenigen Monaten gelesen hatte, wirbelten schrill durch mein Hirn – Warnungen, Hilfeschreie: »Gib uns eine Stimme. Lass die Welt wissen, was du gehört hast, was du gesehen hast, was du weißt.«
Ich schüttelte den Kopf, wollte die Stimmen abschütteln. Das ist doch verrückt, dachte ich. Wer bin ich denn? Wieso sollte ausgerechnet ich etwas verändern können? Ich bin niemand Besonderes, nichts als ein kleiner Funken, der für eine Sekunde aufleuchtet, um anschließend in der Endlosigkeit des Universums zu erlöschen. Was sollte ich schon groß bewirken?
Zurück in Waena, fühlte ich mich wie erschlagen, als hätte die feuchte Luft jede Energie aus meinem Körper gesogen. Ich legte mich aufs Bett, zog mir ein Kissen heran und ließ mich von einem Buch in die Welt der Phantasie entführen.
Am Abend berichtete Papa mir erfreut, dass meine Papiere bereits eingetroffen seien und wir die Maschine nach Quisa buchen könnten. Bald würde es also so weit sein, und ich würde wieder in ein Leben eintauchen, von dem ich seit Jahren träumte, zurück zu den Menschen, mit denen ich meine Kindheit verbracht hatte. Wie würden sie wohl reagieren, wenn sie mich wiedersahen? Würden sie sich genauso freuen wie ich? Erfüllt von diesen Fragen fiel ich in einen tiefen Schlaf.
Ich hatte einen Traum in dieser Nacht. Ich stand auf einem Hügel in Foida. Die Sonne schien, am strahlend blauen Himmel tummelten sich ein paar vereinzelte weiße Quellwolken. Eine angenehm kühle Brise wehte über mich hinweg, ich atmete die Süße des Dschungels tief ein. Mein Blick schweifte über den Horizont, als mich plötzlich ein heftiger Schreck durchzuckte. In der Ferne hatte sich ein schwarzes Wolkenband gebildet, das rasch größer wurde und bedrohlich auf mich zukam. Meine Unbeschwertheit begann zu schwinden, und eine diffuse Angst kroch in mir hoch. Gebannt beobachtete ich, wie dunkle Gewitterwolken über die mächtigen Bäume hinwegzogen; immer näher und näher kamen sie auf mich zu.
Schweißgebadet schreckte ich aus dem Schlaf hoch. Ich zog die dünne Decke von meinem feuchten Körper und starrte in die Dunkelheit. Mein Kopf war völlig leer, die Gedanken wie ausradiert. Plötzlich hörte ich ein Geräusch von draußen, und ich erstarrte.
Mein Zimmer lag auf der Rückseite des Gebäudes, von wo aus eine Tür in den Garten führte. Wer um Himmels willen geisterte mitten in der Nacht da draußen herum? Ich hatte doch das Tor abgeschlossen, bevor es dunkel wurde? Wie war es möglich, dass jemand in den Garten hineingekommen war? Ich verfluchte mich selbst dafür, dass ich so fahrlässig gewesen war und die geschmuggelten Dokumente nicht vernichtet hatte, und so beschloss ich, sie morgen in aller Frühe zu verbrennen. Nach einer halben Ewigkeit war es draußen endlich ruhig, und ich schlief wieder ein.
Am nächsten Morgen wachte ich auf, als jemand an meine Tür klopfte. Es war Papa, der mir eine Tasse Kaffee ans Bett brachte. Wie herrlich das duftete! Er setzte sich auf die Bettkante, und während ich an dem heißen Kaffee nippte, besprachen wir, was heute alles zu tun war. Es gab ja noch so viel zu erledigen vor unserer Abreise. Sobald Papa mein Zimmer wieder verlassen hatte, sprang ich aus dem Bett, zog mir rasch etwas über und griff nach meinem Rucksack. Ich holte die heiklen Unterlagen heraus, nahm eine Schachtel Streichhölzer und verließ das Haus durch die Hintertür.