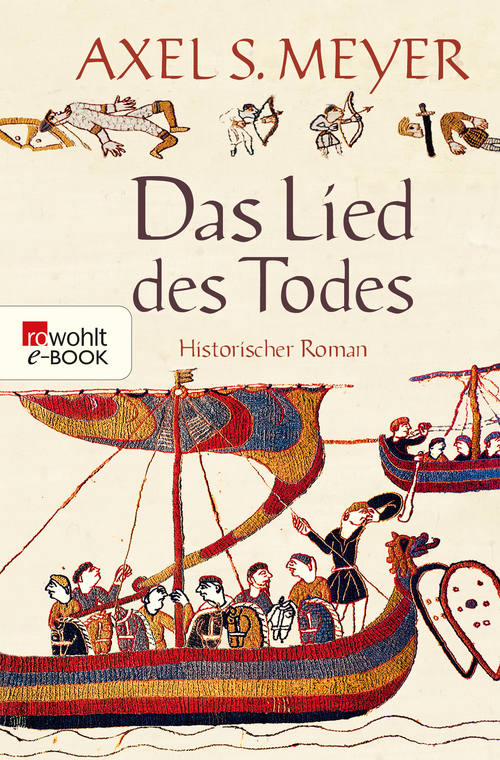
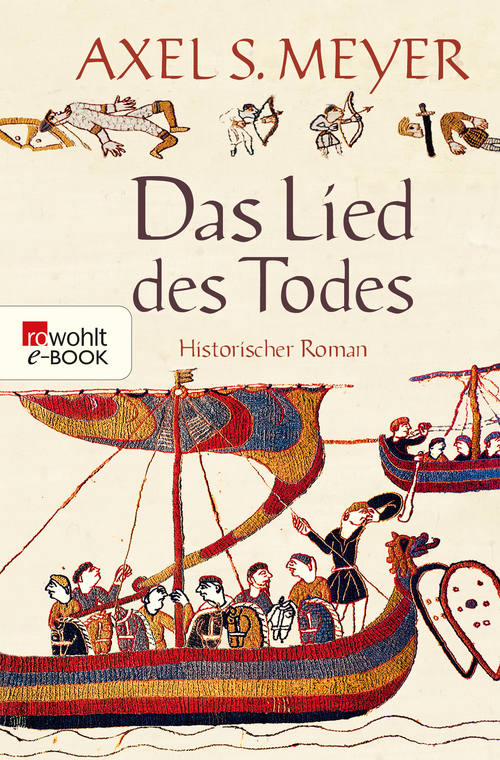
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Redaktion Katharina Geppert
Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther
Umschlagabbildung akg-images/Erich Lessing)
Karten Peter Palm, Berlin
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
ISBN 978-3-644-47331-7
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-644-47331-7
Für Luisa und Svenja
Denn hier drohte knirschend
das wilde Volk der Dänen,
mächtig zu Wasser und zu Lande,
dort die hundertfach geteilte Wut
der barbarischen Slawen,
und nicht zuletzt verwüsteten
die grausamen Ungarn nicht wenige Provinzen
seines Reiches mit Feuer und Schwert.
Der Tag würde nicht ausreichen,
all dies Elend zu erzählen.
Aus Ruotgers VITA BRUNONIS,
der Lebensbeschreibung des heiligen Erzbischofs von Colonia
10. August 955
Am Tag des heiligen Laurentius stand die Schlacht, die über das Schicksal der Welt entscheiden sollte, unmittelbar bevor.
Thankmar ritt in der Legion des Königs, der Legio Regia, einen Hügel hinauf. Von der Kuppe schaute er über die weite Ebene, durch die sich der Lech schlängelte, und sah den Feind – Tausende Magyaren, Ungarn, die sich in den Niederungen sammelten.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. In der Nacht hatte es geregnet, aber jetzt, in der Mittagszeit, drückte sengende Hitze auf das Land und auf die Soldaten des Königs. Unter den Stiefeln der mit Rüstungen und Waffen beladenen Männer dampfte die Feuchtigkeit aus den Wiesen wie der Atem eines wilden Tieres.
Aber nicht die Hitze oder der zahlenmäßig überlegene Feind unten am Fluss trieb Thankmar den Schweiß aus den Poren. Es war die Angst, sein Plan könnte scheitern.
Er richtete sich in den Steigbügeln auf und sah König Otto inmitten der verbündeten Heerführer stehen. Die Lanze mit der goldenen Spitze und dem Banner des heiligen Michael in der rechten Hand, stand Otto wie versteinert da. Den Blick hatte er fest auf die Magyaren gerichtet, die ihre Heimat verlassen hatten, um das Königreich zu vernichten.
Auf den Hügeln wuchs das königliche Heer. Immer mehr Soldaten drängten von hinten nach, die Hänge hinauf. Bayern, Franken, Sachsen, Schwaben und Böhmen bezogen Stellung an den Flanken der Legio Regia, die Otto unterstellt war und aus dreitausend sächsischen und fränkischen Panzerreitern bestand. Insgesamt waren es an die zehntausend Männer, die dem Ruf des Königs gefolgt waren, um das Reich gegen die Ungarn zu verteidigen. Doch deren Krieger waren in der Überzahl. Sie hatten die Steppen im Osten verlassen und in den vergangenen Monaten die Länder im Westen überschwemmt wie eine alles verschlingende Welle.
Nach einer Weile hatte Thankmar genug gesehen. Er saß ab und führte sein Pferd durch die Reihen der berittenen Soldaten. In der Nähe des Königs blieb er stehen und lauschte den Worten der Heerführer. Er hörte, wie sie sich gegenseitig Mut zusprachen, die Stärke ihrer Heere beschworen und die der gepanzerten Reiter. Wie sie Treue gegenüber dem König gelobten – und gegenüber Gott, dem Allmächtigen.
«Mit Gottes Hilfe werden wir die Ungarn schlagen», rief Otto.
Er reckte die Lanze, und das Sonnenlicht ließ die goldene Spitze erstrahlen.
Jubel erhob sich. Priester und Bischöfe eilten herbei, warfen sich auf den von Pferdehufen gefurchten Boden und beteten. Für Gott und für den König!
Für den König!
Plötzlich lösten sich einige Hundert Ungarn aus der Frontlinie und jagten auf die Hügel zu, um das königliche Heer zu einem Gegenangriff zu provozieren. Sie waren geschickte Reiter und Bogenschützen. Im vollen Galopp schossen die Jobbágy, wie man die Reiterkrieger nannte, ihre Pfeile ab. Sie waren in ihren leichten Mänteln und mit den spitzen Filzkappen schneller und wendiger als die Panzerreiter, die unter dem Gewicht ihrer Helme, Brustpanzer und Kettenhemden schwitzten.
Beim ersten Angriff waren die Jobbágy noch zu weit entfernt. Ihre Pfeile erreichten nicht einmal die Hügel. Die Ungarn stellten fest, dass Otto sich von dem Angriff nicht beeindrucken ließ. Sie hielten ihre Pferde an und verlegten sich für einen Moment wieder darauf, aus sicherer Entfernung das Heer auf den Hügeln zu beobachten.
Ottos geistliche Eiferer hatten inzwischen ihre Gebete beendet. Da hörte Thankmar, wie der König die anderen Heerführer nach Konrad fragte. Konrad der Franke war ein enger Vertrauter des Königs. Ohne ihn wollte Otto nicht in die Schlacht ziehen.
Hin und wieder preschten Jobbágy vor und schossen Pfeile ab. Immer näher wagten sie sich heran, und als ein sächsischer Soldat getroffen von seinem Pferd fiel, breitete sich Unruhe im königlichen Heer aus.
Otto wartete noch immer.
Endlich drang die Nachricht durch, dass Konrad eingetroffen sei. Kurz darauf stieß der Franke zu den anderen Heerführern. Er war völlig außer Atem, und sein Gesicht war dunkelrot vor Anstrengung. Keuchend erstattete er dem König Bericht.
Thankmar konnte hören, dass Konrad gute Nachrichten überbrachte. Je länger Otto ihm zuhörte, desto mehr entspannten sich seine Gesichtszüge. Als das königliche Heer am Morgen von der Augusburg zu den Hügeln gezogen war, so erzählte Konrad, hätten Ungarn die Nachhut angegriffen, den Tross geplündert und Dutzende getötet. Aber dann war es Konrads Männern gelungen, die Feinde zurückzudrängen und zu vertreiben. Somit hatten die verbündeten Franken dem König eine große Sorge genommen: dass die Magyaren sein Heer in die Zange nehmen könnten.
Für diese Tat versprach der König Konrad eine angemessene Belohnung. Der winkte jedoch ab. Fürs Erste würde er sich mit einem Schluck Wasser begnügen. Von allen Seiten reichte man ihm Trinkschläuche. Konrad nahm den Helm ab, setzte einen Schlauch an die Lippen und trank gierig.
Da griff erneut ein Trupp an. An die hundert Jobbágy kamen dieses Mal bis dicht vor den Hügel, auf dem das Banner des heiligen Michael wehte.
Schnell hoben Thankmar, der König und alle anderen Männer ihre Schilde. Unter seinem Schild konnte Thankmar sehen, wie sich die Pfeile der Ungarn in die Luft erhoben, wie sie stiegen und stiegen. Wie sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Flugbahn wieder senkten – um dann wie giftige Stacheln riesiger Insekten auf das königliche Heer niederzuprasseln.
Als die Feinde wieder abdrehten, hörte Thankmar einen gellenden Schrei. Er drehte den Kopf und sah den König zu Boden starren. Vor ihm wälzte sich ein Mann vor Schmerzen im Dreck. Es war Konrad. Ein Pfeil hatte sich durch den Trinkschlauch in den Hals des Franken gebohrt. Priester und heilkundige Mönche eilten herbei, doch Konrad starb unter ihren Händen.
Die Heerführer beknieten Otto, endlich mit einem Gegenangriff zu antworten. Man könne nicht warten, bis einer nach dem anderen von einem Pfeil getroffen würde. Die Furcht unter den Männern wuchs mit jedem Augenblick.
Doch Otto unternahm nichts. Seine Miene war wie aus Stein gemeißelt, als er sich von Konrads Leiche abwandte und den Blick wieder auf die Ebene richtete. Tatsächlich bereiteten dort die Ungarn ihre nächste Attacke vor. Weitere Jobbágy schlossen sich den Männern an, die die ersten Angriffe unternommen hatten, und nun näherten sich an die tausend Reiterkrieger der Frontlinie des königlichen Heeres.
Hinter den Reihen liefen Priester schreiend hin und her. Lamentierend baten sie um göttlichen Beistand und beteten um Wunder, die den König und die Seinen vor den wilden Horden beschützen mochten.
Otto zögerte noch immer.
Da brauste eine Böe über die Ebene und die Hügel hinauf. Die Banner knatterten im Wind. Vom Lech her verdunkelte sich der Himmel. Wie gewaltige Fäuste ballten sich graue Wolken. Pferde wieherten; sie spürten das nahende Gewitter.
Als triebe der aufkommende Sturm sie an, ritten die Ungarn immer schneller. In wenigen Augenblicken würden sie bis auf Schussweite herangekommen sein – und dieses Mal würde nicht nur ein Mann sterben.
Thankmar spürte einen feinen Regentropfen auf der Nase. Dann sah er die Regenwand, die die Ebene wie einen Schleier verhüllte, und das Gewitter brach los. Erbsengroße Tropfen prasselten auf die Rüstungen der Soldaten. Ungeduldig warteten sie auf die Befehle ihres Königs, und der hatte endlich ein Einsehen.
Es war so weit.
Otto ließ sich sein Pferd bringen, saß auf und trieb es vor die Linie seiner Soldaten. Der König brüllte gegen Wind und Regen an.
«Die Feinde mögen uns an Menge übertreffen, aber nicht an Tapferkeit und Rüstung! Und sie können nicht auf den Schutz unseres Gottes vertrauen. Hört mich an! Sachsen, Bayern, Franken, Schwaben und Böhmen! Was auch immer nun geschehen wird: Lieber wollen wir im Kampf ruhmvoll sterben, wenn unser Ende bevorsteht! Wir werden uns nicht der Knechtschaft der Ungarn unterwerfen!»
Eine Welle des Jubels rollte über die Menge und breitete sich bis in die entferntesten Reihen aus. Zehntausend Männer reckten die Waffen.
Unterdessen sausten Pfeile auf das Heer herab.
«Jetzt lasst uns mit Schwertern statt mit Worten die Verhandlungen beginnen!», rief Otto.
In dem Moment, als er die Lanze zum Himmel stieß, bohrte sich ein Sonnenstrahl wie ein glühendes Schwert durch einen Riss in der dunklen Wolkendecke und ließ die goldene Spitze aufleuchten.
«Otto! Pater patriae! Vater des Vaterlands!», erklang es aus Tausenden Kehlen.
Dann schlug das Heer des Königs mit der Wucht einer göttlichen Faust zurück. Große Teile des Heeres fluteten von den Hügeln hinunter in die Ebene, den Feinden entgegen.
Thankmar blieb zurück, wie es sein Plan vorsah. Er beobachtete, wie Otto vom Pferd absaß. Die Zügel gab er einem Mann seiner Leibgarde und ging dann zu einem Zelt, das man auf dem höchsten Punkt des Hügels errichtet hatte. Als Soldaten und Priester ihn begleiten wollten, schickte er sie zurück. Offenbar wollte der König einen Augenblick allein sein, bevor er sich mit der zweiten Angriffswelle selbst in den Kampf begeben würde.
Nachdem die Gegner in der Ebene aufeinandergeprallt waren, tobte eine erbitterte Schlacht, und die Welt begann, den Geruch des Todes zu atmen. Anfänglich zeigte sich die Überlegenheit der schnellen und wendigen Jobbágy, die dem königlichen Heer empfindliche Verluste zufügten. Doch die gepanzerten Reiter drängten die Jobbágy immer weiter zum Fluss zurück.
Otto hatte inzwischen das Zelt erreicht und war dahinter verschwunden. Thankmar setzte sich in Bewegung. Im Gehen griff er nach dem Messer unter seinem Mantel. Er hatte es am Vortag einem Ungarn abgenommen, den er beim Kampf an der Augusburg getötet hatte. Es war ein gutes Messer mit einer scharfen Klinge. Einer sehr scharfen Klinge.
Aus den Augenwinkeln beobachtete er die Soldaten der Leibgarde. Sie blickten aufs Schlachtfeld.
Thankmar ging weiter. Kam zum Zelt. Drehte sich ein letztes Mal um. Niemand beachtete ihn.
Otto kniete hinter dem Zelt auf dem Boden und kehrte Thankmar den Rücken zu. Die goldene Lanze lehnte an der Zeltwand.
Thankmar berührte mit der linken Hand seinen Talisman, einen etwa fingerlangen, spitz zulaufenden Holzspan, den er an einem Lederband um den Hals trug. Während er sich an den König heranschlich, hörte er ihn murmeln. Otto hatte die Hände vor der Brust gefaltet und sprach ein Gebet.
«O Herr!», sagte er. «Du lässt deine Feinde zurückweichen, und sie kommen um vor deinem Angesicht. Denn du sitzt auf dem Thron als gerechter Richter …»
Thankmar schnellte vor, das Messer in der rechten Hand. Da sah er zwei Jobbágy aus den Wäldern jenseits der Hügel in vollem Galopp heranstürmen. Es musste ihnen gelungen sein, die Linien des königlichen Heeres zu umgehen, oder sie gehörten zu den Überlebenden des Trupps, der von Konrad aufgerieben worden war.
Auch der König hatte die Angreifer bemerkt und hob den Kopf. Thankmar stand einen Schritt hinter ihm und hatte das Messer ausgestreckt.
Da schoss einer der Ungarn einen Pfeil ab. Er verfehlte den König um Haaresbreite, streifte aber Thankmar und bohrte sich dann in die Zeltwand. Ein brennender Schmerz flammte in Thankmars Schulter auf.
Er machte den letzten Schritt.
Herbst 956
Blutfeuer brannten in brennenden Wunden.
Schwerter tauchten in die Leiber der Leidenden.
Um die Schilde spritzte der Schaum der Wundenmeere,
als die Flut der Pfeile niederging
und im Sturme Odins, in den Schwerterströmen, viele Männer stürzten.
Aus Snorris Königsbuch (Heimskringla)
Der dunkle Krieger fuhr nach Süden.
Seit Tagen blähte ein Herbststurm aus nördlicher Richtung das Segel und trieb das Handelsschiff seinem Ziel entgegen. Wellen klatschten gegen den Rumpf. Tosendes Wasser rüttelte an den Planken und warf an Deck alles hin und her, was nicht fest verschnürt war. Die Reisenden suchten unter Tüchern und zwischen Kisten und Fässern Schutz vor den Naturgewalten.
Nur der Krieger stand ganz vorn im Bug, wie der Wächter eines Totenschiffs. Die linke Hand lag am Vordersteven, die rechte am Griff seines Schwertes, das unter dem dunklen Mantel in einer Lederscheide steckte. Das lange schwarze Haar war von Regen und Gischt durchnässt und klebte ihm in Strähnen auf Stirn und Wangen. Wassertropfen fingen sich in seinem struppigen Bart.
Der geheimnisvolle Eindruck, den der Krieger auf die anderen Reisenden machte, wurde durch einen Raben verstärkt, der ihm nicht von der Seite wich. Auch jetzt, als die Wellen das Schiff schüttelten, saß der Vogel mit vom Wind zerzausten Gefieder auf der Schulter des Mannes. Nur hin und wieder ließ er ein Krächzen hören, das klang, als komme es aus den Tiefen der Unterwelt.
So fuhren der Krieger und der Rabe einem Ziel entgegen, von dem niemand an Bord sagen konnte, wo es lag und was geschehen würde, wenn der Mann dort ankam. Die anderen mieden den unnahbar wirkenden Mann und machten einen weiten Bogen um ihn, so gut dies an Bord eben ging.
Aber von einem waren sie alle überzeugt – dass der Mann mit dem Tod im Bunde stand.
Vor dreizehn Tagen hatte das Handelsschiff, eine bauchige knörr, im Hafen von Hladir im Lande Nordmoer eine Ladung bestehend aus Malz, Weizen und Honig gelöscht. Im Gegenzug hatte man gepökeltes Robbenfleisch, Walrosszähne und Pelze von Ottern und Mardern geladen. Über den inneren Seeweg fuhr das Schiff im Windschatten unzähliger Inseln und Schären entlang an Gegenden, die Raumsdal, Sunnmoer, Sogn oder Rogaland genannt wurden. An der Südspitze von Agdir, bei der Insel Lindandisnes, drehte es von den zerklüfteten Küsten ab und steuerte durch den Skagerrak, die Verbindung zwischen den Meeren, hin zu den Küsten des dänischen Reichs.
Seither zog das Land an Steuerbord vorbei, bis die Knörr endlich die Mündung eines Fjords erreichte, der sich viele Meilen tief in die jütländische Halbinsel erstreckte und an dessen Ende eine große Hafenstadt lag.
Den Fjord nannte man Slien, die Stadt Haithabu.
Durch den Regenschleier sah der Krieger die schmale, von Marschland gesäumte Fjordeinfahrt, die kaum fünfzig Schritt breit war. Zur Orientierung für die Seefahrer war der Durchlass weithin sichtbar durch hohe Pfosten markiert worden.
Bald, dachte der Krieger, bald sind wir da …
Er horchte auf, als der Rabe einen Laut von sich gab.
Ein Mann trat zu ihnen in den Bug. Zum Schutz vor dem Regen hatte er sich in einen dicken Mantel gehüllt. Sein Name war Ögir, er war der zweite Steuermann. Ögir warf dem Krieger einen unsicheren Blick zu. Vielleicht hatte er sich überwunden, auf den Krieger zuzugehen, weil ihn das nahende Ende der Reise übermütig werden ließ. Vielleicht lag es auch am Wein, von dem er sich bereits am helllichten Tag eine ordentliche Ration genehmigt hatte.
Ögir räusperte sich übertrieben laut.
«Manchmal ist hier kein Durchkommen», sagte er dann und zeigte zur Mündung. «Wenn der Sturm längere Zeit von Osten weht, versandet die Einfahrt, weißt du. Dann heißt es: alle Mann ins Wasser und den Kahn drüberziehen.»
Der Krieger bemerkte die dunkelgelben Zahnstümpfe in Ögirs Mund, als dieser ihn auffordernd anlachte. Dann erstarb das Lachen.
«Du redest nicht viel, Normanne», meinte Ögir. «Hast ja eigentlich auch recht. Schwatzen ist Sache der Weiber. Aber man redet über dich. Willst du wissen, was man so sagt?»
Der Krieger wandte sich ab.
«Ich erzähle es dir trotzdem», fuhr Ögir fort. «Weißt du, die Leute sind der Meinung, dass du gefährlich bist. Sie haben Angst vor dir. Es wurden sogar jede Nacht zwei Wachposten abgestellt, die aufpassen sollten, dass du niemanden ausraubst. Verdenken kann man es ihnen irgendwie nicht. Schau dich an, Normanne. Du trägst diese dunklen Kleider und hast immer diesen Raben bei dir, so wie ein normaler Mann sein Weib. Hast du keines? Ich meine: ein Weib. Ach, lassen wir das. Ich will dir nicht zu nah treten. Aber eines wollte ich dir doch noch verraten. Ich glaube es ja nicht, aber einige hier sind wirklich davon überzeugt, dass du ein Wiedergänger bist. Weißt schon, so einer, der von den Toten kommt …»
Ögir schaute den anderen mit einem Blick an, als wolle er dessen Reaktion abschätzen. Doch es kam keine. Der Krieger starrte aufs Land.
Ögir holte tief Luft.
«Es macht wirklich keinen Spaß, sich mit dir zu unterhalten», stellte er fest. «Seit Tagen sind wir auf diesem Schiff. Da kommt man sich doch näher. Man redet, man isst und trinkt zusammen. Aber du stehst nur hier am Steven mit dieser … dieser Leichenmiene. Sag mal, trauerst du vielleicht um irgendwen?»
Der Krieger drehte sich abrupt zu Ögir um. Die Worte des Steuermanns hallten in seinen Ohren nach. Warum wurden diese Fragen gestellt? Warum ließ man ihn nicht in Ruhe?
«Ha!», bemerkte Ögir. «Liege ich richtig? Du trauerst, nicht wahr? Um wen denn?»
Mit einem triumphierenden Grinsen schob er die rechte Hand unter seinen Mantel.
Als der Krieger das sah, griff er blitzschnell nach Ögirs Hals und drückte fest zu. Ögirs Augen weiteten sich vor Angst.
«Nein, bitte … nicht», flehte er röchelnd.
Der Krieger packte Ögirs Hand und zog sie aus dem Mantel. Aber Ögir hatte keine Waffe. Es war nur ein mit Wein gefüllter Trinkschlauch. Der Krieger ließ ihn wieder los.
«Bist du … wahnsinnig?», stieß Ögir keuchend aus. «Du hättest mich fast umgebracht.»
Er setzte den Wein an und nahm einen großen Schluck. Seine Hand zitterte.
In dem Moment durchfuhr ein Beben das Schiff, als der erste Steuermann das Ruder durchzog, um die Knörr zum Fjord zu manövrieren. Das Schiff stellte sich in die Wellen. Die Planken knirschten wie die ungefetteten Räder eines Ochsenkarrens. An Bord wurden Kommandos gerufen. Männer eilten an den Mast und begannen das flatternde Segel einzuholen.
Ögir steckte den Trinkschlauch wieder ein und wankte zu den Seeleuten, um ihnen zu helfen. Der Krieger beobachtete, wie sie das Segel zusammenrollten, dann die Riemen einlegten und mit der Strömung zur Einfahrt ruderten.
Schnell näherte sich das Schiff dem Durchlass. Dann glitt es wie von Geisterhand geschoben hindurch. Die Pfosten zogen vorbei wie Mahnmale.
Jenseits der Einfahrt öffnete sich der Fjord zu einem weiten, flachen Gewässer. Das Fahrwasser war hier durch Haselstangen markiert, damit die Schiffe in den Untiefen nicht auf Grund liefen. Möwen, die vor dem Sturm Schutz gesucht hatten, erhoben sich in den regenverhangenen Himmel und stoben kreischend über die Schilfwiesen an den Ufern davon.
Der Krieger richtete den Blick voraus in die Wand aus Regen und grauen Wolken, die ihm so undurchdringlich vorkam wie die Sicht auf seine eigene Zukunft.
Er sah nur eins, den Tod.
Erling lehnte seinen Dreschflegel gegen die Scheunenwand und wischte sich die staubigen Hände an der Lederschürze ab.
Am Langhaus sah der Bauer seine Kinder, den zweijährigen Godrek und die ein Jahr ältere Aefa, an einer großen Pfütze spielen. Beim Anblick der dreckverschmierten Kleinen musste Erling lächeln. Seine Frau Gunnlaug würde alle Hände voll zu tun haben, bis die Kleinen wieder sauber waren – und das war gut so. Es hatte nicht viel gefehlt, und Gunnlaug hätte niemals wieder die Kinder waschen, das Essen zubereiten oder andere Arbeiten auf dem Hof verrichten können.
Erling schüttelte die sorgenvollen Gedanken an seine Frau ab.
Als er sich gerade umdrehen wollte, um in die Scheune zu gehen und dem Knecht und den beiden Sklaven wieder beim Dreschen zu helfen, ließ ihn etwas innehalten.
Auf einem der Hügel jenseits des Hofzauns glaubte er, etwas gesehen zu haben.
Erling beschattete seine Augen mit der rechten Hand, um im Gegenlicht der tief stehenden Abendsonne etwas erkennen zu können. Tatsächlich! Er hatte sich nicht getäuscht.
Vor der roten Abendsonne zeichneten sich jetzt deutlich die Umrisse mehrerer Männer und Pferde ab. Ein halbes Dutzend Reiter waren es, die die Anhöhe herunterkamen und geradewegs auf den Hof zuhielten. Als sie den Fuß des Hügels erreicht hatten, sah Erling etwas, das ihm einen Schauer über den Rücken trieb.
Die Reiter trugen lange Mäntel, und die Mäntel waren rot gefärbt. Blutrot.
Kalte Angst ergriff Erling. Schnell nahm er den Dreschflegel, dessen Stäbe mit gegerbten Aalhäuten zusammengehalten wurden. Mit beiden Händen hielt er den Flegel vor sich wie eine Waffe. Eine Waffe? Es war lächerlich. Er wusste genau, dass er damit nichts würde ausrichten können. Dennoch fiel ihm nichts anderes ein.
Er drehte sich zum Haus um. Die Kinder matschten noch immer in der Pfütze. Vor der geschlossenen Tür pickten Hühner nach Körnern. Die alte Ziege hob den Kopf aus dem Gras und stieß einen meckernden Laut aus.
Gedanken rasten durch Erlings Kopf. Es blieb keine Zeit mehr, die Kinder zu verstecken. Dennoch musste er versuchen, sie zu retten. Schnell setzte er sich in Bewegung und lief am Weidenzaun entlang in ihre Richtung.
«Aefa! Godrek!», rief er. «Ins Haus mit euch! Schnell!»
Als sie die Stimme ihres Vaters hörten, unterbrachen sie ihr Spiel und schauten zu ihm hinüber. Godrek grinste breit. Er hatte sich gerade eine Handvoll Dreck in den Mund gestopft.
«Ins Haus mit euch!», rief Erling im Laufen. «Sofort! Verschwindet!»
Die Tür des Langhauses öffnete sich, und die Magd kam heraus, gefolgt von Gunnlaug, die sich humpelnd auf einen Stock stützte.
«Was schreist du so?», wollte Gunnlaug wissen.
Erling war nur noch zwanzig Schritt vom Haus entfernt.
«Bringt endlich die Kinder rein!», rief er.
Doch Gunnlaug und die Magd reagierten nicht, sondern schauten Erling nur fragend an.
Aefa begann zu weinen, als sie die aufgebrachte Stimme ihres Vaters hörte. Dann bemerkten auch die Frauen die Reiter. Sofort packten sie die Kinder, zogen sie ins Haus und schlossen die Tür mit einem Knall. Erling, der inzwischen die Pfütze erreicht hatte, hörte, wie der Riegel von innen vorgeschoben wurde.
Er drehte sich zum Hoftor um. In vollem Galopp näherten sich die Reiter auf dem Weg, der vom Hof aus am Hügel vorbeiführte. Einige Meilen weiter westlich mündete er schließlich in den Heerweg, der durch die ganze Mark verlief und das dänische Reich mit der sächsischen Hammaburg verband.
Erling atmete durch, dann ging er den Reitern entgegen. Sie waren nur noch etwa hundert Schritt entfernt und kamen schnell näher. Über den fliegenden Hufen wehten die Mäntel wie blutgetränkte Banner.
Aus der Scheune drangen noch immer die Geräusche der Dreschflegel, mit denen Finn, der Knecht, und die Sklaven das Getreide bearbeiteten, das sie in den vergangenen Tagen vom Feld geholt hatten. Die Ernte war in diesem Jahr mager ausgefallen, und der Roggen würde kaum ausreichen, um sie alle über den Winter zu bringen.
Wenn wir diesen Winter erleben, dachte Erling.
In die klopfenden Dreschgeräusche mischten sich die Geräusche der Pferdehufe.
Erling rief nach Finn. Einmal, zweimal, dreimal musste er laut rufen, bis die Männer in der Scheune ihn endlich hörten und ihre Arbeit unterbrachen. Finn kam als Erster heraus, dann die beiden Sklaven; es waren zwei junge, tüchtige Männer, die Erling vor einigen Jahren gekauft hatte. Damals hatte er sich noch Sklaven leisten können. Doch mittlerweile drohte ihn die Last der Abgaben, die er an den neuen Markgrafen entrichten musste, zu ersticken.
Erling winkte seine Männer zu sich. Als sie bei ihm waren, gingen sie zu viert den Reitern entgegen, die das Tor inzwischen erreicht hatten und auf dem Hof ihre schwitzenden Pferde zügelten.
Der Anführer, ein langer, hagerer Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren mit dunkelblondem Haar und kurzem Bart, trieb sein Pferd auf Erling zu.
Erling war dem Mann niemals zuvor begegnet, aber er wusste sofort, dass es der Markgraf war.
Der Graf musterte Erling und dessen Männer scharf. Mit den heruntergezogenen Augenbrauen wirkte seine Miene bedrohlich, und als er die Lippen zu einem kalten Lächeln verzog, gefror Erling das Blut in den Adern.
Die anderen Reiter schlossen auf. Bis auf einen waren alle mit Schwertern und Lanzen bewaffnet. Als Erling in dem unbewaffneten Mann, der mit einer schwarzen Kutte bekleidet war, den Bischof erkannte, schwanden seine allerletzten Hoffnungen. Seine Familie und er würden nicht unbeschadet aus dieser Angelegenheit kommen.
Der Mann, der sein Pferd neben das des Grafen führte, war Bischof Poppo. Er war ein kräftiger Mann von etwa dreißig Jahren, mit breiten Schultern, fliehender Stirn, dunklem Haar und einem Gesichtsausdruck wie ein grauer Wintertag, der niemals hell werden wollte. Poppo war in der ganzen Mark bekannt und gefürchtet für seine Methoden, mit denen er von den Menschen das erfuhr, was er wissen wollte. Ob es der Wahrheit entsprach oder nicht.
Der Graf beugte sich auf seinem Pferd vor. Er lächelte noch immer, als er auf die Dreschflegel zeigte.
«Haben wir die braven Bauern bei der Arbeit unterbrochen?», fragte er.
«Ja, Herr», erwiderte Erling, wobei er sich bemühte, das Beben in seiner Stimme zu unterdrücken.
«Ist dein Name Erling Heimingsson?», wollte der Graf wissen.
Erling nickte. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn.
Der Graf legte ihm seine rechte Hand mit leichtem Druck auf die Schulter. Die knochigen Finger fühlten sich an wie die Klauen eines Raubvogels.
«Es tut mir leid, dass wir dich von der Arbeit abhalten», sagte der Graf und zog seine Hand wieder zurück. «Aber es gibt da eine Sache, die duldet leider keinen Aufschub. Das wirst du bestimmt verstehen.»
Erling rang sich ein vages Lächeln ab. «Ich bin mir nicht sicher … aber ich glaube, ich weiß nicht, was Ihr meint …»
«Oh, natürlich! Wie unhöflich von mir. Natürlich sollte ich mich erst einmal vorstellen. Ich kann kaum voraussetzen, dass du mich kennst, Bauer. Oder?»
Das Grinsen des Grafen wurde breiter. Er hatte große weiße Zähne.
«Ich … ja, natürlich …», stammelte Erling, «natürlich weiß ich, wer Ihr seid.»
«Nun?»
«Ihr seid der Markgraf.»
«Kennst du auch meinen Namen?»
«Ja … Ihr seid Thankmar von … von …»
«Thankmar von der Mersburg», half er. «Aber im Augenblick bin ich wohl eher Thankmar von der lausigen Mark.»
Er legte den Kopf in den Nacken und lachte ohne jede Freude. Seine Soldaten stimmten ein.
Dann drehte er sich zum Bischof um. «Seht Ihr, Herr Poppo. Der Erling Heimingsson ist ein kluger Mann, ein sehr kluger Mann. Hab ich Euch das nicht gesagt?»
Der Bischof verzog keine Miene. Sein Blick war fest auf Erling gerichtet, während er zwischen den Fingern seiner rechten Hand ein silbernes Kruzifix drehte, das im Licht der Abendsonne rötlich schimmerte.
«Überlasst mir die Schlangenbrut. Je schneller wir damit fertig sind, desto besser …»
«Nein, mein lieber Herr Bischof», unterbrach ihn der Graf. Er legte ihm seine linke Hand auf den Arm. «Wir haben viel Zeit, die ganze Nacht.»
Wieder an Erling gewandt, sagte er: «Wollt ihr die Dreschflegel nicht zur Seite legen, Bauer? Für heute habt ihr genug gearbeitet. Außerdem könnte man annehmen, ihr wolltet diese Geräte gegen uns richten.»
Erling stöhnte innerlich auf. Um ihn nicht noch mehr gegen sich aufzubringen, ließ er jedoch schnell die Flegel von Finn einsammeln und zur Scheune bringen.
Währenddessen stiegen die Besucher von ihren Pferden ab.
Erling wich einen Schritt zurück. «Wir haben die Abgaben für dieses Jahr bereits entrichtet, Herr», sagte er in einem letzten Anflug von Widerstand.
«Ach ja?», meinte der Graf. «Das hast du also getan! Also, Herr Bischof, ich muss schon sagen – der Erling ist nicht nur ein kluger Mann, sondern auch einer, der weiß, welche Pflichten er zu erfüllen hat.»
Poppo verzog das Gesicht. «Lasst uns endlich mit der Befragung beginnen.»
«Du musst entschuldigen, Erling», sagte der Graf ungerührt. «Der Bischof scheint ein wenig ungeduldig zu sein. So wird man wohl, wenn man gezwungen ist, länger in diesem Land zu verweilen. Nichts für ungut, Herr Bischof, aber alles zu seiner Zeit. Nun wird sich unser Freund erst einmal um unsere Pferde kümmern, nicht wahr, Erling? Auch hast du bestimmt nichts dagegen, wenn dein Herr es sich in deinem Haus gemütlich macht. Nach dem Ritt sind wir hungrig und durstig.»
Mit diesen Worten ließ er Erling stehen und ging gemeinsam mit dem Bischof und den Soldaten zum Haus weiter. Eine Böe fuhr über den Hof und ließ die roten Mäntel aufwallen.
Blutmäntel!
Erling hatte gehört, dass man die Krieger so nannte.
Er sah, wie der Graf das Haus erreichte und mit der Faust gegen die Tür hämmerte. Ihm wurde nicht geöffnet.
Finn war inzwischen von der Scheune zurückgekehrt. «Vielleicht wollen der Graf und seine Männer ja wirklich nur etwas essen und trinken», flüsterte er Erling zu.
«Vielleicht», erwiderte der matt.
Er legte die Hände um den Mund und rief seiner Frau im Haus zu, sie solle dem Besuch die Tür öffnen.
Was bleibt mir anderes übrig?, dachte er resignierend.
Der Riegel wurde zur Seite geschoben, und der Graf und die anderen drängten ins Innere des Hauses.
Erling schickte Finn und die Sklaven mit den Pferden zur Scheune, wo sie die Tiere mit Heu und Wasser versorgen sollten. Er selbst blieb zurück und wandte sich zum Tor. Dahinter begann der Weg, auf dem man den Hof verlassen konnte.
Um wenigstens das eigene Leben zu retten.
Thankmar sonnte sich in der Furcht, die sich auf den Bauerngesichtern widerspiegelte. Sie glotzten ihn an wie schlachtreife Schafe.
Das ganze Gesindel war im Wohnbereich des Langhauses zusammengetrieben worden. Alles in allem waren es neun Menschen, eine ganz normale Bauerngesellschaft also, von denen es Hunderte in der Mark gab. Da waren Erling und sein Weib, das zwei kleine Kinder an ihren Busen drückte, dann noch ein Knecht, zwei Mägde und zwei Sklaven. Sie hockten starr vor Angst um eine Feuerstelle. Über den Flammen hing ein Kessel, der mit einer langen Kette an einem der Dachbalken befestigt war.
Erlings Haus war nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Es gab einen kuppelförmigen Ofen zum Brotbacken und zwei Webstühle. Die Betten waren im abgetrennten mittleren Bereich eingerichtet, dahinter die Ställe für Ziegen, Schweine und den Ochsen. Ganz hinten befand sich auch die Vorratskammer, die Thankmars Männer gleich entdeckt und ausgeräumt hatten.
Sie waren zu sechst unterwegs: Thankmar, der Bischof und die vier Soldaten, die der Graf aus seiner Haustruppe für diese Mission ausgewählt hatte – und sie alle waren sehr hungrig. Es hatte nicht lange gedauert, bis ein Teil der Vorräte an Räucherwürsten, Trockenfisch und Brot verspeist war. Das musste man Erling lassen: Er und seine Leute verstanden es, köstliche Speisen zuzubereiten.
Nun saß Thankmar den Bauern gegenüber auf einer erhöhten, mit Fellen gepolsterten Bank, die eigentlich dem Hausherrn vorbehalten war, und kaute in aller Ruhe auf einem Stück Wurst. Dann aß er ein Stück Brot und spülte alles mit einem ordentlichen Schluck Bier herunter.
Die Bauern mussten warten. Je länger Thankmar sie im Ungewissen ließ, desto größer wurde ihre Angst, und je größer ihre Angst war, desto eher würden sie mit ihm zusammenarbeiten.
Unterdessen wuselte Poppo im Haus herum, durchwühlte mit Wolle gefüllte Körbe und Tongefäße, in denen Getreide und Mehl gelagert wurden. Dem Bischof war anzusehen, dass er es kaum erwarten konnte, endlich mit dem Verhör zu beginnen.
Thankmar biss ein großes Stück von der Wurst ab. Er hatte Zeit. Zumindest das hatte ihn die bittere Erfahrung gelehrt, die er vor gut einem Jahr bei der Schlacht gegen die Ungarn machen musste: Er durfte niemals überstürzt handeln.
Er war so nah dran gewesen. So verdammt nah!
Nur einen Wimpernschlag war er davon entfernt gewesen, seinem Onkel die Kehle durchzuschneiden – seinem Onkel, dem König. Dann kamen die beiden Jobbágy. Bevor Thankmar den König töten konnte, waren die Angreifer so nah, dass Thankmar eine Entscheidung treffen musste: Entweder würde er sich gegen die Ungarn wehren, oder sie beide – der König und Thankmar – würden ihr Leben verlieren. Also tötete Thankmar einen der Ungarn, indem er ihm das für Otto bestimmte Messer in die Brust warf. Den anderen Reiter spießte er mit der goldenen Lanze auf.
Was für eine Ironie des Schicksals! Thankmar wollte den König töten, stattdessen hatte er dem Bastard das Leben gerettet. Davon schienen alle überzeugt zu sein – zumindest fast alle. Die Soldaten, die kurz darauf beim Zelt eingetroffen waren, hatten Thankmar einen Helden genannt. Ebenso wie die Überlebenden der Schlacht, aus der Ottos Heer als ruhmreicher Sieger hervorgegangen war.
Man feierte den König als Bezwinger der Ungarn und Thankmar als Retter des Königs.
Nur einer hatte Thankmar nicht gefeiert – der König selbst.
Otto musste geahnt haben, was Thankmar im Schilde führte. Doch im allgemeinen Sieges- und Freudentaumel war es dem König unmöglich gewesen, Thankmar für einen Verdacht zu bestrafen, den er niemals hätte beweisen können. Und so hatte sich Otto seines gefährlichen Neffens entledigt, indem er ihn hierhergeschickt hatte. Weit weg vom König – in die dänische Mark, dieses versumpfte Niemandsland. Die Mark war ein Landstrich zwischen den Fronten der Sachsen und der Dänen; ein Fliegenschiss, dessen südliche Grenze der Fluss Egidora und im Norden der dänische Schutzwall, das Danewerk, markierten.
Ottos vorgebliche Großtat, den Neffen mit dem Posten des Markgrafen zu belohnen, war natürlich eine Verbannung, und nur Thankmar und der König wussten das.
Aber Otto hatte einen Fehler begangen. Er hätte Thankmar töten sollen. Hätte ihn töten müssen! Denn der Tag der Rache würde kommen, und dann wäre Thankmar besser vorbereitet. Deshalb musste er in Ruhe planen.
Sein nächster Feldzug gegen den König hatte bereits begonnen, und heute Abend würde er einen weiteren Schritt in die Richtung tun, die ihn, den Enkel des Sachsenkaisers Heinrich und den Sohn Thankmars des Älteren, dorthin bringen würde, wo er hingehörte.
Auf den Thron!
Ein Schrei gellte durch das Langhaus.
Es war Poppo, der lautstark seinem Triumph Ausdruck verlieh. Offenbar hatte er etwas entdeckt. Der Bischof eilte durch den Wohnraum, und mit der Miene eines erfolgreichen Jägers gab er Thankmar ein aus Bernstein geschnitztes Amulett.
«Schaut es Euch an, Herr Graf! Das ist das Zeichen ihres Götzen Thor.»
Auf dem Gesicht des Bischofs lag der seltene Anflug eines Lächelns.
Thankmar betrachtete das Amulett, das so lang wie sein Daumen war.
«Ich habe es in einem der mit Getreide gefüllten Krüge gefunden», sagte Poppo stolz. «Die Heiden haben sich Mühe gegeben, es gut zu verstecken. Aber mit Gottes Hilfe habe ich es entdeckt.»
Poppo drehte sich zu den Bauern um. «Nichts», rief er mit ausgestrecktem Zeigefinger, «hört ihr – nichts bleibt dem Allmächtigen verborgen!»
Erling und die anderen senkten die Köpfe noch tiefer. Gunnlaug weinte leise.
Das Schlachtvieh sieht die gewetzten Messer, dachte Thankmar belustigt.
Er streckte die Beine aus und biss noch einmal von der Wurst ab. Er wusste, was nun kommen würde. Schließlich war dies nicht sein erster Missionsbesuch mit Poppo.
Der Bischof hielt das silberne Kruzifix in die Höhe und rief: «Im Jahre 948, also vor nunmehr acht Jahren, verlieh mir die apostolische Vollkommenheit, der selige Papst Agapet, das Recht, die Früchte des Glaubens über die nordischen Völker strömen zu lassen. Und auf diesen Anfang himmlischer Barmherzigkeit folgte, durch Gottes Mitwirkung, ein solches Gedeihen …»
Poppos Worte lullten Thankmar ein. Nur mit Mühe konnte er ein Gähnen unterdrücken.
Nachdem der Bischof eine Weile von Gottes Wirken auf heidnischem Boden geschwärmt hatte, ließ er sich von Thankmar das Amulett zurückgeben und ging damit zu Erling.
«Du weißt, Bauer, dass es verboten ist, dieses Zeichen zu tragen», hielt Poppo ihm vor.
«Es ist ein Erbstück meines Vaters», erwiderte Erling leise. «Mein Vater hatte es von seinem Vater und er von seinem. Das Amulett ist seit langer Zeit im Besitz unserer Sippe …»
«Ja, genau! Viel zu lange herrschten die Götzen über dieses Land. Doch nun hat es die Kirche im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes unter Strafe gestellt, den alten Götzen zu dienen und ihre Symbole anzubeten.»
Poppo drehte sich um und warf den Thorshammer ins Feuer. Der Bernstein verfärbte sich schwarz.
Als Erling dies sah, weiteten sich seine Augen, und für einen Moment schien es, als wolle er in die Flammen greifen. Aber das Amulett war bereits zu einem dunklen Klumpen zusammengeschmolzen.
«Kommen wir nun zu den weiteren Verfehlungen», sagte Poppo, «derer ihr euch schuldig gemacht habt …»
Doch bevor er fortfahren konnte, unterbrach Thankmar ihn.
Widerstrebend trat Poppo hinter die Bank zurück.
Thankmar wusste, dass der Bischof diese Auftritte genoss, und es tat ihm aufrichtig leid, Poppo den Spaß zu verderben. Aber diese Angelegenheit war von größter Wichtigkeit. Sie durfte auf keinen Fall durch übereifriges Handeln gefährdet werden.
Also wandte er sich an die Bauern.
«Seit einem Jahr bin ich euer Herr», sagte er milde. «Ich habe die Stelle des Markgrafen Wichmann angetreten, der auf heimtückische Weise ermordet wurde. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Erling, erzähl mir, ob du eigentlich weißt, welches meine oberste Aufgabe ist.»
«Ihr seid unser Lehnsherr. Wir müssen Abgaben zahlen für das Land, das wir bestellen.»
«O ja! Aber natürlich nehme ich nicht nur. Nein, ich gebe euch auch. Sehr viel sogar. Obwohl ich glaube, dass ihr euch dessen gar nicht bewusst seid.»
Erling glotzte ihn an, als habe Thankmar soeben verkündet, mit ihm Freundschaft schließen zu wollen.
«Ich gebe euch Frieden und Sicherheit», fuhr Thankmar fort. «Ich beschütze meine Vasallen – und im Gegenzug leistet ihr mir Abgaben. So einfach ist das. Es ist die von Gott gegebene Ordnung der Welt, in der es Herren und Untertanen gibt. Und die Untertanen sind ihren Herren nicht nur zu Abgaben verpflichtet, sondern auch zu Gehorsam, Treue und Aufrichtigkeit. Kannst du dem folgen, Erling?»
Der Bauer nickte.
«Gut», meinte Thankmar. «Ich sehe, wir verstehen uns. Dann schick jetzt deine Frau zu mir.»
Erling zuckte zusammen. Gunnlaugs Weinen wurde lauter; auch ihre Kinder begannen zu schluchzen.
«Ich habe Eurem Verwalter doch bereits alle Abgaben gezahlt, die Ihr fordert, Herr», sagte Erling schnell. «Fleisch, Getreide, Töpfergefäße, sogar einen der beiden Ochsen, und ich weiß nicht, wie ich ohne ihn im nächsten Frühjahr die Felder bestellen soll …»
«Psst», machte Thankmar und wandte sich an die Bäuerin. «Komm zu mir, Frau!»
Gunnlaug warf ihrem Mann einen verzweifelten Blick zu. Erling presste die Lippen zusammen und ballte die Hände zu Fäusten. Auch er kämpfte mit den Tränen.
«Komm her, Frau!», wiederholte Thankmar.
Als sich Gunnlaug noch immer nicht bewegte, mischte Poppo sich ein. «Lasst mich mit ihr die Wasserprobe machen, Herr Graf. Auf diese Weise habe ich noch jeden widerspenstigen Geist gebrochen.»
Thankmar konnte an den entsetzten Gesichtern der Bauern ablesen, dass sie genau wussten, was Poppo meinte. Die Wasserprobe war seine Spezialität. Mittlerweile gab es wohl in der ganzen Mark niemanden mehr, der noch nicht davon gehört hatte.
Aber Thankmar schüttelte den Kopf. «Mein lieber Herr Bischof, ich bin sicher, dass diese braven Menschen auch ohne Eure Wasserprobe mit uns zusammenarbeiten werden, oder, Erling?»
Der Bauer beugte sich zu seiner Frau und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Daraufhin nickte sie traurig und übergab ihm die weinenden Kinder. Dann half der Knecht der Frau, sich aufzurichten.
«Das Weib soll allein gehen», befahl Thankmar. Allmählich war es an der Zeit, einen schärferen Ton anzuschlagen.
Auf unsicheren Füßen humpelnd, bewegte sich die Frau auf Thankmar zu. Er sah ihr an, welche Schmerzen ihr jeder Schritt bereitete.
«Es tut noch immer sehr weh, nicht wahr?», meinte Thankmar mit gespieltem Mitleid.
Sie war vor ihm stehen geblieben und wagte es nicht, ihn anzuschauen.
«Ja», antwortete sie leise.
«Wie ist dein Name, Frau?»
«Gunnlaug.»
«Zeig mir deine Beine, Gunnlaug!»
«Ich …»
«Zeig sie mir!», brüllte Thankmar so laut, dass sogar seine Soldaten zusammenzuckten.
Tränen kullerten über Gunnlaugs Wangen, während sie umständlich das Unterteil ihrer Tunika bis zu den Knien hochzog. Ihre Waden waren mit hässlichen Krampfadern überzogen.
Aber das war es nicht, was Thankmar sehen wollte.
«Höher!», forderte er.
Endlich entblößte Gunnlaug ihre Oberschenkel.
«Ah!», seufzte Poppo im Hintergrund.
Thankmar betrachtete Gunnlaugs Oberschenkel, die mit faustgroßen Wundmalen übersät waren. Auf der Haut waren noch Reste einer nicht vollständig eingezogenen Heilsalbe zu erkennen, mit der die Wunden behandelt worden waren, und zwischen die Wunden hatte jemand mit Kohle eigenartige Zeichen gemalt.
Genau das war es, was Thankmar sehen wollte!
Ein unangenehmer Schauer kroch über seinen Rücken. Alles deutete darauf hin, dass er auf der richtigen Spur war. Der Mann, der ihn über gewisse Vorgänge auf Erlings Hof informiert hatte, war also die zwei Silbermünzen wirklich wert gewesen, mit denen Thankmar ihn belohnt hatte.
Schnell tastete er nach dem Talisman, dem Holzspan, um seine aufflammende Angst im Keim zu ersticken.
Nachdem er die Zeichen gesehen hatte, war er davon überzeugt, dass die Zauberin hier gewesen war! Jetzt brauchte es nur noch eines letzten Beweises.
«Haben die Wunden vor wenigen Tagen noch geeitert, Frau?», fragte Thankmar.
Gunnlaug nickte.
«War das Jucken so schlimm, dass du ständig gekratzt hast?»
Sie nickte wieder.
«Und dann kam das Fieber?»
«Ja.»
«Ja. Es ist eine grausame Krankheit. Eigentlich dürftest du heute Abend gar nicht mehr unter uns weilen – so wie Gott es für dich bestimmt hat.»
«Bitte, Herr!», flehte Erling vom Feuer her.
«Wer hätte sich dann um den Haushalt gekümmert? Oder um die Kinder?», fuhr Thankmar unbeirrt fort. «Wer hätte deinem Mann das Nachtlager gewärmt? Auf wessen Brüste hätte er sein müdes Haupt betten sollen, wenn er abends erschöpft ins Bett gekrochen wäre?»
«Die Familie braucht mich …», flüsterte Gunnlaug.
Da sprang Thankmar auf. Mit einem Satz war er vor ihr. Sein Herz trommelte. Doch er zwang sich zur Zurückhaltung.
«Natürlich tut die Familie das», sagte er ruhig. «Jede Familie braucht eine Frau, die so tüchtig und so aufrichtig ist wie du. Deshalb sag mir nun die Wahrheit: Wer hat dich geheilt?»
Gunnlaug schwieg.
Thankmar hörte vor Aufregung das Blut in seinen Ohren rauschen. Poppo und die Soldaten rückten näher heran.
«Sag es mir, Weib!»
«Ich … ich darf nicht. Ich … habe es geschworen …»
«Nicht einmal deinem Herrn darfst du es verraten? Nicht einmal mir?»
Thankmar streckte die linke Hand aus. Wie Spinnenbeine legten sich seine knochigen Finger um Gunnlaugs Hals.
Dann drückte er fest zu.
In Gunnlaugs Augen sah er Todesangst.
«Wer hat dich geheilt?», zischte Thankmar und drückte noch fester zu.
Noch immer kam kein Name über ihre Lippen.
Über ihren bebenden Körper hinweg sah Thankmar, wie Erling die Kinder an eine Magd übergab und sich erhob. Vorsichtig näherte sich der Bauer.
«Bitte, Herr», flehte Erling.
Thankmar konnte kaum glauben, dass der Bauer so töricht sein konnte, sich gegen seinen Herrn aufzulehnen. Aber Erling trat tatsächlich neben seine Frau und legte Thankmar eine Hand auf den Arm, um ihn von Gunnlaug wegzuziehen.
Da gab der Graf einem seiner Soldaten mit einem Kopfnicken ein Zeichen.
Ernust, der Hauptmann seiner Haustruppe, schnellte vor. Der Sachse hatte eine gedrungene, kompakte Statur mit breiten Schultern und der Kraft eines Ochsen. Ohne zu zögern, stieß er Erling von hinten eine Lanze zwischen die Schulterblätter. Dann zog er den aufgespießten Bauern von Thankmar weg, und ein anderer Soldat schlug Erling mit einem Schwert den Kopf vom Hals.
Die Angstschreie der Kinder und des Gesindes erfüllten das Haus.
Gunnlaug schluchzte.
«Wer hat dich geheilt?», wiederholte Thankmar seine Frage, die Hand noch immer an ihrem Hals.
Sie sagte noch immer nichts.
Thankmar musste verblüfft feststellen, dass ihre Angst vor der Zauberin größer zu sein schien als die vor dem eigenen Tod.
Mit der freien Hand zog er das Messer aus seinem Gürtel. Er wartete kurz, bis Gunnlaug ahnte, was er vorhatte, dann stach er die Klinge bis zum Heft in ihren linken Oberschenkel.
Sie stieß einen langen, ohrenbetäubenden Schrei aus.
Als die Frau in sich zusammensackte, ließ Thankmar sie los, damit ihr Gewicht ihn nicht mit hinunterzog. Dann beugte er sich über die sich vor Schmerzen windende Frau und schob seine Hand in den Ausschnitt ihrer Tunika. Er tastete zwischen ihren fleischigen Brüsten herum, bis er auf einen fingerlangen Holzstab stieß, den sie an einem Lederband um den Hals trug.
Als er den Stab hervorzog und sein Blick darauffiel, zuckte er zusammen, als habe er glühende Kohlen angefasst. Wie Gunnlaugs Oberschenkel war auch der Stab mit Zauberzeichen verziert, die die Heiden Runen nannten.
Bei Gott, er hatte den Beweis!
«Rede!», zischte er in Gunnlaugs Ohr. «Rede – oder ich töte auch noch deine Kinder!»
Gunnlaug schloss die tränenfeuchten Augen. Dann nannte sie endlich den Namen, den Thankmar hören wollte.
Aki fürchtete sich vor dem nächsten Morgen.
Doch als er jetzt, am Vorabend des wichtigsten Tages in seinem jungen Leben, dem Gesang seiner Mutter lauschte, vergaß er für einen Moment seine Sorgen. Er liebte es, Velva singen zu hören, und am liebsten hatte er das Lied, das sie ihm und seinen beiden Schwestern an diesem Abend vorsang.
«Von Süden die Sonne, des Mondes Gesell. Sie schlang die Rechte um den Rand des Himmels. Die Sonne kannte ihre Säle nicht. Die Sterne kannten ihre Stätte nicht, und der Mond, er kannte seine Macht noch nicht …»