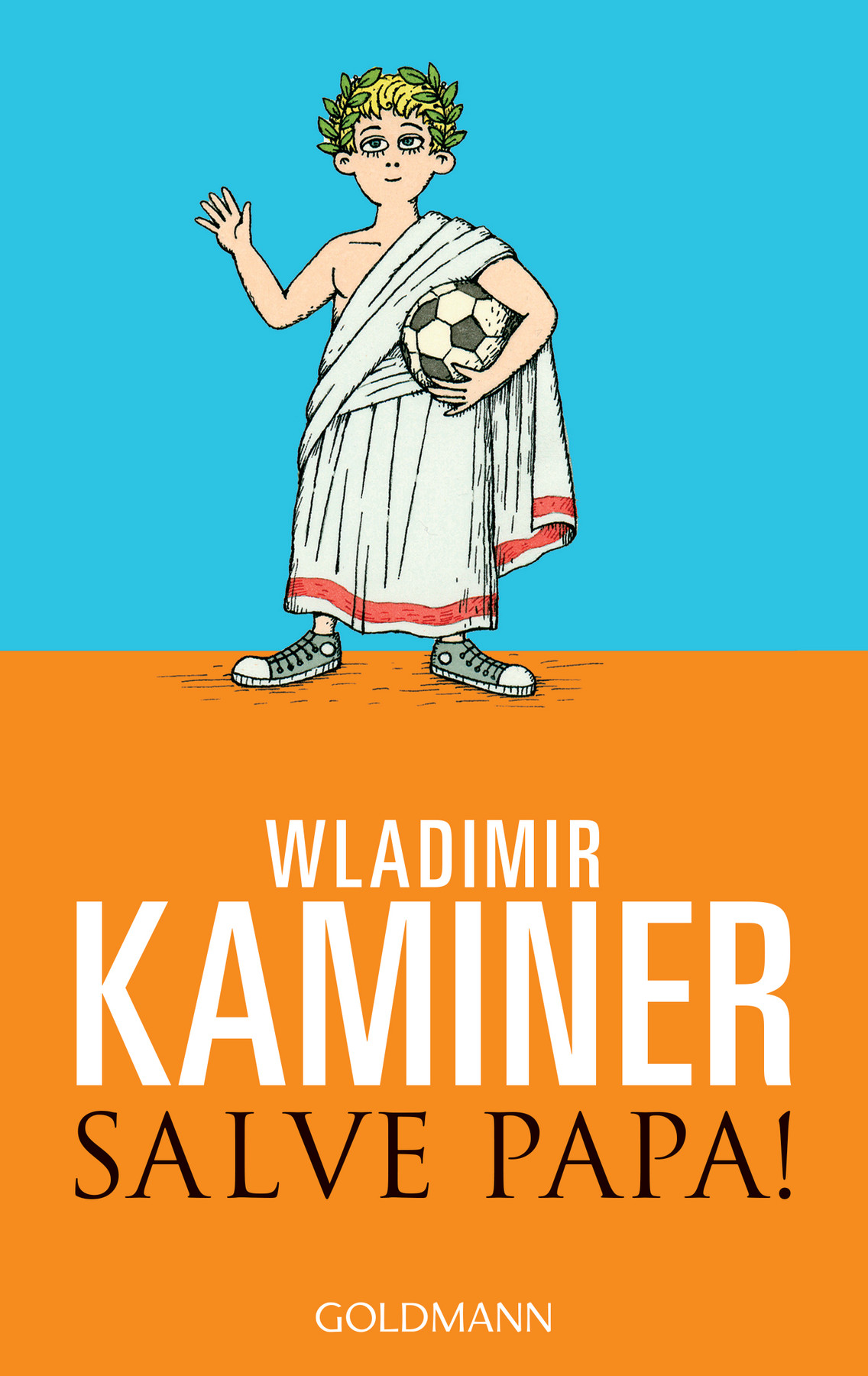
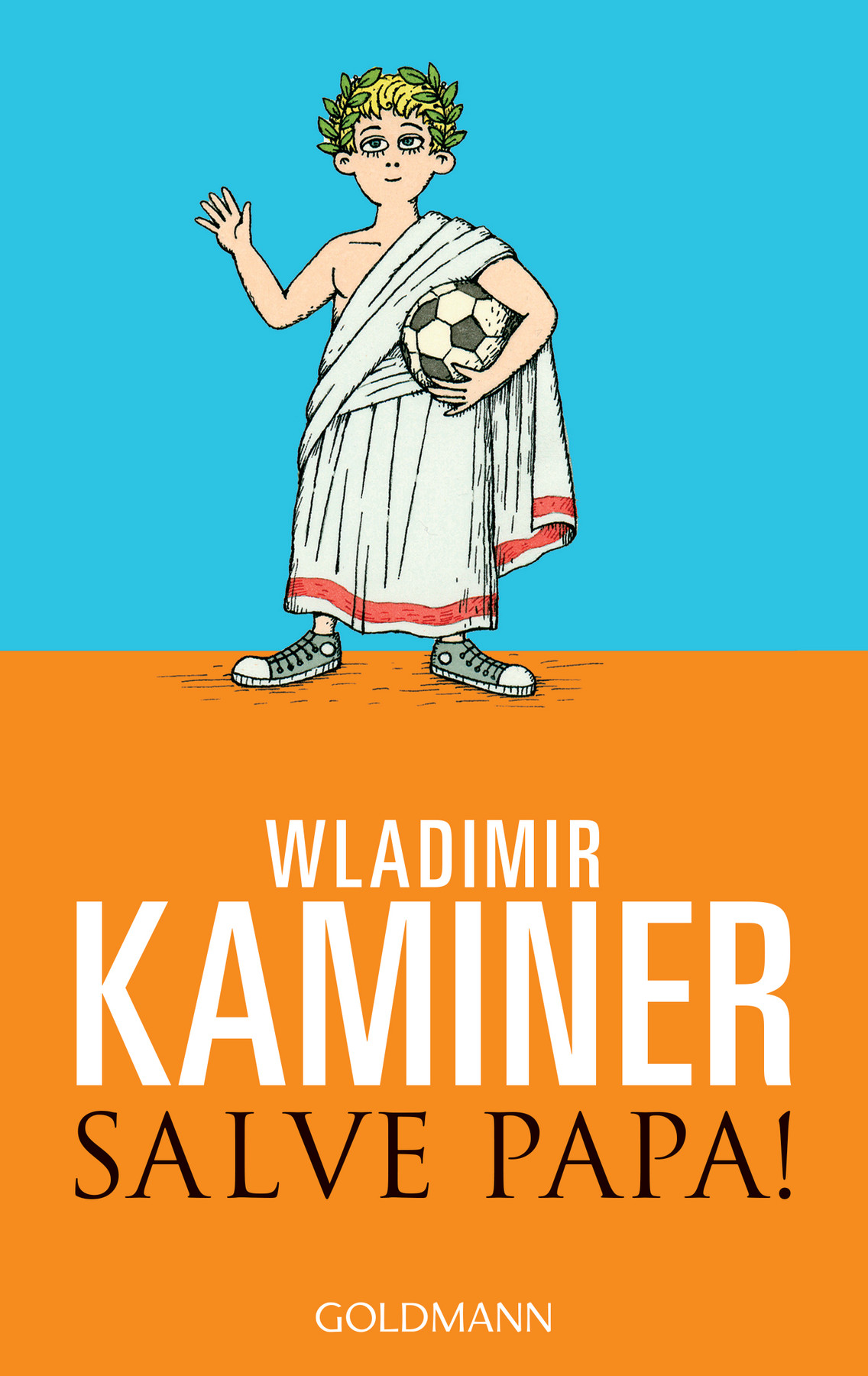

Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind weder vorhanden noch beabsichtigt.
Es sei denn, die Personen wollen sich in dem Buch erkennen.
Wladimir Kaminer

Unsere Wohnung ist kaum mehr zu erkennen, die neue Generation ist hier seit einigen Jahren am Werk. Die Pokémon-Karten werden regelmäßig aus der Waschmaschine gefischt, im Kühlschrank steht Aquarellfarbe, unter meinem Tisch versammeln sich kaputte Flugzeuge und auf dem Fernseher liegt eine Scheibe Wurst, die auf die Katze wartet, wie meine Tochter es ausdrückt. Die Möbel werden laufend aufeinandergestellt, um die Höhepunkte der Wohnung zu besteigen. Außerdem baut mein Sohn derzeit gerne Brücken. Um seine täglichen Routen durch die Zimmer zu erleichtern, will er mit einem Bügelbrett das Tal zwischen dem Klavier und dem Sofa überbrücken, wobei jedem Erwachsenen beim Anblick dieser rutschigen Brücke sofort klar ist: Sie wird nicht halten. Abgesehen davon hat Sebastian auf dem Klavier nichts verloren. Wie kann ich ihm das erklären?
Hier sollte eigentlich der Generationenvertrag in Kraft treten. Ich als belehrende Generation muss meiner moralischen und rechtlichen Verpflichtung nachkommen und der heranwachsenden Generation zurufen: Füße weg vom Bügelbrett, es wird nicht halten! Ich habe Erfahrung, ich war schon drauf, ich weiß es! Doch die heranwachsende Generation lehnt mein Wissen ab. Mit einer einzigen Handbewegung – »Stopp, Papa! Ich muss jetzt selbst!« – fällt die heranwachsende Generation mit großem Knall vom Bügelbrett, und das bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche.
Trotzdem wird der Generationenvertrag auch jetzt noch nicht akzeptiert. Die schlichte Erkenntnis, dass alles auf der Welt schon zig Mal von den Altvorderen geklärt wurde und in unzähligen Schriften, aber auch mündlich seit Anbeginn der Zeiten weitervermittelt wird – diese Tatsache wird nicht zur Kenntnis genommen. Jede Generation will alles aufs Neue klären, das von den anderen längst Erkannte noch einmal selbst herausfinden. Und wenn sie von anderen zu lernen bereit ist, dann ganz sicher nicht von den lieben Eltern. Von Skywalker und den Pokémons, von dämlichen Schulkameraden, später vielleicht von den bösen Jungs von MTV. Die, die uns lieben, können uns nicht erziehen. Sie sind dazu verdammt, uns zuzuschauen.
Oft kann ich nur raten, woher meine Kinder ihre Befehle zum Brückenbauen und zu anderem Quatsch erhalten. Sie können das doch unmöglich alles selbst erfunden haben. War es eine versteckte Stimme aus dem Fernsehen, für Erwachsene nicht hörbar? Während Eltern denken, ihre Kinder würden dem plüschigen kinderfreundlichen Winnie Puh zuschauen, werden gleichzeitig auf hohen Frequenzen, die für normal gewachsene Ohren nicht wahrnehmbar sind, Informationen gesendet:
»Nehmt sofort das Bügelbrett und stellt es zwischen dem Sofa und dem Klavier auf. Steht es schräg? Sehr gut! Und jetzt draufklettern!«
Und später, in der Pubertät, sagen andere Eltern, soll es sogar noch schlimmer werden.
Der Generationenvertrag scheitert am Kommunikationsproblem. Manchmal ist es eine richtige Qual, in einer Welt zu leben, die ständig verbessert wird. Die Häuser werden modernisiert, Straßen neu asphaltiert, Kinos vergrößert, alles wird besser, nur man selbst nicht. Im Schulhort ist man anscheinend auch diesem Verbesserungswahn zum Opfer gefallen. Eine neue fortschrittliche Idee kursierte kürzlich in unserem Bezirk: Man beschloss, den Kindern für ein paar Monate ihr ganzes Spielzeug wegzunehmen. Dadurch, so lautete die Botschaft, würden sie gezwungen, wieder ihre Phantasie einzusetzen, mehr miteinander zu kommunizieren, neue Spiele zu erfinden, und letztendlich würden sie dadurch zu besseren Menschen. Die Kinder ohne Spielzeug durften dann zum Beispiel in der Küche nach einem Eimer oder Kochtopf fragen, und wenn sie den Pädagogen plausibel erklären konnten, wofür sie die Dinge brauchten, bekamen sie sie auch. Wäre ich ein Kind in einem solchen Hort, hätte ich wahrscheinlich als Erstes nach Streichhölzern und Benzin gefragt, um Revolution zu spielen.
Die Idee der Spiele ohne Spielzeug brachte meine Tochter Nicole mit nach Hause. Zuerst spielten sie und ihr Bruder Sebastian Sport und schmissen dabei Kopfkissen im Wohnzimmer hin und her. Zu den wichtigsten Sportgeräten gehörte eine Flasche Mineralwasser, glaubte meine Tochter zu wissen. Die Flasche kippte natürlich um. Daraufhin fingen Nicole und Sebastian an, mit dem Mineralwasser den Boden aufzuwischen. Als ich sie dabei erwischte, war unser Wohnzimmer nicht mehr wiederzuerkennen.
»Wir spielen ›Der große Waschtag im Kinderheim‹«, verkündete meine Tochter. In ihren kleinen Plastiktöpfchen brachten die beiden immer neue Portionen Leitungswasser herbei und kippten sie auf den Boden. Danach zogen sie ihre Arbeitsklamotten an, nahmen unsere Bettlaken als Waschlappen und fingen an, das Wasser durch das Zimmer zu jagen.
»Sag bitte Mama«, befahl mir Nicole, »sie braucht im Wohnzimmer nicht mehr zu putzen. Nur vielleicht ein wenig staubsaugen. Und morgen nehmen wir uns dein Arbeitszimmer vor, außerdem werden wir auch noch alle Spiegel waschen, und dann wird in der Wohnung alles perfekt sauber sein.«
Als Hobbyerzieher sah ich mich total überfordert und dachte fieberhaft nach. Den Kindern den Arbeitseinsatz zu verbieten und die improvisierten Waschlappen wegzunehmen, wäre pädagogisch gesehen ein grober Fehler. Aber aufmunternd zuzusehen, wie sie konsequent die ganze Wohnung versumpften, hielt ich auch für falsch. Die Kinder waren in ihrem Arbeitseifer aber nicht mehr zu bremsen und trugen bereits ein zweites Eimerchen Wasser ins Schlafzimmer. Außerdem wollten sie ihren freiwilligen Einsatz von mir bezahlt bekommen, mit einem Mindestlohn von acht Euro fünfzig die Stunde.
»Hier, siehst du? Alles sauber! Also her mit dem Geld«, sagte meine Tochter. Anscheinend war dieses kapitalistische Preis-Leistungs-Verhältnis der wichtigste Teil des Spiels »Großer Waschtag im Kinderheim«.
»Weißt du«, sagte ich, »das Geld kannst du nur von Fremden verlangen, nicht aber von deinen eigenen Eltern. Deine Mutter und ich haben euch mehrere Jahre lang den Po abgewischt, ohne etwas dafür zu verlangen.«
Meine schlaue Tochter dachte kurz nach und sagte dann: »Na gut, dann können wir das gegenrechnen. Wie viel möchtest du fürs Powaschen?«
Ich wollte bei meinen Kindern nicht allzu billig wegkommen. »Tausendfünfhundert Euro im Monat für die ersten drei Lebensjahre!«
Das haute sie um. »So viel?«
»Dafür war ich aber rund um die Uhr im Einsatz, und das gleich für zwei«, erläuterte ich meinen Preis.
»Trotzdem zu teuer«, erwiderte mein Sohn.
Sie wollten mich runterhandeln. Diese verfluchte Erziehung machte mich fertig. Zum Glück kam meine Frau rechtzeitig nach Hause. Sie schluckte, als sie den Sumpf in der Wohnung sah, war aber pädagogisch wie immer unschlagbar.
»Ja«, sagte sie, »das ist sehr toll, dass ihr euch um Ordnung und Sauberkeit kümmert. Doch ihr müsst noch lernen, wie man richtig den Boden wischt. Erst einmal braucht ihr nicht so viel Wasser, zweitens haben wir die richtigen Waschlappen unter der Spüle.«
Sie zog sich um und fing an, den Kindern die Geheimnisse des Aufwischens zu erklären. Aus der Erziehungspflicht entlassen, ging ich mit der Zeitung in die Küche. Man hörte das Klappern von Eimern und leise Belehrungen. Da draußen entstand langsam eine bessere, eine saubere Welt mit strahlenden Kindern …
»Nur zu, macht weiter so«, murmelte ich erleichtert.

Als wir vor zwei Jahren in eine neue Wohnung zogen, dachte ich ernsthaft darüber nach, eine Tischtennisplatte in meinem Arbeitszimmer aufzustellen. Heute bekomme ich nicht einmal mehr ein Schachbrett da rein. Das Boot ist voll – und nicht mit Blumen und Fanpost, sondern mit kaputten elektronischen Geräten: Rechner, Monitore, Telefone, Videorekorder … Letzte Woche verabschiedete sich sogar mein fast neuer DVD-Player! Dabei wirkte er noch so frisch und gesund. Man kann dafür natürlich leicht den Kindern die Schuld in die Schuhe schieben, die den DVD-Player laufend verwirrten, indem sie ihm eine Scheibe Jagdwurst statt eines Films reinschoben. Ich glaube aber eher, dass der Kapitalismus schuld ist. Es fängt mit dem Überangebot an, das uns zickig und entscheidungsschwach macht. Frustriert blättert man in der endlosen Speisekarte der Konsumgesellschaft, die täglich dicker, poetischer und handgeschriebener wird. Wir können gar nicht wissen, was wir wirklich gerne hätten, denn diese Erkenntnis gewinnt man nur durch Vergleich.
Aber wer wagt es schon, alles Angebotene auszuprobieren? Dafür reicht kein Menschenleben aus. Um einen festen Standpunkt in diesem Meer des Angebots zu gewinnen, versuchen es viele mit Verzicht. Diese aufgeklärten Nonkonformisten senken ihre Bedürfnisse bewusst auf das Lebensnotwendige, zum Beispiel im Bereich der Hauselektronik: Sie sagen Nein zu Playgames. Sie sagen Nein zum Fernseher und noch mal Nein zum schnurlosen Irgendwas. Alles, was sie für ihre Freizeit brauchen, ist ein kleiner Laptop mit CD-Brenner sowie ein Handy mit eingebautem Fotoapparat, vielleicht noch ein DVD- oder MP3-Player für unterwegs und basta!
Für den Kapitalismus ist eine solche Askese ein harter Schlag. So kann er nicht arbeiten, das Kapital zirkuliert dabei nicht richtig, und die ganze Ökonomie gerät ins Stocken. Der Kapitalismus muss den zickigen Konsumenten fest an sich binden, ihn abhängig von seinen immer neuen Waren machen. Also produziert er schlechte Waren, die gut aussehen, aber schnell kaputtgehen. Bestimmt wäre es bei dem heutigen Stand der Technik ein Klacks, ewig haltende Videorekorder aus Stahl in jeder Wohnung zu installieren, große Fernseher in die tragenden Wände einzubetonieren und einen zweiundsiebzig Jahre dauernden Film laufen zu lassen als ultimativen Kick für das ganze Leben: immer spannend, immer humorvoll, vor zwanzig Uhr süß und kinderfreundlich, zur späten Stunde ungemein erotisch – ein Film für alle, ein Quotenkiller, mit täglichem Happyend, konkurrenzlos. Der Sozialismus hätte es bestimmt so gemacht.
Aber sein schlauer Widersacher ist an solchen Glanzleistungen gar nicht interessiert. Stattdessen verkauft der Kapitalismus Zeichentrickfilme auf DVD gleich in zehn Sprachen, meistens in solchen, die kein Schwein versteht. Dieses Überangebot hat zur Folge, dass meine Kinder sich ihre Zeichentrickfilme bevorzugt auf Finnisch oder Japanisch reinziehen, nachdem sie die deutsche Fassung bis zum Überdruss genossen haben. Das eine Kind schreit neuerdings gerne »Hoschimori!« und behauptet, es heiße auf Japanisch: »Der Zug kommt«. Das andere Kind behauptet, das wäre finnisch und würde »Ich liebe dich« bedeuten. Oft stecken sie gleich zwei Filme übereinander in den DVD-Player, drücken auf alle Knöpfe gleichzeitig oder versuchen, das Innere des Geräts mit einem Strohhalm (»Tschassiro« auf Japanisch) zu untersuchen. Jetzt ist der Player, wie gesagt, kaputt. Mancher wird sagen, die Kinder seien daran schuld. Ich denke aber doch: Es ist der Kapitalismus.

Wir Männer haben es nicht leicht, uns in einer weiblich dominierten Gesellschaft zu behaupten, besonders wenn wir noch klein sind und in die Grundschule gehen. Wenn ich meinen Sohn beobachte, wie er in seiner überwiegend von großwüchsigen Mädchen beherrschten Klasse 3A schwitzt, dann möchte ich nicht in seiner Haut stecken. Jede Woche berichtet eine andere meinungsbildende Zeitschrift, das männliche Chromosom sei bloß ein skurriles Abbild des weiblichen, ein Irrtum der Natur, für die erfolgsorientierte Fortpflanzung nicht wirklich notwendig – die pure Genombeschmutzung.
Im Fernsehen wird das Aussterben des männlichen Geschlechts stellvertretend anhand von Tierfilmen prophezeit. Frösche, Vögel, Insekten. Die Männchen werden von den Weibchen aufgefressen oder bleiben noch auf dem Wege zur Braut irgendwo hängen. Besonders abstoßend finde ich die Dokumentation über alte Krokodile, die sich nicht mehr vermehren können, obwohl sie sich von weiblichen Krokodilen noch durchaus angesprochen fühlen. Nur haben sich im Laufe der Evolution ihre Geschlechtsorgane so unglücklich verkrümmt, dass sie nicht mehr zu den modernen Krokodilweibchen passen. Ich nehme solche Filme immer sehr persönlich. Ich frage mich, was das Ganze soll. Was will uns der Filmemacher damit sagen? Jede Woche diese alten Krokodile – zum vierten Mal in Folge –, und jetzt auch noch Merkel.
Eine unterschwellige Hetzkampagne gegen Männer ist im Gange. Das fängt schon in der Schule an. Dort ist der Druck auf die heranwachsenden Männer bereits enorm hoch. Sie müssen ständig den bösen Buben, den Hooligan abgeben, Fußbälle in Fenster kicken, einander auf dem Hof verhauen, Mädchen an den Zöpfen ziehen. Das fällt einem heranwachsenden Mann nicht leicht. Erst recht, wenn die Mädchen in der Mehrzahl sind und meistens einen Kopf größer und zehn Kilo schwerer. Trotzdem werden sie als das zarteste Glied der Evolutionskette behandelt. Wenn ihnen etwas gelingt, werden sie in den Himmel gelobt, wenn sie etwas nicht können, werden sie entschuldigt. Die Jungs dagegen stehen immer auf der Kippe. Ein falscher Schritt, und du wirst als Versager abgestempelt.
Bei meinem Sohn war es der Schwimmunterricht, der ihn aus der Fassung brachte. Als Junge darf er keine Angst vor dem Wasser haben, er muss immer der Beste sein, oder gar nicht erst antreten. Zuerst war er mit der »Seepferdchen«-Übung im flachen Wasser nicht klargekommen, dann war er eine Woche krank, und danach hatte er erst recht keine Lust mehr.
Auch bei seinem ersten Religionsunterricht ging nicht alles glatt. So deutete er zum Beispiel die Geschichte von Jesu Geburt völlig falsch. In seiner Darstellung spielte der Esel die herausragende Rolle. Alles drehte sich um den Esel, der mit einer schwangeren Frau unterwegs war und nicht wusste, wohin damit. Er lief wie ein Wilder durch die Gegend und bekam dauernd verwirrende Ratschläge von fremden Menschen erteilt. In der Nacherzählung meines Sohnes war eigentlich der Esel Gott. Und so wie diesem biblischen Esel geht es heute auch dem modernen Mann: Er läuft ins Nirgendwo, während alle anderen auf seinem Rücken sitzen und ihn dazu noch unentwegt hänseln.
Zu meiner Schulzeit gab es noch keinen Religionsunterricht. Damals saß der Schnurrbart noch am richtigen Fleck. Mindestens die Hälfte des Schulpersonals war männlich, und in unserer Klasse gab es immer genauso viele Jungen wie Mädchen. Ich weiß bis heute nicht, wie diese Gleichzahl im Sozialismus geregelt wurde. Ob die Staatsmacht zum Beispiel überflüssige Geschlechtsgenossen abtreiben ließ und beim unterzähligen Geschlecht extra nachhakte. Auf jeden Fall war immer ein geschlechtliches Gleichgewicht gewährleistet, zumindest in meiner Schule N 701.
Neulich holte ich Sebastian vom Unterricht ab. Er saß auf dem Schulhof, ziemlich allein, hatte eine Beule am Kopf und die Hosentaschen voller Sand. Das sei kein Sand, sondern Lava, erklärte Sebastian. Er habe Vulkanausbruch gespielt.
»Es gibt zwei Dutzend Schüler in deiner Klasse. Warum musst immer du der Vulkan sein?«, regte ich mich auf.
Der Vulkan sei Marie-Luise gewesen, er habe lediglich den Ausbruch spielen wollen, verteidigte sich Sebastian. Doch sein Freund Peter habe ihn geschubst und sei früher ausgebrochen. Marie-Luise habe ihn daraufhin megastark verhauen, und jetzt seien sie ein Paar.
Mein Sohn hat eine eigene Zeitrechnung. Alles, was war, ist Vergangenheit, sagt er, alles, was kommt, ist Zukunft. Und alles dazwischen ist Mittelalter. In diesem Mittelalter haben Männer Kommunikationsprobleme, wenn es um die Annäherung an das andere Geschlecht geht. Und je kleiner die Männer sind, desto größer die Probleme. Ein Mann braucht Randale, um jemanden kennen zu lernen. Beim Randalieren kann er seine Qualitäten am besten entfalten. Eine sichere Nummer wäre zum Beispiel, ein Mädchen zu verhauen, um sich dann als Schutz vor sich selbst anzubieten.
In der Vergangenheit waren Mädchen leichte Beute für derartige Kommunikationsversuche. Man zog einfach an ihren langen Zöpfen, und schon war die Kommunikation hergestellt. Mädchen trugen lange Kleider, gingen nicht zum Karate- oder Judounterricht, und sie spielten nicht Fußball. Man schubste sie ein bisschen auf dem Hof, und schon war die Kommunikation da. In unserem heutigen Mittelalter aber sind lange Kleider und Zöpfe aus der Mode, weil die Eltern zu faul sind, Kleider zu bügeln und Zöpfe zu flechten. Die Mädchen des heutigen Mittelalters bieten keine Angriffsfläche mehr. Sie nehmen am Kampfsportunterricht teil, sie kicken Bälle in Fenster, sie können Fahrrad fahren und jonglieren. Sie sind außerdem noch aus einem rätselhaften Grund fast immer einen Kopf größer und zehn Kilo schwerer als die Jungs und können jeden verdreschen.
Eine Frage an die Wissenschaft: Wäre es nicht möglich, eine Zopfflechtmaschine zu entwickeln? Ist unser Mittelalter nicht gerade das Zeitalter der großen Entdeckungen, die uns das Leben erleichtern? Es wurden flüssige Tapeten erfunden, elektrische Nasenbohrer von Tchibo und beheizte Klobrillen. Der Weg zum absoluten Menschenglück nimmt durch diese Errungenschaften eine gewaltige Abkürzung. Es gibt sogar schon Hundefutter, das Hundescheiße leuchten lässt, damit der Mensch im Dunkeln nicht hineintritt. Aber es gibt noch immer keine Zopfflechtmaschine, die, auf jedem Schulhof installiert, die Kommunikationschancen der heranwachsenden Generation wesentlich verbessern würde. Mein Kind sucht derzeit unermüdlich nach neuen Wegen zum Vulkan. Er überredete mich, ihm eine präparierte Vogelspinne unter Glas auf dem Flohmarkt zu kaufen. Der Preis für diesen ausgetrockneten Kinderalbtraum war hoch: zwei Wochen ohne Computer und ohne Fernseher. Er ist trotzdem darauf eingegangen, denn er verband große Hoffnungen mit dem Insekt. Er nahm es mit in die Schule und erschreckte erst alle Kinder auf dem Schulhof, dann zeigte er die Spinne Marie-Luise und sagte, sie brauche keine Angst zu haben, solange er alles unter Kontrolle habe. Jetzt sind sie ein richtiges Paar.

Die Idee, unserem intelligenten Hauskater Fjodor die Möglichkeit zu geben, stellvertretend für alle Katzen der Stadt eine Kolumne zu verfassen, diesen Gedanken hatten wir schon lange. Die Chefredakteure des deutschen Feuilletons riefen bereits an: »Wann schreibt nun der Kater?«, fragten sie besorgt. Fjodor war ein idealer Kandidat für den ersten Katzenkolumnisten: Er sieht ziemlich durchgeknallt aus, hat einen Bart und ist dem berühmten russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski ähnlich. Er hat längst meinen Schreibtisch zu seinem Lieblingssitz auserkoren und setzt sich immer genau dazwischen: zwischen Mensch und Monitor. Wenn der Mensch eine Pause macht, um in der Küche eine Zigarette zu rauchen oder aufs Klo zu gehen, springt Fjodor heimlich auf der Tastatur herum. Ich habe ihn zwar noch nie dabei erwischt, aber schon öfter seine Ergüsse auf dem Monitor gelesen. Keine Frage, der Kater ist nicht dumm und hat bestimmt einiges zu erzählen. Er kann nur nicht richtig tippen. Auch seine Sprache ist karg. Mühsam haben wir innerhalb eines Jahres diese Katzensprache gelernt, in dem wir ihm ständig Fragen stellten. Es war wie ein endloses Katzen-Quiz mit kiloweise Katzenfutter, das es zu gewinnen galt. Nun wissen wir aber Bescheid. Wer denkt, hinter dem ständigen Miauen ließen sich Berge von Intellekt entdecken, der wird enttäuscht sein. Einmal »Miau« heißt »Nein!«, zweimal »Vielleicht später…«, und dreimal »Miau« hintereinander bedeutet so viel wie »Na klar!«.
Ich dachte, vielleicht kann mir der Kater seine Kolumne diktieren, wie es sein berühmter Namensvetter, der Schriftsteller Dostojewski, oft tat. Er war ein temperamentvoller Mensch; seine Gedanken flossen schneller, als seine Hand sich bewegen konnte. Wenn er eine neue Idee zu einem Roman hatte, flogen die verschmierten Blätter nur so durch die Wohnung. Sie wurden von seiner Sekretärin sorgfältig gesammelt und abgetippt. Später verzichtete Dostojewski gänzlich auf die Blätter und diktierte nur noch; die Sekretärin tippte, und so ging es viel schneller. Der freie Lauf seiner Phantasie war
Er wurde auf einmal ganz bescheiden. »Nein«, miaute er, »vielleicht später.«
»Komm sofort runter, Fjodor!«, rufe ich ins Treppenhaus.
»Na klar!«, antwortet er.
»Guten Morgen, Kollege«, sage ich dann zu ihm. »Lust auf Wurst?«
»Na klar.«