

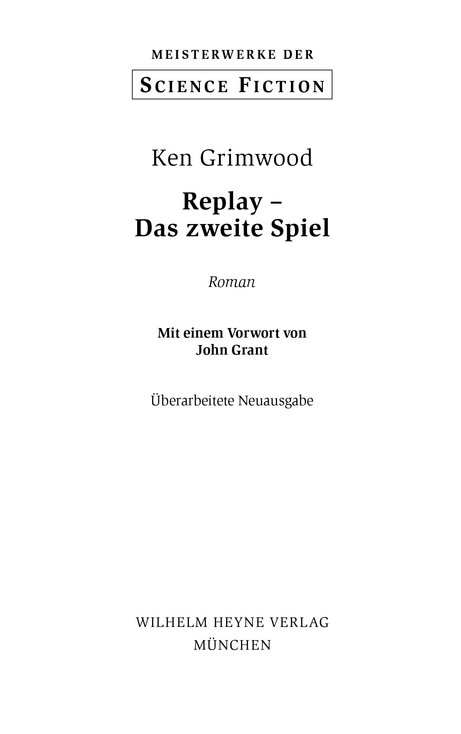
Ken Grimwood, 1944 geboren, arbeitete zeit seines Lebens als Radiojournalist und Schriftsteller. Neben »Replay – Das zweite Spiel« veröffentlichte er weitere Romane und Erzählungen. Er starb im Juni 2003 in Santa Barbara, Kalifornien.
Peter Skjøren erwachte mit einer frischen Erinnerung an einen Schock und an quälenden Schmerz. Er war geschäftlich in der Bantu-Republik gewesen, hatte in Mandela City mit dem Vizewirtschaftsminister zu Mittag gespeist – als er gestorben war.
Er war nach vorn über den Tisch gefallen, hatte seinen Drink auf die Hose des Regierungsbeamten verschüttet – das alles hatte er wahrgenommen, hatte sich verlegen gefühlt, trotz des zermalmenden Schmerzes in seiner Brust ... und dann die rot geränderte Dunkelheit, und schließlich nichts mehr.
Bis jetzt.
Auf einmal befand er sich in dem Laden in der Karl Johansgate, daheim in Oslo, wo er seine ersten kaufmännischen Kenntnisse erworben und herausgefunden hatte, dass seine Berufung in der Welt des Handels lag.
Der Laden war für einen Wohnblock abgerissen worden, vor zwanzig Jahren.
Peter schlug das Hauptbuch auf dem Schreibtisch auf, sah das Datum; senkte den Blick und sah junge, glatte Hände, keinen Ehering.
Alles lag noch in der Zukunft. Die Lawine in der Schweiz, die ihm seinen Sohn Edvard genommen hatte, die Nächte voll brütender Melancholie, die seine Frau Signe in die hoffnungslos abwärts gerichtete Spirale des Alkoholismus getrieben hatten.
Er hatte keinen Sohn, keine Frau, er hatte nur eine strahlende neue Zukunft vor sich, deren Fallgruben und Möglichkeiten er gründlich kannte und die er vermeiden oder ergreifen konnte, wie die Gelegenheit es erforderte.
Er konnte jene Jahre, jene vertrauten und längst vergangenen Jahre von 1988 bis 2017, neu durchleben, im Bewusstsein der Fehler, die er zuvor begangen hatte. Diesmal, schwor sich Peter Skjøren, würde er alles richtig machen.
Jeff Winston telefonierte gerade mit seiner Frau, als er starb.
»Wir brauchen ...«, sagte sie, doch den Rest bekam er nicht mehr mit, denn etwas Schweres schlug gegen seine Brust und presste die Luft aus ihm heraus. Der Telefonhörer fiel ihm aus der Hand und zerschmetterte den gläsernen Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch.
In der Woche zuvor hatte sie etwas ganz Ähnliches gesagt, nämlich: »Weißt du, was wir brauchen, Jeff?«, und es war eine Pause entstanden – keine endlose, keine endgültige wie diese tödliche Pause, aber doch eine spürbare Unterbrechung. Er hatte am Küchentisch gesessen, an der Stelle, die Linda als ›Frühstücksecke‹ bezeichnete, obwohl es überhaupt kein abgetrennter Platz war, bloß ein kleiner Resopaltisch mit zwei Stühlen, ungeschickt zwischen der linken Seite des Kühlschranks und der Vorderseite des Wäschetrockners platziert. Linda hatte auf der Arbeitsplatte Zwiebeln gehackt, als sie das sagte, und vielleicht waren es die Tränen in ihren Augenwinkeln gewesen, die ihn nachdenklich gemacht und ihrer Frage mehr Gewicht verliehen hatten, als sie eigentlich beabsichtigt hatte.
»Weißt du, was wir brauchen, Jeff?«
Und er hätte sagen sollen: »Was denn, Schatz?«, hätte es zerstreut und ohne Interesse sagen sollen, so wie er Hugh Sideys Kolumne im Time Magazine zur Präsidentschaft las. Aber Jeff war nicht zerstreut; Sideys Ergüsse scherten ihn einen Dreck. Tatsächlich war er so konzentriert und aufmerksam wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Deshalb sagte er eine Zeit lang gar nichts; er starrte nur auf die falschen Tränen in Lindas Augen und dachte an die Dinge, die sie brauchten, er und sie.
Zunächst einmal mussten sie verreisen, in ein Flugzeug steigen, das irgendwohin flog, wo es warm und landschaftlich reizvoll war – nach Jamaika vielleicht oder nach Barbados. Seit der lang geplanten, aber irgendwie enttäuschenden Rundreise durch Europa vor fünf Jahren hatten sie keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. Ihre jährlichen Reisen nach Florida zu seinen Eltern in Orlando und Lindas Familie in Boca Raton zählten für Jeff nicht; das waren Besuche in einer immer weiter zurückweichenden Vergangenheit, mehr nicht. Nein, was sie wirklich brauchten, war eine Woche, ein Monat auf einer dekadent fremden Insel – mit Liebe an endlosen leeren Stränden und nachts dem Klang von Reggaemusik in der Luft wie der Geruch feuerroter Blumen.
Ein hübsches Haus wäre ebenfalls schön gewesen, vielleicht eines dieser vornehmen Häuser in der Upper Mountain Road in Montclair, an denen sie an so vielen wehmütigen Sonntagen vorübergefahren waren. Oder ein Wohnsitz in White Plains, ein Zwölf-Zimmer-Tudorhaus an der Ridgeway Avenue in der Nähe des Golfplatzes. Nicht, dass er anfangen wollte, Golf zu spielen, aber all diese weitläufigen Grünflächen mit Namen wie Maple Moor und Westchester Hill würden eine viel erfreulichere Umgebung abgeben als die Auffahrten zum Brooklyn-Queens-Expressway und die Flugschneise von LaGuardia.
Sie brauchten auch ein Kind, obwohl Linda unter diesem Mangel wahrscheinlich mehr litt als er. Jeff stellte sich ihr ungeborenes Kind immer achtjährig vor, dem anstrengenden Säuglingsalter längst entwachsen, aber noch nicht in den Wirren der Pubertät. Ein gutes Kind, nicht übertrieben schlau und nicht affektiert. Ob Junge oder Mädchen, darauf kam es nicht an; nur ein Kind, ihr Kind und seines, das lustige Fragen stellte und zu nah am Fernseher saß und in dem sich der Funke der sich entwickelnden Individualität zeigte.
Aber es würde kein Kind geben; seit Lindas Bauchhöhlenschwangerschaft 1975 wussten sie, dass dies unmöglich war. Es würde auch kein Haus in Montclair geben und keins in White Plains; Jeffs Stellung als Nachrichtendirektor am WFYI-Radiosender in New York klang beeindruckender, lukrativer, als sie tatsächlich war. Vielleicht würde er noch den Sprung zum Fernsehen schaffen; aber mit dreiundvierzig war das zunehmend unwahrscheinlich.
Wir brauchen, wir brauchen ... ein Gespräch, dachte er. Wir sollten uns gegenseitig in die Augen sehen und einfach sagen: Es hat nicht funktioniert. Rein gar nichts, weder die Liebe noch die Leidenschaft oder die glorreichen Pläne. Alles ging daneben, und niemand hat Schuld. Es ist einfach so gekommen.
Doch das würden sie natürlich niemals tun. Das war der Hauptgrund ihres Scheiterns: die Tatsache, dass sie selten über tiefere Bedürfnisse sprachen, niemals das quälende Gefühl von Ungenügen anschnitten, das immer zwischen ihnen stand.
Linda wischte sich mit dem linken Handrücken eine bedeutungslose, zwiebelerzeugte Träne ab. »Hast du zugehört, Jeff?«
»Ja. Ich hab zugehört.«
»Was wir brauchen«, sagte sie, in seine Richtung blickend, aber nicht genau zu ihm hin, »ist ein neuer Duschvorhang.«
Höchstwahrscheinlich war das die Ebene von Bedürfnissen, die sie am Telefon hatte ansprechen wollen, als er starb. »... ein Dutzend Eier«, würde ihr Satz wahrscheinlich geendet haben. Oder: »... eine Packung Kaffeefilter.«
Doch warum dachte er das alles?, wunderte er sich. Er starb, um Himmels willen; sollten seine letzten Gedanken nicht irgendwie tiefschürfender sein, philosophischer? Oder vielleicht eine Wiederholung der Höhepunkte seines Lebens im Zeitraffer, dreiundvierzig Jahre in Betavision? Das war es doch, was Menschen beim Ertrinken erlebten – oder etwa nicht?
Es fühlte sich wie Ertrinken an, dachte er, während die gedehnten Sekunden verstrichen: der schreckliche Druck, das hoffnungslose Ringen nach Luft, die klebrige Feuchtigkeit, die seinen Körper bedeckte, während salziger Schweiß über seine Stirn hinabströmte und in seinen Augen brannte.
Ertrinken. Sterben. Nein, verdammt, nein, das war ein unpassendes Wort, anwendbar nur auf Blumen oder Haustiere oder andere Menschen. Alte Menschen, kranke Menschen. Unglückliche Menschen.
Sein Gesicht fiel auf den Schreibtisch, die rechte Wange wurde flach gegen den Aktenordner gepresst, den er gerade hatte durcharbeiten wollen, als Linda anrief. Der Sprung im Briefbeschwerer lag deutlich vor seinem geöffneten Auge: ein Riss durch die Welt, ein zerklüftetes Spiegelbild des in seinem Inneren tobenden Todeskampfs. Durch das zerbrochene Glas hindurch sah er die leuchtend roten Ziffern der Digitaluhr oben auf dem Bücherregal:
1:06 18 Okt 88
Und dann gab es nichts mehr, worüber nachzudenken sich vermeiden ließ, weil der Vorgang des Denkens zum Erliegen gekommen war.
Jeff bekam keine Luft.
Natürlich bekam er keine Luft; schließlich war er tot.
Aber wenn er tot war, warum spürte er dann, dass er keine Luft bekam? Und warum spürte er überhaupt etwas?
Er drehte den Kopf von der zerknautschten Decke weg und atmete. Abgestandene, stickige Luft, angefüllt mit seinem eigenen Schweißgeruch.
Also war er nicht gestorben. Irgendwie elektrisierte ihn die Erkenntnis ebenso wenig, wie ihn seine frühere Annahme, tot zu sein, in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Vielleicht hatte er das Ende seines Lebens insgeheim begrüßt. Jetzt würde alles bloß weitergehen wie zuvor: die Unzufriedenheit, der schleichende Verlust von Ehrgeiz und Hoffnung, der entweder seine Ehe hatte scheitern lassen oder Folge des Scheiterns war – er konnte sich nicht mehr erinnern, was davon zutraf.
Er schob die Decke von seinem Gesicht herunter und stieß mit den Füßen nach dem zerwühlten Laken. Irgendwo im abgedunkelten Zimmer spielte kaum hörbar Musik. Ein Oldie: ›Da Doo Ron Ron‹ von einer dieser Phil-Spector-Mädchengruppen.
Jeff tastete vollkommen desorientiert nach dem Lichtschalter. Er lag entweder in einem Krankenhausbett und erholte sich von dem, was im Büro geschehen war – oder er war zu Hause und erwachte gerade aus einem Traum, der schlimmer als üblich gewesen war. Seine Hand stieß gegen die Nachttischlampe, schaltete sie an. Er befand sich in einem kleinen, unordentlichen Zimmer mit Kleidungsstücken und Büchern, die über den Fußboden verstreut und wahllos auf zwei benachbarten Schreibtischen und Stühlen aufgetürmt waren. Weder ein Krankenhaus noch sein und Lindas Schlafzimmer, aber irgendwie vertraut.
Eine nackte, lächelnde Frau erwiderte seinen verdutzten Blick. Eine große Fotografie, die an der Wand hing. Ein Playboy-Ausklappbild, eins von den alten. Die dralle Brünette lag sittsam auf dem Bauch, auf einer Luftmatratze auf dem Achterdeck einer Yacht, den rot getüpfelten weißen Bikini an der Reling festgebunden. Mit dem feschen Seemannskäppi und dem sorgfältig gekämmten und gesprayten dunklen Haar hatte sie eine entfernte Ähnlichkeit mit der jungen Jackie Kennedy.
Die anderen Wände waren in demselben veralteten, kindischen Stil dekoriert: Stierkampf-Poster, ein stark vergrößerter roter Jaguar XK-E, ein altes Dave-Brubeck-Plattencover. Über dem Schreibtisch war eine rot-weiß-blaue Fahne befestigt, und die Stars and Stripes bildeten den Spruch NIEDER MIT DEM KOMMUNISMUS. Jeff grinste, als er das sah – genau so eine Fahne hatte er bei Paul Krassners einstmals schockierendem kleinem Käseblatt Der Realist bestellt, als er noch auf dem College war, als ...
Er setzte sich jäh aufrecht, in seinen Ohren dröhnte der Herzschlag.
Die alte Lampe mit dem Schwanenhals auf dem Schreibtisch nahe der Tür hatte sich immer vom Sockel gelöst, wenn er sie bewegt hatte, erinnerte er sich. Und der kleine Teppich vor Martins Bett hatte einen großen blutroten Fleck gehabt – ja, genau da – von dem Mal, als Jeff mit Judy Gordon nach oben geschlichen war und sie zu der Musik der Drifters im Zimmer umhergetanzt waren und dabei eine Flasche Chianti umgeworfen hatten.
Die diffuse Verwirrung, die Jeff beim Aufwachen empfunden hatte, machte völliger Verblüffung Platz. Er warf die Decke zur Seite, stieg aus dem Bett und ging unsicher zu einem der Schreibtische. Zu seinem Schreibtisch. Er musterte die gestapelten Bücher: ›Kulturelle Gesetzmäßigkeiten‹, ›Jugend in Samoa‹, ›Bevölkerungsstatistik‹. Soziologie 101. Dr.... wer? Danforth, Sanborn? In einem großen, muffigen Saal irgendwo auf der anderen Seite des Campus gab es um acht Uhr morgens nach der ersten Vorlesung immer Frühstück. Er hob das Benedict-Buch auf, blätterte es durch; mehrere Abschnitte waren dick unterstrichen und mit Randbemerkungen in seiner eigenen Handschrift versehen.
»... der WQXI-Hit der Woche, von den Crystals! Das nächste Stück ist für Bobby in Marietta, von Carol und Paula. Diese reizenden Mädels wollen Bobby Bescheid geben, genau wie die Chiffons glauben sie: He’s Soooo Fine ...«
Jeff schaltete das Radio aus und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Voller Verlegenheit wurde ihm bewusst, dass er eine ausgewachsene Erektion hatte. Wann war er zum letzten Mal so steif geworden, ohne an Sex auch nur gedacht zu haben?
Also schön, es war an der Zeit, sich Klarheit zu verschaffen. Irgendjemand musste ihm einen außergewöhnlich ausgeklügelten Streich spielen, nur kannte er niemanden, der solch grobe Scherze machte. Und selbst wenn er einen gekannt hätte – warum hätte er sich solche Mühe geben sollen? Die Bücher mit seinen Notizen hatte er schon vor Jahren weggeworfen, und niemand konnte sie so genau nachgemacht haben.
Auf seinem Schreibtisch lag eine Ausgabe von Newsweek mit einer Titelstory über den Rücktritt des westdeutschen Kanzlers Konrad Adenauer. Die Ausgabe datierte vom 6. Mai 1963. Jeff starrte auf die Ziffern, in der Hoffnung, dass ihm eine rationale Erklärung für das alles einfallen würde.
Es fiel ihm keine ein.
Die Zimmertür schwang auf, und der Innenknopf schlug gegen das Bücherregal. So wie er es immer getan hatte.
»He, was zum Teufel machst du noch hier? Es ist Viertel vor elf. Ich dachte, du hättest um zehn eine Prüfung in amerikanischer Literatur.«
Martin stand in der Tür, in der einen Hand eine Coke, in der anderen einen Stapel Lehrbücher. Martin Bailey, Jeffs Erstsemester-Zimmergenosse; sein bester Freund auf dem College und in den Jahren danach.
Martin hatte sich 1981 umgebracht, unmittelbar nach seiner Scheidung und dem darauf folgenden Bankrott.
»Was willst du machen?«, fragte Martin. »Dir ein Ungenügend geben lassen?«
Jeff musterte benommen seinen längst toten Freund: das dichte schwarze Haar, das noch keine Geheimratsecken aufwies, das faltenlose Gesicht, die strahlenden, jugendlichen Augen, die noch keinen nennenswerten Schmerz gesehen hatten.
»Hey, was ist los? Bist du okay, Jeff?«
»Ich ... fühl mich nicht besonders.«
Martin lachte und warf die Bücher auf sein Bett. »Was du nicht sagst! Jetzt weiß ich, warum mich mein Dad davor gewarnt hat, Scotch und Bourbon zu mischen. Mann, das war ja ein richtiges Schätzchen, das du gestern Abend bei Manuel aufgerissen hast. Judy hätte dich umgebracht, wenn sie da gewesen wäre. Wie heißt sie?«
»Ahh ...«
»Komm schon, so betrunken warst du nicht. Hast du vor, sie anzurufen?«
Jeff wandte sich mit wachsender Panik ab. Es gab tausend Dinge, die er Martin sagen wollte, aber nichts davon hätte mehr Sinn ergeben als diese verrückte Situation an sich.
»Was ist los, Mann? Du siehst richtig daneben aus.«
»Ich ... äh ... ich muss raus. Ich brauche etwas frische Luft.«
Martin runzelte verwundert die Stirn. »Yeah, ich schätze, ja.«
Jeff schnappte sich eine Baumwollhose, die auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch lag. Dann öffnete er den Schrank neben dem Bett und entdeckte darin ein indisches Hemd und eine Cordjacke.
»Geh zur Krankenstube«, sagte Martin. »Erzähl ihnen, du hättest die Grippe. Vielleicht lässt Garrett dich die Prüfung nachschreiben.«
»Ja, sicher.« Jeff zog sich rasch an und schlüpfte in ein Paar Korduanschuhe. Er stand kurz davor zu hyperventilieren und musste sich zwingen, langsam zu atmen.
»Denk an die Birds heute Abend, okay? Paula und Judy treffen sich mit uns um sieben im Dooley’s. Vorher wollen wir noch einen Happen essen.«
»Richtig. Bis dann.« Jeff trat auf den Korridor und schloss die Tür hinter sich. Er fand die Treppe und rannte drei Stockwerke hinunter, mechanisch mit einem »Hey!« antwortend, wenn einer der jungen Männer, an denen er vorbeikam, seinen Namen rief.
Die Eingangshalle war so, wie er sie in Erinnerung hatte: das Fernsehzimmer rechts, jetzt leer, abends bei Sportübertragungen und Raketenstarts immer überfüllt; eine Traube von kichernden Mädchen, die am Fuß der Treppe, die sie nicht hinaufgehen durften, auf ihre jeweiligen Freunde warteten; Coke-Automaten gegenüber dem schwarzen Brett, wo Studenten Zettel anklebten, auf denen sie Gebrauchtwagen, Zimmer, Fahrten nach Macon, Savannah oder Florida entweder suchten oder anboten.
Draußen stand der Hartriegel in voller Blüte und durchflutete den Campus mit einem rosa und weißen Leuchten, das vom sauberen weißen Marmor der würdevollen klassizistischen Gebäude reflektiert wurde. Das war Emory, daran gab es keinen Zweifel: die gekünsteltste Anstrengung des Südens, eine Universität im Stil der klassischen Ivy League zu erschaffen, eine Universität, welche die Region ihr Eigen nennen konnte. Die gewollt zeitlose Architektur war verwirrend – während er durch den viereckigen Innenhof trabte, vorbei an der Bücherei und der juristischen Fakultät, wurde Jeff klar, dass es ebenso gut 1988 wie 1963 sein konnte. Es gab keine klaren Hinweise, nicht einmal in der Kleidung und den Frisuren der Studenten, die auf den Rasenflächen umherschlenderten. Die Jugendmode der Achtziger war, vom postapokalyptischen Punk-Stil einmal abgesehen, von der seiner frühen Collegetage praktisch nicht zu unterscheiden.
Gott, die Zeit, die er auf diesem Campus verbracht hatte, die Träume, die hier ausgebrütet worden waren und sich niemals erfüllt hatten ... Hier war die kleine Brücke, die zur Konfessionsschule führte; wie oft war er dort mit Judy Gordon entlangspaziert? Und dort drüben am Psychologiegebäude hatte er sich im vorletzten Studienjahr fast jeden Tag mit Gail Benson zum Mittagessen getroffen: seine erste und letzte wahrhaft platonische Freundschaft mit einer Frau. Warum hatte er von der Bekanntschaft mit Gail nicht mehr gelernt? Warum hatte er sich, in so vieler Hinsicht, so weit von den Plänen und Ambitionen entfernt, die in der besänftigenden Ruhe des grünen Rasens und der prächtigen Gebäude geboren worden waren?
Als Jeff zum Haupteingang des Campus gelangte, war er über eine Meile gelaufen und erwartete, außer Atem zu sein, doch er war es nicht. Er stand auf der Anhöhe unterhalb der Glen Memorial Church und blickte auf die North Decatur Road und Emory Village hinab, das kleine Geschäftsviertel, das den Campus versorgte.
Die Bekleidungs- und Buchläden wirkten mehr oder minder vertraut. Besonders ein Laden, Horton’s Drugs, rief einen Schwall von Erinnerungen wach: Im Geiste sah er die Zeitschriftenständer vor sich, die lang gestreckte weiße Theke, an der nichtalkoholische Getränke verkauft wurden, die rotledernen Sitzecken mit den einzelnen Stereo-Jukeboxen. Und er sah Judy Gordons jugendlich frisches Gesicht vor sich, roch ihr frisch gewaschenes blondes Haar.
Kopfschüttelnd konzentrierte er sich auf die vor ihm ausgebreitete Szenerie. Wiederum konnte er nicht mit Sicherheit sagen, welches Jahr es war. Seit 1983, als Associated Press eine Konferenz zum Thema ›Terrorismus und die Medien‹ veranstaltet hatte, war er nicht mehr in Atlanta gewesen, und den Campus von Emory hatte er nicht mehr besucht, seit ... Herrgott, bestimmt seit dem ersten oder zweiten Jahr nach seinem Studienabschluss nicht mehr. Er hatte keine Möglichkeit, festzustellen, ob all die Läden dort die gleichen geblieben oder in der Zwischenzeit durch Hochhäuser ersetzt worden waren oder durch eine Mall.
Die Autos waren eine Sache für sich; jetzt, wo er darauf achtete, fiel ihm auf, dass auf der Straße kein einziger Nissan oder Toyota zu sehen war. Ausschließlich ältere Modelle, die meisten davon groß und benzinhungrig, Detroit-Modelle. Und ›älter‹ bedeutete nicht einfach nur Sechziger-Jahre-Design. Eine Menge Scheusale mit Haifischflossen waren zu sehen, die aus den Fünfzigern stammen mussten, aber 1963 hatte es natürlich ebenso viele sechs- und achtjährige Wagen auf den Straßen gegeben wie 1988.
Immer noch nichts Schlüssiges – allmählich fragte er sich, ob die kurze Begegnung mit Martin im Wohnheim nicht vielleicht doch nur ein ungewöhnlich realistischer Traum gewesen war, ein Traum, in dessen Verlauf er aufgewacht war. Es stand außer Zweifel, dass er inzwischen hellwach war und sich in Atlanta befand. Vielleicht war er beim Versuch, das trübselige Schlamassel zu vergessen, zu dem sein Leben geworden war, zusammengeklappt und in einer spontanen Anwandlung von Nostalgie hierher geflogen. Die große Zahl alter Wagen mochte ein Zufall sein. Jeden Moment konnte einer dieser kleinen japanischen Schuhkartons vorbeifahren, an deren Anblick er sich so gewöhnt hatte.
Es gab eine einfache Möglichkeit, dies ein für alle Mal zu klären. Mit federnden Schritten ging er hinunter zum Taxistand in der Decatur Road und stieg in das erste der dort wartenden blau-weißen Taxis ein. Der Fahrer war jung, vermutlich ein Studienanfänger.
»Wo soll’s denn hingehen?«
»Peachtree Plaza Hotel«, antwortete Jeff.
»Wie bitte?«
»Das Peachtree Plaza, in der Innenstadt.«
»Ich glaube, das kenne ich nicht. Haben Sie die Adresse?«
Gott, die Taxifahrer heutzutage. Mussten sie nicht eine Art Prüfung ablegen, Stadtpläne auswendig lernen und sich Orientierungspunkte einprägen?
»Sie wissen aber, wo das Regency ist, oder? Das Hyatt House?«
»Oh, ja klar. Dorthin wollen Sie?«
»Ganz in die Nähe.«
»Schon klar, Mann.«
Der Fahrer fuhr ein paar Blocks weit nach Süden und wandte sich auf der Ponce DeLeon Avenue nach rechts. Jeff tastete nach der Gesäßtasche, sich plötzlich der Tatsache bewusst, dass er in der fremden Hose nicht genug Geld bei sich haben könnte, doch es steckte eine abgenutzte braune Brieftasche darin.
Es war nicht seine Brieftasche, aber es war Geld drin – zwei Zwanziger, ein Fünfer und ein paar Ein-Dollar-Noten –, also brauchte er sich zumindest keine Sorgen wegen der Bezahlung zu machen. Er würde das Geld dem Besitzer zurückzahlen, wenn er die Brieftasche zurückgab, zusammen mit den alten Klamotten, die er hatte mitgehen lassen. Aber wem? Und wo?
Er öffnete eines der kleinen Fächer der Brieftasche, um eine Antwort auf diese Fragen zu erhalten. Darin fand er einen Studentenausweis der Emory-Universität, ausgestellt auf den Namen Jeffrey L. Winston. Einen Bibliotheksausweis von Emory, ebenfalls auf seinen Namen ausgestellt. Die Quittung einer chemischen Reinigung in Decatur. Eine gefaltete Cocktailserviette mit dem Namen eines Mädchens und einer Telefonnummer darauf. Ein Foto seiner Eltern vor dem alten Haus in Orlando, in dem sie gelebt hatten, bevor sein Vater schwer erkrankt war. Einen farbigen Schnappschuss mit einer lachenden, Schneeball werfenden Judy Garland, das schmerzhaft junge und überglückliche Gesicht von einem weißen Kragen eingerahmt, der gegen die Kälte hochgeschlagen war. Und einen Führerschein aus Florida, ausgestellt auf Jeffrey Lamar Winston, mit dem 27. Februar 1965 als Ablaufdatum.
Jeff saß allein an einem Tisch für zwei in der ufoförmigen Polaris-Bar oben auf dem Hyatt Regency und sah zu, wie die Skyline von Atlanta alle fünfundvierzig Minuten an ihm vorbeirotierte. Der Taxifahrer war jedenfalls nicht geistig beschränkt gewesen: Der siebzigstöckige Zylinder des Peachtree Plaza existierte nicht. Ebenfalls verschwunden waren die Türme des Omni International, der graue steinerne Klotz des Georgia Pacific Buildings und die riesige schwarze Schachtel des Equitable. Das hervorstechendste Gebäude in der Innenstadt von Atlanta war dieses hier, mit seiner oft kopierten atriumartigen Lobby. Und ein kurzes Gespräch mit der Bedienung hatte bestätigt, dass das Hotel neu, also vorerst noch einzigartig war.
Der schlimmste Moment war für ihn gewesen, als er in den Spiegel hinter der Bar geblickt hatte. Er hatte dies mit Absicht getan, im vollen Bewusstsein dessen, was er sehen würde, war aber trotzdem schockiert, als er sich seinem eigenen blassen, hageren, achtzehnjährigen Spiegelbild gegenübersah.
Der Junge im Spiegel wirkte objektiv etwas reifer als achtzehn; in diesem Alter hatte er kaum Probleme gehabt, Alkohol zu bekommen, so wie bei der Bedienung eben, doch Jeff wusste, dass dies pure Illusion war, bedingt durch seine Größe und die tief liegenden Augen. Für ihn war das Spiegelbild das eines unerfahrenen Halbwüchsigen ohne seelische Narben.
Und dieser Halbwüchsige war er selbst. Nicht in der Erinnerung, sondern hier und jetzt: die faltenlosen Hände, mit denen er den Drink hielt, die konzentrierten Augen, mit denen er sah.
»Können Sie schon einen neuen gebrauchen, Süßer?«
Die Bedienung lächelte ihn freundlich an, mit hellroten Lippen unter dunklen Mascara-Augen und einer veralteten hochtoupierten Frisur. Sie trug ein ›futuristisches‹ Kostüm, ein irisierendes blaues Minikleid von der Art, wie es in zwei oder drei Jahren überall von den jungen Frauen getragen werden würde.
In zwei oder drei Jahren – von jetzt an gerechnet. Den frühen Sechzigern.
Gott im Himmel!
Er konnte nicht länger abstreiten, was geschehen war, konnte nicht mehr darauf hoffen, es irgendwie wegzuargumentieren. Er war im Begriff gewesen, an einem Herzinfarkt zu sterben, hatte jedoch überlebt; er war in seinem Büro gewesen, im Jahr 1988, und jetzt war er ... hier. In Atlanta, 1963.
Jeff suchte nach einer Erklärung, nach etwas, das zumindest ansatzweise einen Sinn ergab. Als Heranwachsender hatte er eine ganze Menge Science Fiction gelesen, aber seine gegenwärtige Situation hatte keinerlei Ähnlichkeit mit den Zeitreise-Szenarios, denen er dort begegnet war. Es gab keine Maschine, keinen Wissenschaftler, ob verrückt oder nicht, und im Gegensatz zu den Romangestalten hatte sich sein Körper verjüngt. Es war, als hätte einzig und allein sein Bewusstsein die Jahre übersprungen und das frühere Bewusstsein ausgelöscht, um sich im Gehirn seines eigenen achtzehnjährigen Selbst einzunisten.
War er also dem Tod entronnen? Oder war er ihm nur ausgewichen? Befand sich sein lebloser Körper in einer New Yorker Leichenhalle und wurde vom Skalpell eines Pathologen aufgeschlitzt und seziert? Oder lag er im Koma: hoffnungslos in ein imaginäres neues Leben verstrickt, auf Geheiß eines verwüsteten, sterbenden Gehirns. Und dennoch, dennoch ...
»Süßer?«, fragte die Bedienung. »Soll ich nun nachschenken oder nicht?«
»Ich ... äh ... ich glaube, ich trinke stattdessen lieber eine Tasse Kaffee, wenn das möglich ist.«
»Aber klar doch. Einen Irish Coffee vielleicht?«
»Nein, einen gewöhnlichen Kaffee. Etwas Sahne, ohne Zucker.«
Das Mädchen aus der Vergangenheit brachte den Kaffee, und Jeff blickte auf die verstreuten Lichter der halb erbauten Stadt hinaus, die unter dem verblassenden Himmel angingen. Die Sonne war hinter den roten Lehmhügeln verschwunden, die sich bis nach Alabama erstreckten, in Richtung Zukunft, in Richtung umfassender, chaotischer Veränderungen, Tragödien und Träume.
Er verbrannte sich am dampfenden Kaffee die Lippen und kühlte sie mit einem Schluck Eiswasser. Die Welt jenseits der Fenster war kein Traum – sie war ebenso konkret wie unschuldig, ebenso wirklich wie blind optimistisch.
Frühling 1963.
Und es gab so viele Möglichkeiten.