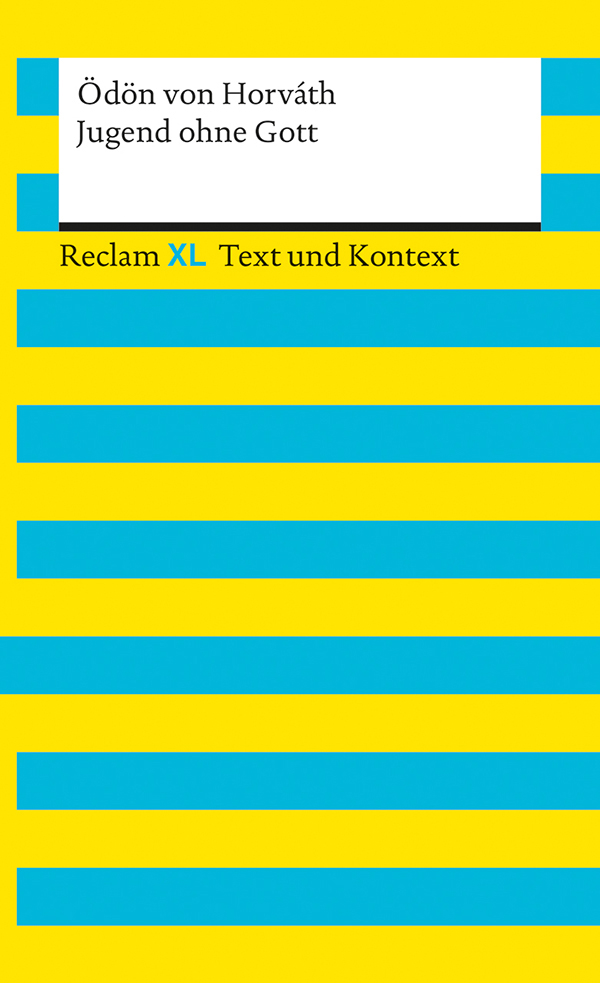
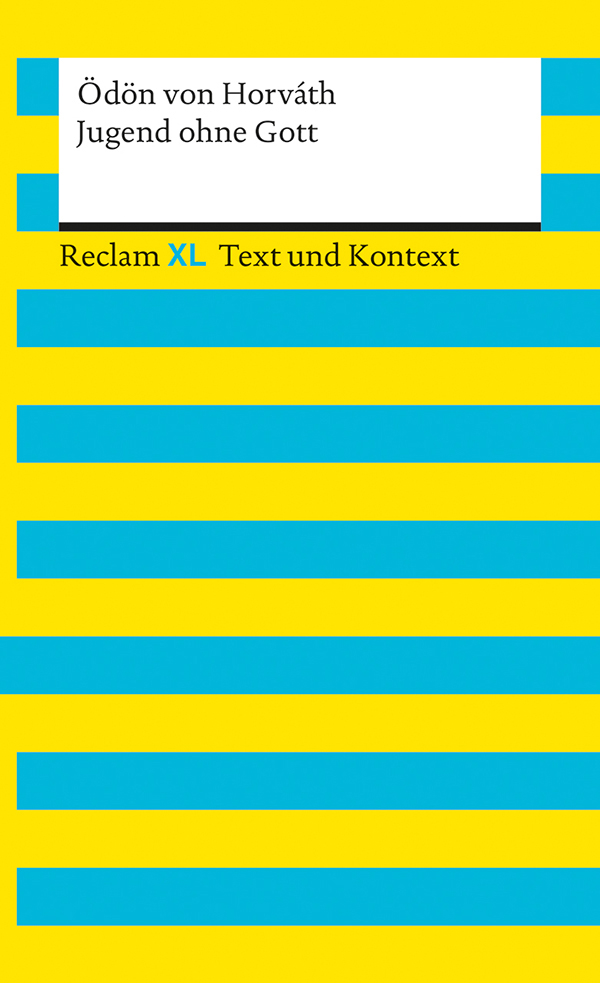
Die E-Books des Reclam Verlags verwenden entsprechend der jeweiligen Buchausgabe Sperrungen zur Hervorhebung von Textpassagen. Diese Textauszeichnung wird nicht von allen Readern unterstützt.
Enthält das E-Book in eckigen Klammern beigefügte Seitenzählungen, so verweisen diese auf die Printausgabe des Werkes.
Roman
25. März.
Auf meinem Tische stehen Blumen. Lieblich. Ein Geschenk meiner braven Hausfrau, denn heute ist mein Geburtstag.
Aber ich brauche den Tisch und rücke die Blumen beiseite und auch den Brief meiner alten Eltern. Meine Mutter schrieb: »Zu Deinem vierunddreißigsten Geburtstage wünsche ich Dir, mein liebes Kind, das Allerbeste. Gott der Allmächtige gebe Dir Gesundheit, Glück und Zufriedenheit!« Und mein Vater schrieb: »Zu Deinem vierunddreißigsten Geburtstage, mein lieber Sohn, wünsche ich Dir alles Gute. Gott der Allmächtige gebe Dir Glück, Zufriedenheit und Gesundheit!«
Glück kann man immer brauchen, denke ich mir, und gesund bist Du auch, gottlob! Ich klopfe auf Holz. Aber zufrieden? Nein, zufrieden bin ich eigentlich nicht. Doch das ist ja schließlich niemand.
Ich setze mich an den Tisch, entkorke eine rote Tinte, mach mir dabei die Finger tintig und ärgere mich darüber. Man sollt endlich mal eine Tinte erfinden, mit der man sich unmöglich tintig machen kann!
Nein, zufrieden bin ich wahrlich nicht.
Denk nicht so dumm, herrsch ich mich an. Du hast doch eine sichere Stellung mit Pensionsberechtigung und das ist in der heutigen Zeit, wo niemand weiß, ob sich morgen die Erde noch drehen wird, allerhand! Wie viele würden sich sämtliche Finger ablecken, wenn sie an Deiner Stelle wären?! Wie gering ist doch der Prozentsatz der Lehramtskandidaten, die wirklich Lehrer werden können! Danke Gott, dass Du zum Unterrichtskörper eines Städtischen Gymnasiums gehörst und dass Du also ohne wirtschaftliche Sorgen alt und blöd werden darfst! Du kannst doch auch hundert Jahre alt werden, vielleicht wirst Du sogar mal der älteste Einwohner des Vaterlandes! Dann kommst Du an Deinem Geburtstag in die Illustrierte und darunter wird stehen: »Er ist noch bei regem Geiste.« Und das alles mit Pension! Bedenk und versündig Dich nicht!
Ich versündige mich nicht und beginne zu arbeiten.
Sechsundzwanzig blaue Hefte liegen neben mir, sechsundzwanzig Buben, so um das vierzehnte Jahr herum, hatten gestern in der Geographiestunde einen Aufsatz zu schreiben, ich unterrichte nämlich Geschichte und Geographie.
Draußen scheint noch die Sonne, fein muss es sein im Park! Doch Beruf ist Pflicht, ich korrigiere die Hefte und schreibe in mein Büchlein hinein, wer etwas taugt oder nicht.
Das von der Aufsichtsbehörde vorgeschriebene Thema der Aufsätze lautet: »Warum müssen wir Kolonien haben?« Ja, warum? Nun, lasset uns hören!
Der erste Schüler beginnt mit einem B: er heißt Bauer, mit dem Vornamen Franz. In dieser Klasse gibt’s keinen, der mit A beginnt, dafür haben wir aber gleich fünf mit B. Eine Seltenheit, so viele B’s bei insgesamt sechsundzwanzig Schülern! Aber zwei B’s sind Zwillinge, daher das Ungewöhnliche. Automatisch überfliege ich die Namensliste in meinem Büchlein und stelle fest, dass B nur von S fast erreicht wird – stimmt, vier beginnen mit S, drei mit M, je zwei mit E, G, L und R, je einer mit F, H, N, T, W, Z, während keiner mit A, C, D, I, O, P, Q, U, V, X, Y beginnt.
Nun, Franz Bauer, warum brauchen wir Kolonien?
»Wir brauchen die Kolonien«, schreibt er, »weil wir zahlreiche Rohstoffe benötigen, denn ohne Rohstoffe könnten wir unsere hochstehende Industrie nicht ihrem innersten Wesen und Werte nach beschäftigen, was zur unleidlichen Folge hätte, dass der heimische Arbeitsmann wieder arbeitslos werden würde.« Sehr richtig, lieber Bauer! »Es dreht sich zwar nicht um die Arbeiter« – sondern, Bauer? – »es dreht sich vielmehr um das Volksganze, denn auch der Arbeiter gehört letzten Endes zum Volk.«
Das ist ohne Zweifel letzten Endes eine großartige Entdeckung, geht es mir durch den Sinn und plötzlich fällt es mir wieder auf, wie häufig in unserer Zeit uralte Weisheiten als erstmalig formulierte Schlagworte serviert werden. Oder war das immer schon so?
Ich weiß es nicht.
Jetzt weiß ich nur, dass ich wiedermal sechsundzwanzig Aufsätze durchlesen muss, Aufsätze, die mit schiefen Voraussetzungen falsche Schlussfolgerungen ziehen. Wie schön wär’s, wenn sich »schief« und »falsch« aufheben würden, aber sie tun’s nicht. Sie wandeln Arm in Arm daher und singen hohle Phrasen.
Ich werde mich hüten als städtischer Beamter, an diesem lieblichen Gesange auch nur die leiseste Kritik zu üben! Wenn’s auch weh tut, was vermag der Einzelne gegen alle? Er kann sich nur heimlich ärgern. Und ich will mich nicht mehr ärgern!
Korrigier rasch, Du willst noch ins Kino!
Was schreibt denn da der N?
»Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul« – Zu dumm! Also das streich ich durch!
Und ich will schon mit roter Tinte an den Rand schreiben: »Sinnlose Verallgemeinerung!« – da stocke ich. Aufgepasst, habe ich denn diesen Satz über die Neger in letzter Zeit nicht schon mal gehört? Wo denn nur? Richtig: er tönte aus dem Lautsprecher im Restaurant und verdarb mir fast den Appetit.
Ich lasse den Satz also stehen, denn was einer im Radio redet, darf kein Lehrer im Schulheft streichen.
Und während ich weiterlese, höre ich immer das Radio: es lispelt, es heult, es bellt, es girrt, es droht – und die Zeitungen drucken es nach und die Kindlein, sie schreiben es ab.
Nun hab ich den Buchstaben T verlassen und schon kommt Z. Wo bleibt W? Habe ich das Heft verlegt? Nein, der W war ja gestern krank – er hatte sich am Sonntag im Stadion eine Lungenentzündung geholt, stimmt, der Vater hat’s mir ja schriftlich korrekt mitgeteilt. Armer W! Warum gehst Du auch ins Stadion, wenn’s eisig in Strömen regnet?
Diese Frage könntest Du eigentlich auch an Dich selbst stellen, fällt es mir ein, denn Du warst ja am Sonntag ebenfalls im Stadion und harrtest treu bis zum Schlusspfiff aus, obwohl der Fußball, den die beiden Mannschaften boten, keineswegs hochklassig war. Ja, das Spiel war sogar ausgesprochen langweilig – also: warum bliebst Du? Und mit Dir dreißigtausend zahlende Zuschauer?
Warum?
Wenn der Rechtsaußen den linken Half überspielt und zentert, wenn der Mittelstürmer den Ball in den leeren Raum vorlegt und der Tormann sich wirft, wenn der Halblinke seine Verteidigung entlastet und ein Flügelspiel forciert, wenn der Verteidiger auf der Torlinie rettet, wenn einer unfair rempelt oder eine ritterliche Geste verübt, wenn der Schiedsrichter gut ist oder schwach, parteiisch oder parteilos, dann existiert für den Zuschauer nichts auf der Welt, außer dem Fußball, ob die Sonne scheint, ob’s regnet oder schneit. Dann hat er alles vergessen.
Was »alles«?
Ich muss lächeln: die Neger, wahrscheinlich – –
Als ich am nächsten Morgen in das Gymnasium kam und die Treppe zum Lehrerzimmer emporstieg, hörte ich auf dem zweiten Stock einen wüsten Lärm. Ich eilte empor und sah, dass fünf Jungen, und zwar E, G, R, H, T, einen verprügelten, nämlich den F.
»Was fällt Euch denn ein?« schrie ich sie an. »Wenn Ihr schon glaubt, noch raufen zu müssen, wie die Volksschüler, dann rauft doch gefälligst einer gegen einen, aber fünf gegen einen, also das ist eine Feigheit!«
Sie sahen mich verständnislos an, auch der F, über den die fünf hergefallen waren. Sein Kragen war zerrissen.
»Was hat er Euch denn getan?« fragte ich weiter, doch die Helden wollten nicht recht heraus mit der Sprache und auch der Verprügelte nicht. Erst allmählich brachte ich es heraus, dass der F den fünfen nichts angetan hatte, sondern im Gegenteil: die fünf hatten ihm seine Buttersemmel gestohlen, nicht, um sie zu essen, sondern nur, damit er keine hat. Sie haben die Semmel durch das Fenster auf den Hof geschmissen.
Ich schaue hinab. Dort liegt sie auf dem grauen Stein. Es regnet noch immer und die Semmel leuchtet hell herauf.
Und ich denke: vielleicht haben die fünf keine Semmeln und es ärgerte sie, dass der F eine hatte. Doch nein, sie hatten alle ihre Semmeln und der G sogar zwei. Und ich frage nochmals: »Warum habt Ihr das also getan?«
Sie wissen es selber nicht. Sie stehen vor mir und grinsen verlegen. Ja, der Mensch dürfte wohl böse sein und das steht auch schon in der Bibel. Als es aufhörte zu regnen und die Wasser der Sündflut wieder wichen, sagte Gott: »Ich will hinfort nicht mehr die Erde strafen um der Menschen willen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.«
Hat Gott sein Versprechen gehalten? Ich weiß es noch nicht. Aber ich frage nun nicht mehr, warum sie die Semmel auf den Hof geworfen haben. Ich erkundige mich nur, ob sie es noch nie gehört hätten, dass sich seit Urzeiten her, seit tausend und tausend Jahren, seit dem Beginn der menschlichen Gesittung, immer stärker und stärker ein ungeschriebenes Gesetz herausgebildet hat, ein schönes, männliches Gesetz: Wenn Ihr schon rauft, dann raufe nur einer gegen einen! Bleibet immer ritterlich! Und ich wende mich wieder an die fünf und frage: »Schämt Ihr Euch denn nicht?«
Sie schämen sich nicht. Ich rede eine andere Sprache. Sie sehen mich groß an, nur der Verprügelte lächelt. Er lacht mich aus.
»Schließt das Fenster«, sage ich, »sonst regnet’s noch herein!«
Sie schließen es.
Was wird das für eine Generation? Eine harte oder nur eine rohe?
Ich sage kein Wort mehr und gehe ins Lehrerzimmer. Auf der Treppe bleibe ich stehen und lausche: ob sie wohl wieder raufen? Nein, es ist still. Sie wundern sich.
Von 10–11 hatte ich Geographie. In dieser Stunde musste ich die gestern korrigierte Schulaufgabe betreffs der kolonialen Frage drannehmen. Wie bereits erwähnt, hatte man gegen den Inhalt der Aufsätze vorschriftsgemäß nichts einzuwenden.
Ich sprach also, während ich nun die Hefte an die Schüler verteilte, lediglich über Sprachgefühl, Orthographie und Formalitäten. So sagte ich dem einen B, er möge nicht immer über den linken Rand hinaus schreiben, dem R, die Absätze müssten größer sein, dem Z, man schreibt Kolonien mit e und nicht Kolonihn mit h. Nur als ich dem N sein Heft zurückgab, konnte ich mich nicht zurückhalten: »Du schreibst«, sagte ich, »dass wir Weißen kulturell und zivilisatorisch über den Negern stehen, und das dürfte auch stimmen. Aber Du darfst doch nicht schreiben, dass es auf die Neger nicht ankommt, ob sie nämlich leben könnten oder nicht. Auch die Neger sind doch Menschen.«
Er sah mich einen Augenblick starr an und dann glitt ein unangenehmer Zug über sein Gesicht. Oder hatte ich mich getäuscht? Er nahm sein Heft mit der guten Note, verbeugte sich korrekt und nahm wieder Platz in seiner Bank.
Bald sollte ich es erfahren, dass ich mich nicht getäuscht hatte.
Bereits am nächsten Tage erschien der Vater des N in meiner Sprechstunde, die ich wöchentlich einmal abhalten musste, um mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Sie erkundigten sich über die Fortschritte ihrer Kinder und holten sich Auskunft über allerhand, meist recht belanglose, Erziehungsprobleme. Es waren brave Bürger, Beamte, Offiziere, Kaufleute. Arbeiter war keiner darunter.
Bei manchem Vater hatte ich das Gefühl, dass er über den Inhalt der diversen Schulaufsätze seines Sprösslings ähnlich denkt wie ich. Aber wir sahen uns nur an, lächelten und sprachen über das Wetter. Die meisten Väter waren älter als ich, einer war sogar ein richtiger Greis. Der jüngste ist knapp vor zwei Wochen achtundzwanzig geworden. Er hatte mit siebzehn Jahren die Tochter eines Industriellen verführt, ein eleganter Mensch. Wenn er zu mir kommt, fährt er immer in seinem Sportwagen vor. Die Frau bleibt unten sitzen und ich kann sie von droben sehen. Ihren Hut, ihre Arme, ihre Beine. Sonst nichts. Aber sie gefällt mir. Du könntest auch schon einen Sohn haben, denke ich dann, aber ich kann mich beherrschen, ein Kind in die Welt zu setzen. Nur damit’s in irgendeinem Krieg erschossen wird!
Nun stand der Vater des N vor mir. Er hatte einen selbstsicheren Gang und sah mir aufrecht in die Augen. »Ich bin der Vater des Otto N.« »Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr N«, antwortete ich, verbeugte mich, wie es sich gehört, bot ihm Platz an, doch er setzte sich nicht. »Herr Lehrer«, begann er, »mein Hiersein hat den Grund in einer überaus ernsten Angelegenheit, die wohl noch schwerwiegende Folgen haben dürfte. Mein Sohn Otto teilte mir gestern Nachmittag in heller Empörung mit, dass Sie, Herr Lehrer, eine schier unerhörte Bemerkung fallen gelassen hätten –«
»Ich?«
»Jawohl, Sie!«
»Wann?«
»Anlässlich der gestrigen Geographiestunde. Die Schüler schrieben einen Aufsatz über Kolonialprobleme und da sagten Sie zu meinem Otto: Auch die Neger sind Menschen. Sie wissen wohl, was ich meine?«
»Nein.«
Ich wusste es wirklich nicht. Er sah mich prüfend an. Gott, muss der dumm sein, dachte ich.
»Mein Hiersein«, begann er wieder langsam und betont, »hat seinen Grund in der Tatsache, dass ich seit frühester Jugend nach Gerechtigkeit strebe. Ich frage Sie also: ist jene ominöse Äußerung über die Neger Ihrerseits in dieser Form und in diesem Zusammenhange tatsächlich gefallen oder nicht?«
»Ja«, sagte ich und musste lächeln: »Ihr Hiersein wäre also nicht umsonst –«
»Bedauere bitte«, unterbrach er mich schroff, »ich bin zu Scherzen nicht aufgelegt! Sie sind sich wohl noch nicht im Klaren darüber, was eine derartige Äusserung über die Neger bedeutet?! Das ist Sabotage am Vaterland! Oh, mir machen Sie nichts vor! Ich weiß es nur zu gut, auf welch heimlichen Wegen und mit welch perfiden Schlichen das Gift Ihrer Humanitätsduselei unschuldige Kinderseelen zu unterhöhlen trachtet!«
Nun wurd’s mir aber zu bunt!
»Erlauben Sie«, brauste ich auf, »das steht doch bereits in der Bibel, dass alle Menschen Menschen sind!«
»Als die Bibel geschrieben wurde, gab’s noch keine Kolonien in unserem Sinne«, dozierte felsenfest der Bäckermeister. »Eine Bibel muss man in übertragenem Sinn verstehen, bildlich oder gar nicht! Herr, glauben Sie denn, dass Adam und Eva leibhaftig gelebt haben oder nur bildlich?! Na also! Sie werden sich nicht auf den lieben Gott hinausreden, dafür werde ich sorgen!«
»Sie werden für gar nichts sorgen«, sagte ich und komplimentierte ihn hinaus. Es war ein Hinauswurf. »Bei Philippi sehen wir uns wieder!« rief er mir noch zu und verschwand.
Zwei Tage später stand ich bei Philippi.
Der Direktor hatte mich rufen lassen. »Hören Sie«, sagte er, »es kam hier ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde. Ein gewisser Bäckermeister N hat sich über Sie beschwert, Sie sollen da so Äußerungen fallen gelassen haben – Nun, ich kenne das und weiß, wie solche Beschwerden zustande kommen, mir müssen Sie nichts erklären! Doch, lieber Kollege, ist es meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich derlei nicht wiederholt. Sie vergessen das geheime Rundschreiben 5679 u/33! Wir müssen von der Jugend alles fernhalten, was nur in irgendeiner Weise ihre zukünftigen militärischen Fähigkeiten beeinträchtigen könnte – das heißt: wir müssen sie moralisch zum Krieg erziehen. Punkt!«
Ich sah den Direktor an, er lächelte und erriet meine Gedanken. Dann erhob er sich und ging hin und her. Er ist ein schöner alter Mann, dachte ich.
»Sie wundern sich«, sagte er plötzlich, »dass ich die Kriegsposaune blase, und Sie wundern sich mit Recht! Sie denken jetzt, siehe welch ein Mensch! Vor wenigen Jahren noch unterschrieb er flammende Friedensbotschaften, und heute? Heut rüstet er zur Schlacht!«
»Ich weiß es, dass Sie es nur gezwungen tun«, suchte ich ihn zu beruhigen.
Er horchte auf, blieb vor mir stehen und sah mich aufmerksam an. »Junger Mann«, sagte er ernst, »merken Sie sich eines: es gibt keinen Zwang. Ich könnte ja dem Zeitgeist widersprechen und mich von einem Herrn Bäckermeister einsperren lassen, ich könnte ja hier gehen, aber ich will nicht gehen, jawohl, ich will nicht! Denn ich möchte die Altersgrenze erreichen, um die volle Pension beziehen zu können.«
Das ist ja recht fein, dachte ich.
»Sie halten mich für einen Zyniker«, fuhr er fort und sah mich nun schon ganz väterlich an. »Oh, nein! Wir alle, die wir zu höheren Ufern der Menschheit strebten, haben eines vergessen: die Zeit! Die Zeit, in der wir leben. Lieber Kollege, wer so viel gesehen hat wie ich, der erfasst allmählich das Wesen der Dinge.«
Du hast leicht reden, dachte ich wieder, Du hast ja noch die schöne Vorkriegszeit miterlebt. Aber ich? Ich hab erst im letzten Kriegsjahr zum ersten Mal geliebt und frage nicht, was.
»Wir leben in einer plebejischen Welt«, nickte er mir traurig zu. »Denken Sie nur an das alte Rom, 287 vor Christi Geburt. Der Kampf zwischen den Patriziern und Plebejern war noch nicht entschieden, aber die Plebejer hatten bereits wichtigste Staatsposten besetzt.«
»Erlauben Sie, Herr Direktor«, wagte ich einzuwenden, »soviel ich weiß, regieren bei uns doch keine armen Plebejer, sondern es regiert einzig und allein das Geld.«
Er sah mich wieder groß an und lächelte versteckt: »Das stimmt. Aber ich werde Ihnen jetzt gleich ein Ungenügend in Geschichte geben, Herr Geschichtsprofessor! Sie vergessen ja ganz, dass es auch reiche Plebejer gab. Erinnern Sie sich?«
Ich erinnerte mich. Natürlich! Die reichen Plebejer verließen das Volk und bildeten mit den bereits etwas dekadenten Patriziern den neuen Amtsadel, die sogenannten Optimates.
»Vergessen Sie’s nur nicht wieder!«
»Nein.«
Als ich zur nächsten Stunde die Klasse, in der ich mir erlaubte, etwas über die Neger zu sagen, betrete, fühle ich sogleich, dass etwas nicht in Ordnung ist. Haben die Herren meinen Stuhl mit Tinte beschmiert? Nein. Warum schauen sie mich nur so schadenfroh an?
Da hebt einer die Hand. Was gibt’s? Er kommt zu mir, verbeugt sich leicht, überreicht mir einen Brief und setzt sich wieder.
Was soll das?
Ich erbreche den Brief, überfliege ihn, möchte hochfahren, beherrsche mich jedoch und tue, als würde ich ihn genau lesen. Ja, alle haben ihn unterschrieben, alle fünfundzwanzig, der W ist noch immer krank.
»Wir wünschen nicht mehr«, steht in dem Brief, »von Ihnen unterrichtet zu werden, denn nach dem Vorgefallenen haben wir Endesunterzeichneten kein Vertrauen mehr zu Ihnen und bitten um eine andere Lehrkraft.«
Ich blicke die Endesunterzeichneten an, einen nach dem anderen. Sie schweigen und sehen mich nicht an. Ich unterdrücke meine Erregung und frage, wie so nebenbei: »Wer hat das geschrieben?«
Keiner meldet sich.
»So seid doch nicht so feig!«
Sie rühren sich nicht.
»Schön«, sage ich und erhebe mich, »es interessiert mich auch nicht mehr, wer das geschrieben hat, Ihr habt Euch ja alle unterzeichnet – Gut, auch ich habe nicht die geringste Lust, eine Klasse zu unterrichten, die zu mir kein Vertrauen hat. Doch glaubt mir, ich wollte nach bestem Gewissen« – ich stocke, denn ich bemerke plötzlich, dass einer unter der Bank schreibt.
»Was schreibst Du dort?«
Er will es verstecken.
»Gib’s her!«
Ich nehme es ihm weg und er lächelt höhnisch. Es ist ein Blatt Papier, auf dem er jedes meiner Worte mitstenografierte.
»Ach, Ihr wollt mich bespitzeln?«
Sie grinsen.
Grinst nur, ich verachte Euch. Hier hab ich, bei Gott, nichts mehr verloren. Soll sich ein anderer mit Euch raufen!
Ich gehe zum Direktor, teile ihm das Vorgefallene mit und bitte um eine andere Klasse. Er lächelt: »Meinen Sie, die anderen sind besser?« Dann begleitet er mich in die Klasse zurück. Er tobt, er schreit, er beschimpft sie – ein herrlicher Schauspieler! Eine Frechheit wär’s, brüllt er, eine Niedertracht, und die Lümmel hätten kein Recht, einen anderen Lehrer zu fordern, was ihnen einfiele, ob sie denn verrückt geworden seien, usw.! Dann lässt er mich wieder allein zurück.
Da sitzen sie nun vor mir. Sie hassen mich. Sie möchten mich ruinieren, meine Existenz und alles, nur weil sie es nicht vertragen können, dass ein Neger auch ein Mensch ist. Ihr seid keine Menschen, nein!
Aber wartet nur, Freunde! Ich werde mir wegen Euch keine Disziplinarstrafe zuziehen, geschweige denn mein Brot verlieren – nichts zum Fressen soll ich haben, was? Keine Kleider, keine Schuhe? Kein Dach? Würd Euch so passen! Nein, ich werde Euch von nun ab nur mehr erzählen, dass es keine Menschen gibt, außer Euch, ich will es Euch so lange erzählen, bis Euch die Neger rösten! Ihr wollt es ja nicht anders!
An diesem Abend wollt ich nicht schlafen gehen. Immer sah ich das Stenogramm vor mir – ja, sie wollen mich vernichten.
Wenn sie Indianer wären, würden sie mich an den Marterpfahl binden und skalpieren, und zwar mit dem besten Gewissen.
Sie sind überzeugt, sie hätten recht.
Es ist eine schreckliche Bande!
Oder versteh ich sie nicht? Bin ich denn mit meinen vierunddreißig Jahren bereits zu alt? Ist die Kluft zwischen uns tiefer als sonst zwischen Generationen?
Heut glaube ich, sie ist unüberbrückbar.
Dass diese Burschen alles ablehnen, was mir heilig ist, wär zwar noch nicht so schlimm. Schlimmer ist schon, wie sie es ablehnen, nämlich: ohne es zu kennen. Aber das Schlimmste ist, dass sie es überhaupt nicht kennenlernen wollen!
Alles Denken ist ihnen verhasst.
Sie pfeifen auf den Menschen! Sie wollen Maschinen sein, Schrauben, Räder, Kolben, Riemen – doch noch lieber als Maschinen wären sie Munition: Bomben, Schrapnells, Granaten. Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld! Der Name auf einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät.
Doch halt! Ist es nicht eine große Tugend, diese Bereitschaft zum höchsten Opfer?
Gewiss, wenn es um eine gerechte Sache geht –
Um was geht es hier?
»Recht ist, was der eigenen Sippschaft frommt«, sagt das Radio. Was uns nicht gut tut, ist Unrecht. Also ist alles erlaubt, Mord, Raub, Brandstiftung, Meineid – ja, es ist nicht nur erlaubt, sondern es gibt überhaupt keine Untaten, wenn sie im Interesse der Sippschaft begangen werden! Was ist das?
Der Standpunkt des Verbrechers.
Als die reichen Plebejer im alten Rom fürchteten, dass das Volk seine Forderung, die Steuern zu erleichtern, durchdrücken könnte, zogen sie sich in den Turm der Diktatur zurück. Und sie verurteilten den Patrizier Manlius Capitolinus, der mit seinem Vermögen plebejische Schuldner aus der Schuldhaft befreien wollte, als Hochverräter zum Tode und stürzten ihn vom Tarpejischen Felsen hinab.
Seit es eine menschliche Gesellschaft gibt, kann sie aus Selbsterhaltungsgründen auf das Verbrechen nicht verzichten. Aber die Verbrechen wurden verschwiegen, vertuscht, man hat sich ihrer geschämt.
Heute ist man stolz auf sie.
Es ist eine Pest.
Wir sind alle verseucht, Freund und Feind. Unsere Seelen sind voller schwarzer Beulen, bald werden sie sterben. Dann leben wir weiter und sind doch tot.
Auch meine Seele ist schon schwach. Wenn ich in der Zeitung lese, dass einer von denen umgekommen ist, denke ich: »Zu wenig! Zu wenig!«
Habe ich nicht auch heute gedacht: »Geht alle drauf?«
Nein, jetzt will ich nicht weiterdenken! Jetzt wasche ich meine Hände und geh ins Café. Dort sitzt immer wer, mit dem man Schach spielen kann! Nur hinaus jetzt aus meinem Zimmer! Luft! –
Die Blumen, die ich von meiner Hausfrau zum Geburtstag bekam, sind verwelkt. Sie kommen auf den Mist.
Morgen ist Sonntag.
In dem Café sitzt keiner, den ich kenne. Niemand.
Was tun?
Ich geh ins Kino.
In der Wochenschau seh ich die reichen Plebejer. Sie enthüllen ihre eigenen Denkmäler, machen die ersten Spatenstiche und nehmen die Paraden ihrer Leibgarden ab. Dann folgt ein Mäuslein, das die größten Katzen besiegt, und dann eine spannende Kriminalgeschichte, in der viel geschossen wird, damit das gute Prinzip triumphieren möge.
Als ich das Kino verlasse, ist es Nacht.
Aber ich geh nicht nach Haus. Ich fürchte mich vor meinem Zimmer.
Drüben ist eine Bar, dort werd ich was trinken, wenn sie billig ist.
Sie ist nicht teuer.
Ich trete ein. Ein Fräulein will mir Gesellschaft leisten.
»So ganz allein?« fragt sie.
»Ja«, lächle ich, »leider –«
»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
»Nein.«
Sie zieht sich gekränkt zurück. Ich wollt Ihnen nicht weh tun, Fräulein. Seien Sie mir nicht böse, aber ich bin allein.