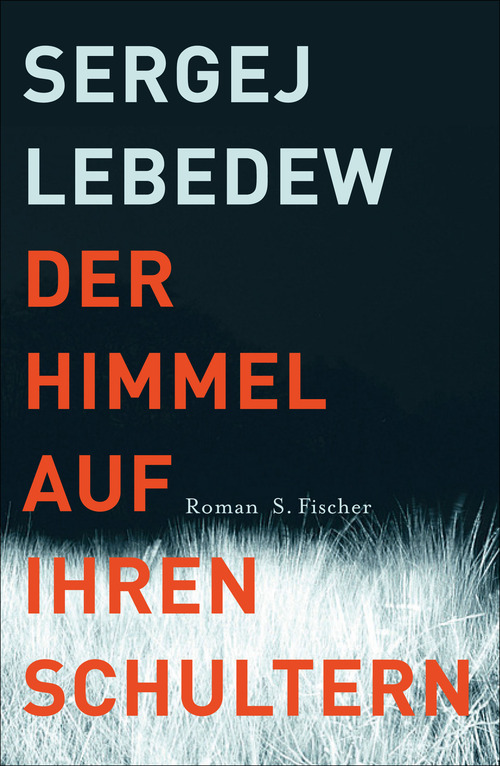
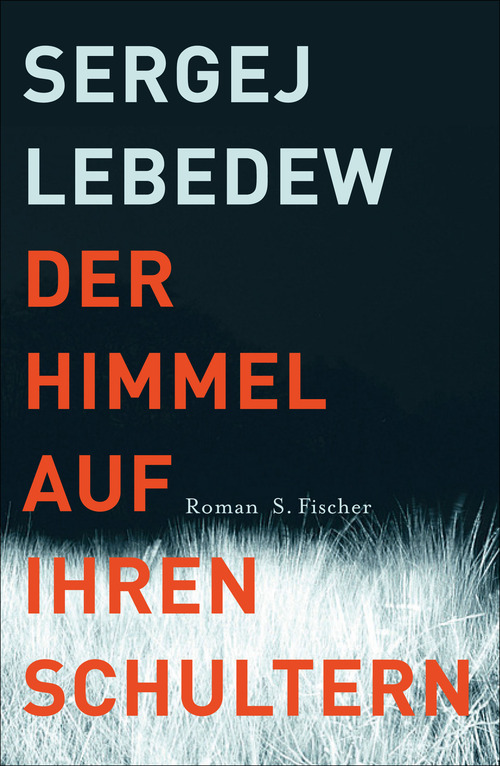
Sergej Lebedew
Der Himmel auf ihren Schultern
Roman
Aus dem Russischen von Franziska Zwerg
Fischer e-books

Sergej Lebedew wurde 1981 in Moskau geboren, zu jung, um den Gulag selbst erfahren zu haben. Umso erstaunlicher ist seine literarische Auseinandersetzung mit diesem Thema. »Der Himmel auf ihren Schultern« ist sein erster Roman und stand auf der Long-List des russischen »Nazbest«-Preises (Nationaler Bestseller) 2011. Zuvor sind in Russland seine Gedichte, Essays und journalistischen Texte erschienen. Lebedew war viele Jahre auf geologischen Expeditionen im Norden Russlands und in Zentralasien unterwegs, bevor er zu schreiben anfing.
Die Übersetzung und Erstellung der Druckvorlage wurde unterstützt von der Föderalen Agentur für Presse und Massenkommunikation im Rahmen des Föderalen Finanzierungsprogramms "Kultur Russlands" (2012-2018)
Die Übersetzerin dankt dem Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen für die Unterstützung
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Предел забвения« bei Pervoe sentjabrja, Moskau
© 2011 by Sergey Lebedew
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Covergestaltung: buxdesign, München und Carla Nagel
Coverabbildung: plainpicture/Arcangel
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402028-0
Kein Bewohner dieser Orte,
kein Verstorbener,
ein Mittelsmann nur …
joseph brodsky
Ich stehe am Rand von Europa. Oberhalb des Ozeans zeigt sich im Steilhang der gelbe Felsknochen und die ocker bis purpurne, fleischartige Erde. Der Knochen bröckelt unter den Wellen, am Erdkörper nagt die Flut.
Der Ozean ist so riesig, dass das Auge ihn nicht fassen kann; er scheint sich dem Betrachter entgegenzuwerfen, als wolle er ihm die Pupillen wie Bullaugen eines Schiffs ausreißen, um sich im Innern zu ergießen und den Verstand zu überfluten. Nur wenige Gedanken würden sich gleich den Vulkanspitzen von Madeira und den Kanarischen Inseln über die Gewässer erheben. Es sind Gedanken über die großartige Anziehungskraft der Leere am Horizont, die überwunden werden will, damit sich wie Atlantis kraft der Imagination ein neuer Kontinent aus den Gewässern erhebt, auf dem alles noch unerforscht ist, ein Land, das weder Kompass noch Kartographenzirkel kennt.
Hier endet Europa. Das Ufer schwindet, als zöge sich der Kontinent zusammen, und ich spüre zum ersten Mal, dass die Weltinsel keine Erfindung von englisch-romantischen Geopolitikern des vergangenen Jahrhunderts ist. Ich fühle ihre Grenze, die sich mit der Uferlinie deckt.
Ich bin aus Taiga und Tundra hierhergekommen, um die Felsen von Gibraltar zu sehen und die Welt kennenzulernen, die Atlas wie auch das düstere Firmament meiner Heimat trägt. Für jemanden, der in Russland geboren wurde, ist hier immer noch das Ende der bewohnbaren Welt, der Oikumene, wie die alten Griechen meinten.
Das Ufer bedeutet eine Herausforderung: Erst hinter den gesichtslosen Gewässern des Ozeans liegt ein neues, anderes Leben. Das Festland ist Stetigkeit, der Ozean jedoch bedeutet eine Unterbrechung dieser Stetigkeit, er verlangt nach geistiger Anstrengung und einem hehren Ziel, um dessentwillen man sich von der gewohnten Festigkeit der Erde lossagt und das schwankende Deck betritt.
Ich stehe auf einer Grenzlinie, von hier aus kann man nur dann voranschreiten, wenn man sie leichten und freien Herzens betreten hat. Aber ich bin erfüllt von der Erinnerung an eine Landschaft, die sich zum Polarkreis hin erstreckt, mit ihrer Stummheit, die es nach Wörtern dürstet, vom Weiß des gleißend hellen Schnees – dem Weiß eines unberührten Blatt Papiers – und vom Schwarz der glänzenden Kohle, die sich in Flammenhitze verwandeln will – dem Schwarz der Nacht, dem Schwarz des Schachts, wo die Luft weder Menschenatem noch Morgenlicht kennt.
Darum liegt für mich an dieser Grenzlinie der Welt mein Ziel nicht vor, sondern hinter mir: Ich muss zurückkehren. Meine Reise ist beendet, ich muss den Rückweg antreten – im Wort.
Ich fühle – diese Empfindung überkommt mich jäh, auch wenn sie lang gereift ist –, dass ich mehr Europäer bin als die Bewohner des Landes, das zum Atlantik hinausweist wie ein Balkon zur Straße.
Ich war am anderen Ende Europas, das mit steilen Felsenstufen vor den westsibirischen Sümpfen jäh abreißt, und sah die dunklen Hinterhöfe des europäischen Kontinents, seine finno-ugrischen Kemenaten, sein Hinterland. Ich stand an den Polarbergen des Urals, wo sich Europa und Asien begegnen. Am europäischen Hang wachsen nur kleine, durch die Luftströmungen gewundene Polarbirken, am asiatischen Hang hingegen hohe, mächtige Zedern, die mit ihren Wurzeln das Gestein aufreißen. Und im Himmel über den Bergen prallen die Gewitterfronten zweier großer Ebenen aufeinander.
Wo die Lebenskräfte Europas nachlassen und nur für Rentierflechte und Moos reichen, während von der anderen Seite des Gebirgskamms der dichte, asiatische Wald herüberzuquellen droht – ausgerechnet dort fühlte ich mich zum ersten Mal als Europäer. Die Naht zwischen diesen beiden Welten – der Ural – lehrte mich, das Eigene vom Fremden zu unterscheiden, denn auf einer Naht, auf einer Fuge, spitzen sich die Empfindungen zu, kommt es nicht nur zu geistigen, sondern auch physiologischen Erkenntnissen: Mit der Kehle, dem Magen, mit der gesamten Ausdehnung des Darms fühlt man, dass man gerade das fremde Wasser eines asiatischen Flusses getrunken hat, und dieses fremde Wasser mischt sich nicht mit dem, das bereits im Körper war.
Auf diesem Gebirgsrücken wurde mir in Gedanken, im Gespräch oder beim Versuch, etwas aufzuschreiben, klar: Ich hatte eine Sprachgrenze betreten. Auf der asiatischen Seite müsste man einige Anstrengungen aufbringen, um die Dinge zu benennen. Sie scheinen sich einer Bezeichnung zu entziehen. Die eigene Sprache kann sie verwalten, kann ihnen Namen aufzwingen, und sie werden sich fügen. Wer aber ein Gespür dafür hat, ob eine Sprache tot oder lebendig ist, der merkt, dass es sich um linguistische Kolonisierung handelt. Tanne und Kiefer sind für mich Tanne und Kiefer, aber diese Benennungen bleiben ihrem eigentlichen Wesen fremd, das nach einem anders klingenden Wort verlangt und nur darauf harmonisch reagiert.
Die Sprachgrenze. Das Ende der europäischen Welt. Dahinter kommt nur noch die Ebene der sibirischen Sümpfe. Hier erfährt man, was Stummheit wirklich bedeutet. Man kann etwas sagen, aber die Welt gibt einem kein Echo. Und man begreift: Heimat ist die eigene Sprache. Ihre Vorzüge und Unzulänglichkeiten sind auch die eigenen, nicht wegzudenkenden Vorzüge und Unzulänglichkeiten. Außerhalb der eigenen Sprache existiert man nicht.
Ich muss daran denken, wie ich einmal im eisigen Frühjahr in einem Dorf gewesen war: Bauernkaten, auf denen grauer Schnee lastete, hart gewordene Spuren von Filzstiefeln und Kufen auf den Wegen, ein unwilliges Erwachen nach dem Winter – im Haus war die Luft noch trüb von wirren Winterträumen, die nach Kalkofen und Filzstiefeln riechen.
Im Dorf war kurz zuvor die Schule geschlossen worden, es gab zu wenig Schüler. Das Schulgebäude, eine alte Villa, hatte man mit Brettern vernagelt. Die Schule stand auf einem weithin sichtbaren Hügel, und das Dorf lebte schon einige Monate mit dem Blick auf das wie nach einer Kapitulation verlassene, ehemalige Gutshaus.
Hinter dem Lattenzaun der Schule ragte das Denkmal eines Kosmonauten hervor, als sei dieser hier gelandet und wegen seiner Unbrauchbarkeit im Haushalt auf einen Sockel gestellt und mit der silbernen Farbe eines Raumfahrtanzugs angestrichen worden. Ungeachtet der Kälte, die alle Ausdünstungen abtötete, roch es im Schulgebäude nach feuchten Tapeten und Mäusen. Am Ofen im Flur saß auf einem Hocker der Hausmeister – ein Mensch aus Filzstiefeln, Wattehosen, einer Steppjacke und einer Ohrenmütze. Die Dielenbretter knarzten, und es schien, als sei es Kreide, die über eine ausgewischte Tafel knarzt. Durch die Schlüssellöcher konnte man Bänke und Stühle erkennen – unförmig und schwer, genauso wie Schulranzen. Auf einer der Bänke lag ein Lineal, als habe die Lehrerin es liegenlassen und käme gleich zurück.
Der Hausmeister saß am Ofen. An der Wand stapelten sich zerlesene, vollgekritzelte Schulbücher, die durch viele Schülerhände gegangen waren – »Heimatsprache«, vierte Klasse. Der Hausmeister nahm ein Buch nach dem anderen, riss den Umschlag in Stücke, zerknüllte die Seiten, damit sie besser Feuer fingen, und warf sie in den Ofen. »Die Schule wurde geschlossen«, sagte er. »Brennholz bekommen wir nicht. Nun heizen wir so, die Leitungen dürfen nicht einfrieren. Die Bibliothek ist groß, bis April reicht es.«
Der Ofen der geschlossenen Schule wurde mit der russischen Sprache geheizt. Wie sehr hatten wir in unserer Kindheit diese Bücher gehasst, diese »Fragen zum Text«, die hervorgehobenen Absätze »Überprüfe dich selbst«, die vergrößerte, sanfte Schrift, die so rund war wie die Ecken an den Schulbänken, damit die Kinder sich nicht an ihnen verletzten. Und nun hätte ich am liebsten geheult, denn all das hatte keine Bedeutung mehr, so wie eine Kränkung gegenüber wahrhaftigem Leid bedeutungslos wird.
In diesem Wolgadorf inmitten der von jungen Birken bewachsenen Felder begriff ich, welche Bedeutung für einen Menschen – ohne jegliche Schulmeisterlichkeit und Anführungszeichen – seine Heimatsprache hat.
Birken, Schnee, Brennholz, Himmel, Wege, Feuer, Rauch, Frost – ich wiederholte für mich diese Wörter, an die ich mich fast so lang erinnerte wie an mich selbst. Birken, Schnee, Brennholz, Himmel, Wege, Feuer, Rauch, Frost – die Wörter wuchsen, sie waren Materie, so wie Energie Materie ist. Sie klangen symphonisch, eines durch das andere hindurch, aber ohne sich zu vermischen. Der Frost war frostig, das Feuer feurig, der Rauch rauchig. Das war meine Empfindung damals in diesem verschneiten Dorf, wo die Bücherasche das weiße Dach der Schule mit Flecken überzog – die Schulbücher brannten rauchstark, und die Asche war metallisch und fettig von der zähflüssigen Druckerfarbe.
Ich begriff, dass die russische Sprache meine Heimat ist. Diejenigen, die sie bevölkern, sind meine Mitbürger. Worüber ich nun schreibe, dazu gibt mir nicht die Erinnerung das Recht, sondern die Sprache. Die Sprache lebt von dem, was durch sie gesagt werden muss.
An diesem Rand von Europa sehe ich Menschen am Strand, die so schön sind wie die Nereiden oder Dryaden der griechischen Mythologie, in denen der Mensch mit einem Tier oder einer Pflanze zu einem unsterblichen Wesen vereinigt ist. In der rein menschlichen Schönheit liegt Verletzlichkeit und ein Vorgefühl des Sterbens, die ihre Individualität ausmachen. Aber die Schönheit einer Pflanze oder eines Tiers hat nichts Tragisches, bei ihnen wird das Individuelle durch ihre Gattung ersetzt. Auch die Badenden am Strand sind Delphinen oder Orchideen ähnlich: Bewegung, Erblühen, Ruhe, Schlummer, Innehalten. Doch kaum geht die Sonne unter, sind sie fort und werden nie erfahren, dass der Strand in der Abenddämmerung allzu sehr dem Staub von Pompeji ähnelt – die Flut glättet den abgekühlten Sand und tilgt die Abdrücke von Schenkeln, Ellbogen, Fersen.
Ich sehe Golfspieler, die endlos die Lektion der kartesischen Geometrie wiederholen, die Lektion der Artikulation des Raums, sein Einfangen in das Netz der Koordinaten. Ich stelle sie mir inmitten der Tundra mit Ball und Golfschlägern vor – sie müssten vor Erstaunen erstarren. Hier gibt es so viel Raum, dass nicht einmal ihre Vorstellung ihn beherrschen kann. Sie lassen ab von ihrem Spiel, zerstreuen sich in verschiedene Richtungen, um zu prüfen, ob das, was sie sehen, keine Kulisse ist. Nie wieder finden sie zusammen, denn dort, wo statistisch gesehen auf einen Quadratkilometer weniger als ein Hundertstel Mensch kommt, zersplittern sie in diese Hundertstel und Tausendstel, verlieren sich als dritte oder vierte Ziffer hinter dem Komma als Messtoleranz.
Ich sehe den glatten Asphalt einer Chaussee – und muss an eine Landstraße im Norden denken, die zu einer Goldmine führte. Über sie rollten die LKWs der Aufseher, Geländefahrzeuge und Bulldozer. Der Straßenrand war gesättigt von Dieselabgasen, verhärtet zu einer öligen Schicht, die unter den Stiefeln knackte. Die gewaltigen Autos fuhren einzeln und in Kolonnen, und aus den hohen Fahrerhäuschen konnte man sehen, wie Tundrahasen vor dem Motorenlärm davonliefen, Rebhühner aufflogen, Fische die Bäche aufwärts schwammen und dabei den Schlamm aufwühlten. Die Niederung, die nur schwindsüchtige Bäume hervorbrachte, schien zu erstarren beim Anblick der Profilreifen und der glänzenden Bulldozermesser, die die Moos- und Beerenfelder zu zerstampfen und den feinen Boden aufzureißen drohten.
Dann tauchte hinter einem steilen Gefälle der große Zaren-Pfuhl auf, wie ihn die Fahrer nannten. Die einen sagten, der Ort sei von Schamanen verflucht, die sich dafür rächen wollten, dass man in den heiligen Berg Stollen zur Goldsuche gegraben hatte. Andere behaupteten, es habe hier eine Rentierseuche gegeben. Einer dritten Meinung zufolge war hier ein ganzer Transport mit einigen Hundert Häftlingen im Schneegestöber umgekommen, die man in den vierziger Jahren zu einer Mine getrieben hatte. Eigentlich waren die Fahrer ein hartgesottenes Volk, weder abergläubisch noch gottesfürchtig, aber mit dem menschlichen Verstand war dem Anblick des Zaren-Pfuhls tatsächlich nicht beizukommen. Es hatte den Anschein, als sei dieser Ort auf besondere Weise gezeichnet, als habe er einen schrecklichen und rachsüchtigen Charakter, der im Winter und in der Sommerhitze schlief, aber mit der Schneeschmelze oder bei Dauerregen erwachte.
Man konnte den Zaren-Pfuhl nicht umfahren. Der lange Streifen sumpfigen Bodens, der mit dem Wasser des tauenden Permafrostbodens getränkt war, zog sich über hundert Kilometer zwischen zwei Hügelketten. Wenn sich die Fahrzeuge dem Zaren-Pfuhl näherten und bremsten, eröffnete sich die Aussicht auf einen tragischen Ort. Die Erde ringsum schien zu schwanken, alles war von modrigem, rostbraunem Wasser überflutet, und daraus ragten von Kettenraupen zerstörte Balken und Bretter, von Eisen zerkratzte Steine, zerquetschte Tonnen, mit denen jemand den Pfuhl hatte überbrücken wollen, sowie schwindende kleine Kies- und Sandinseln hervor – alles Spuren der Versuche, einen Steg über das Loch in der Erde zu legen. Weiter entfernt stach ein Traktorenfahrerhäuschen mit abgeblätterter Farbe aus dem Sumpf heraus, und ein Hebekran ragte wie ein verbogener Pfeil hervor. An den Ufern des Pfuhls war ein wunderlicher Wald gewachsen. Dutzende in den Boden gerammte Eisenrohre und Betonpfähle, von denen ein Teil umgestoßen war – an sie hatte man Schlingen von Hebewinden steckengebliebener Fahrzeuge befestigt. Auch ausgefranste, gerissene Taue mit Dutzenden Knoten lagen hier, die dem Würgegriff des Pfuhls nicht standgehalten hatten. Trat man näher heran – vorsichtig auftretend, damit die Stiefel nicht in der trocknenden, klebrigen Brühe versanken –, konnte man die Spuren verzweifelter Versuche eines Übersetzens sehen, aus einer Zeit, als man in den Minen die Arbeit wegen Mangel an Brennmaterial, Sprengstoff und Lebensmitteln einstellen musste. Ein Unwetter hatte am Flughafen die Hubschrauber auf den Landeplatz niedergedrückt, und so hatten die Vorgesetzten zwei oder drei Fahrzeuge auf den Weg geschickt und den Fahrern alles Mögliche versprochen, wenn sie die Fracht an ihren Bestimmungsort brächten.
Auf diese Weise hatte sich unter den Fahrern die Kaste der Pfuhlexperten herausgebildet, Auguren des Nordens, die ihre Weissagungen nach dem Wasserstand und den Tierfährten auf der Oberfläche des Pfuhls machten – man ging davon aus, dass ein Elch oder Reh immer den trockensten Weg wählt. Sie hatten an einer weit entfernten Stelle riskiert überzusetzen, und es hatte danach lange gedauert, sie mit Traktoren ans Ufer zurückzuziehen. Die meisten aber hatten versucht, über die alte Fahrrinne überzusetzen. Die Spuren dieser Überfahrten waren auch am Rand des Pfuhls zu sehen: verstreute Konservendosen, von Rädern in den Boden gedrückte Wattejacken, Bretter von den Seitenwänden der Fahrzeuge, Blechteile, mit denen die Planwagen der Wachmannschaften beschlagen gewesen waren, Bänke, Öfen – alles war in die Rinne geworfen worden, um sie befahrbar zu machen, und alles hatte der Pfuhl beständig verschlungen. Manchmal blähte er sich auf, und an seiner Oberfläche tauchten vermoderte, von den Verdauungssäften der Erde zersetzte Leichengegenstände auf. Würgend stieß der Pfuhl Zelttuch, Schiefer und aneinanderklebende Bohrrohre hervor, verlötet zu einem gigantischen Abbild entwurzelter Baumstümpfe. Er spie Müll, Flaschen und Tüten, würgte an einem mit Erdklumpen vermengten Skelett eines Fuchses, den die Essensreste angelockt hatten. Und ein oder zwei Tage später schluckte der Pfuhl allen Auswurf wieder herunter.
Wenn eine Kolonne am Pfuhl angekommen war, rauchten die Fahrer lange, und die Passagiere zerstreuten sich in alle Richtungen. Der Pfuhl zog einen seltsam an, zwang zur unablässigen Beobachtung, als sei er ein feuerspeiender Vulkan oder ein Wasserfall. In ihm zeigte die Erde ihre feuchte, bebende, gierige Natur. Es war ein Schlund ohne Mund, ein aufgepflügter, offener Schoß. Der Pfuhl schaute die Menschen nicht an, im Gegenteil, er saugte ihre Blicke auf, wie er die menschlichen Anstrengungen und die Mühen der Fahrzeuge in sich aufnahm. Er schien keinen Grund zu haben, sonst hätte sich an seiner Stelle schon längst ein Berg von Balken, Sand und Kies gebildet. In der Strömung der flüssigen Erde bewegten sich tief unten langsam die versunkenen Traktorenraupen, Autoreifen, Fässer, Taue, Hebewinden, Bretter, Spaten, Brechstangen, Pumpenschläuche, öldurchtränkte Wattejacken und Fausthandschuhe voran – ein ganzer Kosmos untergegangener Gegenstände, in dessen strenge Form der menschliche Verstand alles gelegt hatte, was er dieser jegliche Formen zurückweisenden Elementarkraft entgegenstellen und in den Kampf schicken konnte – um sich schließlich ohnmächtig zurückzuziehen, während der Schoß des Pfuhls immer weiter anschwoll von all dem, was er verschlungen hatte.
Ich sehe einen Schäferhund, den ein Mann an einer Leine das Ufer entlangführt. Dem Hund ist heiß, linkisch tapst er über die erhitzten Steinplatten und hechelt närrisch, wobei er seine rosige, blau geäderte Zunge heraushängen lässt. Er ist bedauernswert, dieser Hund, überfüttert und alt, gewöhnt an sein Halsband, gleichgültig gegenüber den fetten Tauben, die in den Fugen zwischen den Gehwegplatten nach Krümeln suchen. Aber ich habe kein Mitleid mit ihm. Er erinnert mich an andere Schäferhunde, an den zähflüssigen Speichel, der an ihren oberen Reißzähnen hing, an den rosig schimmernden Gaumen, der gerippt war wie zerhauenes Rindfleisch auf einer Ladentheke, an ihr Bellen, das nichts Hündisches mehr hatte.
Gewöhnlich gibt der ferne Widerhall hündischen Gezänks in einer Nacht in Sumpf und Wald zu verstehen, dass Häuser, Menschen und ein Nachtlager nah sind. Das Bellen von Hunden eines Häftlingstransports jedoch ist kein Gebell des Zankens, Raufens oder der Jagd. Einem Häftling braucht man nicht hinterherzulaufen, er steht in der Macht des Hundes. Der Hass – seiner Natur nach ein menschliches Gefühl – erweist sich, dem Hund eingeimpft, als größer und stärker als er selbst, und der Hund muss diesen Hass am Häftling auslassen, weil der Hass sonst seinen schwachen Verstand zerstört, ihm die Stimmbänder zerreißt und den Kiefer ausrenkt. Deswegen erinnert selbst das schwache Gebell von Hunden eines Häftlingstransports aus der entfernten Ecke eines Bahnhofsgebäudes, wo man Häftlinge durch ein Spalier von Wachsoldaten mit Hunden zum Zug treibt, an gelbliche Reißzähne und den Hass, der den Menschen vom Tier mehr unterscheidet, als einen Menschen vom anderen. Denn das Tier durchlebt den Hass bis zum Ende, bis zur Selbstaufgabe, bis seine Sehnen und Wirbel krachen. Dieses Bellen ergießt sich als Hass an tausend Orten, er vergeht nie und lebt weiter in der Nachkommenschaft von Hund und Mensch, wird aufgesaugt mit der spärlichen Milch und dem Mark zernagter Knochen.
Ich sehe Fischer. Die Spitzen ihrer großen Spinnangeln leuchten in der Dämmerung, als angelten sie mit diesem grünlichen Glimmen fliegende Fische. Dann gehen die Fischer mit ihrem Fang in ein kleines Restaurant am Ufer und trinken Bier oder Wein, während die Fische in der Küche ausgenommen und gesäubert werden. Besonders gut passt der Weißwein aus dieser Gegend in Flaschen aus hellblauem Glas dazu, er ist rein und leicht und etwas bitter. Dieser Wein macht einen nicht trunken, hitzig oder müde, sondern scheint die Gefühle zu umspülen.
Ich trinke einen Schluck Wein, und die Frau, die ich hier kennen- und lieben gelernt habe, die sanften Fesseln der Laken, der zweifach vom Meerwasser gesalzene Schweiß auf ihrer Haut – all das entfernt sich, und mein Begehren schlägt auf einmal in eine fast geschlechtslose Zärtlichkeit um, in die Empfindung, dass der Körper dieser Frau ein Gefäß ihres Lebens darstellt, eines Lebens, das mir unzugänglich ist. Ich sehe nicht mehr sie an, sondern das Pulsieren des Lebens in ihr, das vielleicht auch sie selbst nicht kennt. Ich beobachte, wie sich das Blut ausdehnt und wieder abebbt, sehe das leicht gerötete Gesicht und die sich wellenden Haare. Die Alltäglichkeit ihres Körpers ist für mich wertvoll und unverzichtbar. Ich möchte ihre Hand nehmen, um den Puls zu fühlen: das Schlagen ihres Herzens, das im Körper ihrer Mutter heranwuchs und aus dem Nichts entstanden ist, aus nur wenigen Zellen.
Ich weiß, dass mir noch nie jemand so nah war wie sie. Aber auch sie ist mir nicht nah. Man serviert den Fisch, ihr eine Dorade, mir einen Schwertfisch, denn dessen Fleisch ist dem eines Fisches am unähnlichsten. Er besteht aus groben Fasern und sieht aus wie ausgeblichenes Rindfleisch, nur deswegen kann ich ihn essen. Ich könnte ihr erzählen, warum ich meinen Blick von ihrem Teller abwende, Wein trinke und aufs Meer schaue, und sie – die Sensible und Verständnisvolle – würde mitfühlen und alles begreifen, aber es wäre trotzdem nur eine Erzählung. Es gibt eine Art von Erfahrung, die man nicht teilen kann.
Deswegen beobachte ich die Fischer am Ufer, sehe, wie die Spinnangeln zittern und sich biegen, wenn sie einen Fisch an Land ziehen, und in diesen dünnen Angelruten erkenne ich die gebogenen Zweige eines wilden Johannisbeerstrauchs am Ufer eines Flusses im Norden, an denen blasse, im Licht rosig schimmernde, wässrige Beeren lasten. In jeder mit weißlichen Äderchen durchzogenen Beere reifen schwache Kerne, und die Johannisbeerblätter welken bereits, auch wenn sie noch grün sind. Das Flusswasser badet die Blätter und Trauben in der Stromschnelle, ein Stück weiter wird das durchsichtige Wasser dunkel und farbenreich. Dort ist ein Wasserstrudel, das Wasser dreht sich gemächlich und zähflüssig im Kreis, und auf seiner Oberfläche halten sich zarte Ringe, ähnlich Spuren von Tropfen, die auf die erhärtete Schmelze von Glas gefallen sind – Äschen schnappen dort nach Insekten.
Der Sommer senkt sich, das frühe Dunkel erstarkt, mit jedem Tagesanbruch wird es kälter, und der Wind wirft leicht beflügelte Libellen aufs Wasser, als fege er Fischschuppen und Insektenflügel als Kehricht aus. Die Äsche ist ein Todesfisch, ein Flussjäger – sie schluckt Fliegen, Mücken, Libellen, um danach die Strömung abwärts zu schwimmen, sich in Löchern am Grund zu verkriechen und in Apathie zu erstarren, bis der Frühling kommt. Regenbogenfarbige Flossen planschen im Wasser, regenbogenfarbige Fischleiber scheinen darin auf.
Rast. An einer Stange dampft ein Kessel, Fischsuppe wird zubereitet. Das Fleisch der Äsche ist zart, es darf nur kurz gekocht werden, und es ist eine Delikatesse – frischer Fisch, mit Salz und Pfeffer abgerieben, unter Druck gegart, saftig. Aber dann gehen wir weiter den Fluss entlang, der Pfad springt von einem Ufer zum anderen, und beim Übersetzen tritt jemand auf einen Menschenschädel, der sich zwischen Steinen verkantet hat und mit glitschigem, grünem Tang überzogen ist.
Ein Schädel. Ein Schädel im Wasser. Und stromaufwärts – eine wasserumspülte Steilwand, ein schwarzer Torfbrocken. Im Torf ein weiterer Schädel, Knochen, halbverwestes, erschlafftes Fleisch wie überwinterte Moosbeeren unter einer Schneedecke – ein Lagerfriedhof, der unterspült wurde, nachdem der Fluss sein Bett gewechselt und sich in einen neuen Nebenarm ergossen hat. Ich erbreche den Fisch, den ich gegessen habe. Im Fleisch der Äsche war Menschenfleisch, und nun bin ich ein Menschenfresser, und ihr alle seid Menschenfresser, weil ihr den Fisch gegessen und dieses Wasser getrunken habt, in dem die Toten verwest sind. Ich würge daran, doch das Unreine bleibt, es ist in meinem Körper, in meinem Blut für immer.
Und ich verfluche die Spinnangel, die Angelschnur und den Köder. In meiner Lippe steckt ein Wurmhaken, ich habe den Blinker heruntergeschluckt, er zerreißt mir die Gedärme. In den Fluss geworfene Fischskelette und menschliche Knochen – ich war immer nur ein Bindeglied in der Verzehrkette, mein selektives Gedächtnis wurde zum Mordwerkzeug. Zu viel von mir selbst lag darin, und das vollblütige, starke Leben hat gleichsam insistiert, es gäbe keine Trauer, keinen Verlust für das Sein – das Leben bezwinge und tilge alles.
Mir wird klar, dass ich die Hostie des Todes nicht zufällig angenommen habe. Durch sie sehe ich wie mit wiedererlangter Sehkraft meinen Körper, mein Erinnerungsvermögen, mein Leben wie eine Vorherbestimmung: das Erbe des Bluts, das Erbe der Erinnerungen, das Erbe fremden Lebens – alles lechzt nach Worten, sucht nach Sprache, will sich erfüllen bis zum Schluss, will sich vollenden, erkannt und beweint werden.
Ich sehe und erinnere mich. Und dieser Text ist wie ein Denkmal, wie eine Klagemauer, wenn die Toten und Trauernden sich nirgendwo treffen können als an der Mauer der Worte, die Tote und Lebende vereint.
Sommertage – lang und geräumig wie eine Enfilade lichtdurchfluteter Zimmer. Tage, an denen in der Natur alles im Überfluss vorhanden ist. Der Schlaf ist kurz, und man erwacht im Morgengrauen – Sommertage, Sommer des Lebens.
August. In diesem Monat bin ich zur Welt gekommen. Ich wurde im Sommer geboren, und die Welt zeigte sich mir sommerlich. Es war heiß, die Thermometersäule reckte sich zur Marke sechsunddreißigsechs, meine Körperwärme stimmte mit der Lufttemperatur überein, die Welt nahm mich an.
August. In einem August bin ich gestürzt, nachdem ich auf den Bügel eines Kinderwagens geklettert war. Ich fiel zusammen mit ihm auf einen Stein, Blut spritzte aus meinen aufgesprungenen Lippen, der Mund verwandelte sich in eine Wunde, und die Milchzähne brachen heraus. Ich spürte einen Schmerz, der sich für Jahre im Voraus in einen Sprachfehler verwandelte, in die Metallbügel einer Zahnspange, die den Eisengeschmack des Bluts bewahrten. Ein Schmerz, der meine Sprache verstümmelte und lähmte, als müsse sich jedes meiner Worte durch Gitterstäbe zwängen. Aber die Beschädigung macht mich nicht zu einem Ausgestoßenen, wie es oft bei Kindern vorkommt. Im Gegenteil, dank ihrer war ich meinen Gleichaltrigen voraus, wenngleich der Grund dafür nicht der Schmerz oder die erlittenen Qualen waren, die einen manchmal erwachsener werden lassen.
Die Wörter, die nicht ausgesprochen wurden, wenn ich es wollte, häuften sich in mir an. Andere Kinder sammelten Spielzeugautos oder die Älteren Briefmarken, aber ich sammelte in mir Wörter. Für den einen bedeutete das Rechteck einer Briefmarke die Verheißung eines anderen Lebens mit anderen Ländern, in denen Ruhm und Heldentaten so grandios und triumphal waren, dass der Held mit seinem Porträt auf Briefmarken, den allerkleinsten Teilchen des Weltmosaiks, verewigt und in alle Welt gesandt wurde. Ich hingegen spürte in jedem Wort den Abglanz jenes großartigen Lebens, aus dem es stammte.
Verborgen hinter dem äußerlichen Kindheitsalter war es ebendieses tiefgründige Alter der Schweigsamkeit inmitten von Wörtern und sich Wörter bedienender Gespräche, das mir all die Einsichten ermöglichte, die meine Entwicklung schneller als gewöhnlich vorantrieben.
Meine Geburt hatte ein Mann durchgesetzt, den ich den zweiten Großvater nennen werde – so habe ich ihn insgeheim in meiner Kindheit genannt. Selbstverständlich hatte er einen Vor- und Nachnamen, aber sie sind unwesentlich. Meine kindliche Wahrnehmung erahnte sehr genau die mit Höflichkeit maskierte, äußerste Abgesondertheit dieses Menschen. Es war nicht so, dass er sich abseits hielt oder verschlossen war, es lag nicht an seinem Verhalten oder seinem Charakter. Er lebte fast im juristischen Sinne des Wortes isoliert und war infolgedessen auch von den Menschen abgesondert. Alles, was in der Gegenwart geschah, widerfuhr ihm nicht direkt, sondern streifte ihn nur – jedoch nicht aus Mangel an Aufnahmefähigkeit, sondern weil er sein Leben schon gelebt zu haben schien, seine Existenz über seine Lebenslinie hinausging und ihn nichts mehr erschüttern konnte. Auf den Bildern der Ereignisse war seine Figur wie ausgelassen, als habe man ihn bestraft, abgewiesen, ausgestoßen.
Der zweite Großvater war blind. Einen Blinden äußerlich zu beschreiben ist schwierig. Blinde Augen nehmen einem Menschen nicht nur ein gewohntes äußeres Detail, man hat zudem den Eindruck, der Blinde sei auch zu anderen Dingen außer der Orientierung im Raum unfähig. Wer blind ist, scheint wie verloren in der Zeit, existiert nur vage im gegenwärtigen Augenblick. Diese Verlorenheit lässt die Gesichtszüge verwischt erscheinen, als habe sich der Mensch bewegt, während man ihn fotografierte.
Wenn ich jetzt versuche, mir sein Gesicht vorzustellen, erinnere ich mich an Momente, in denen es unbedingt vorhanden sein muss, ich sehe sie mit fotografischer Genauigkeit, aber sein Gesicht fehlt, als wäre es überbelichtet. Ich kann äußere Merkmale aufzählen – mittelgroß, hager, grauhaarig –, aber sie sind kein Schlüssel zu seiner Beschreibung.
Zweiter Großvater – nur so konnte ich ihn nennen. Wenn man seinen wirklichen Namen aussprach, war es so, als werfe man ein Zettelchen über den Kontrollstreifen einer Ländergrenze, aber das Zettelchen kommt nie an, sondern fällt auf halbem Wege zu Boden. Das anonyme Zahlwort – der zweite Großvater – entsprach meiner eigentlichen Empfindung.
Er war nicht mit mir verwandt, sondern unser Grundstücksnachbar, ein blinder alter Gärtner. Sein gesamtes Vorleben schien in die starre Kontur einer Militär- oder anderen Uniformjacke zusammengeschnürt, jetzt trug er nur weiche, den Körperlinien gehorchende Leinenstoffe. Erblindet war er vor langer Zeit, mehr als ein Jahrzehnt vor meiner Geburt. Er schien seine Blindheit und die ihr geschuldeten, den Blinden versklavenden Gewohnheiten durchmessen zu haben und war nun in der Unfähigkeit zu sehen frei. Er hatte sein Leben auf einige Wege reduziert, von denen der wichtigste aus seiner Wohnung zu seinem Ferienhaus und zurück führte. In Alltagsdingen verließ er sich auf eine Haushälterin, und mit den Jahren hatte er durch sein Gehör und seinen Tastsinn im Kopf ein Abbild des beschnittenen Raums geschaffen, den er sich als Lebensbereich erwählt hatte.
Im Grunde lebte er auf einigen Inseln, deren festem Boden bekannter Laute, Gerüche und ertasteter Wahrnehmungen er vertraute. Man kann sagen, er nahm ihn mit seinem ganzen Körper wahr, stützte sich auf ihn, und seine Lage war in diesem Sinne sogar stabiler als die eines Sehenden. Einzig Neuerungen konnten ihm gefährlich werden. Die neue Brücke über dem Graben, eine neue Haustür, eine verlegte Bushaltestelle – all das zerstörte die Attrappe, die sich der zweite Großvater aus Tönen und Körperwahrnehmungen geformt hatte. Für einen Sehenden sind diese Zerstörungen nicht als solche wahrnehmbar, er sieht nur eine Veränderung, doch der Blinde ist dem wahren Verständnis der Dinge näher: Eine Neuerung ist der Tod, eine Wiederbelebung ist Mord. Deshalb, wenn auch nicht ausschließlich deshalb, nahm der zweite Großvater die Vergangenheit ernster als andere Menschen.
Was er früher gemacht hatte, wusste niemand. In der Siedlung gab es fast keine Alteingesessenen mehr, bei denen man sich hätte erkundigen können. Das Leben in einer Ferienhaussiedlung begünstigt Bekanntschaften, man sammelt Lebensläufe und Namen lokaler Berühmtheiten – »Und dieses Haus gehört dem und dem!« –, aber der zweite Großvater existierte stets außerhalb dieser Nachforschungen.
Seine Unscheinbarkeit war anziehend: Neben ihm wirkte jeder ein wenig bedeutungsvoller, als er in Wirklichkeit war. Der zweite Großvater war wie eine Kulisse, die Apotheose der Unscheinbarkeit – nicht der Bescheidenheit, nicht der Fähigkeit, sich im Hintergrund zu halten, sondern der Unscheinbarkeit. Bescheidenheit und die Fähigkeit, sich nicht zu exponieren, sind Erkennungsmerkmale, und genau die hatte er nicht. Er lebte, als wolle er der Aufmerksamkeit des Lebens entgehen, und darin erreichte er eine fast mönchsgleiche Perfektion.
Hauptbuchhalter irgendeines Konzerns – an ihm zeigten sich Reste der Angewohnheit, andere zu befehligen, wenn auch nur schwach, zum Beispiel, wenn er sich wichtigtuerisch an einen Tisch setzte und in seinen Fingern einen Stift wog, um eine Quittung zu unterschreiben. Es schien, als habe das Ziffernwerk seine Augen hinter den getönten Gläsern verschlungen. Nur einer von den Dorfältesten – die Ferienhäuser standen auf dem Territorium eines ehemaligen kleinen Pilzwalds hinter einem Dorf – sagte, der zweite Großvater sei mitnichten Buchhalter gewesen. Auf dem Land hat man einen anderen Blick für Menschen, ein anderes Gespür für Schicksale als in der Stadt, dort fühlt man auf andere Weise die Zugehörigkeit eines Menschen zum Staat, auch wenn dieser in der Vergangenheit nur Postbote oder Forstarbeiter gewesen ist. Die Ältesten meinten, dem zweiten Großvater hafte ein »Gerüchlein« an, nach »Amtsstiefel« rieche er. Im Übrigen hielten sich die Dörfler mit ihren Mutmaßungen zurück – ob er nun Rechnungsführer bei der Miliz oder Wirtschaftsfunktionär gewesen sei –, der Amtsstiefelgeruch war ihrer Meinung nach nur schwach.
Die Bewohner der Wochenendhäuser hingegen urteilten nicht einmal nach den Gesichtspunkten der Stadt, sondern nach denen einer Ferienhaussiedlung. Eine Datscha zu besitzen wurde zu jenen Zeiten in diesem Kreis von Menschen als eine Art Amnestie wahrgenommen, als ein Freispruch von der Vergangenheit, wie sie auch gewesen sein mochte; nicht von eingebildeten oder tatsächlichen Untaten, sondern von der Vergangenheit als solcher.
Selbstverständlich konnte in diesem Kreis die Frage, was der zweite Großvater früher gemacht hatte, nicht ausgesprochen werden – sie hätte in der Luft keinen Widerhall gefunden. Nur anständige Menschen gab es dort, und diese Wortverbindung – ein anständiger Mensch – kein ehrenwerter, kein guter, sondern ein anständiger Mensch – galt in der Siedlung als höchstes Lob. Im Grunde war es das, was alle Ferienhausbesitzer einte: Sie hatten es geschafft, in schwierigen Zeiten Menschen zu bleiben, über die aus verschiedenen Gründen niemand etwas Schlechtes sagen wird.
Auf den ersten Blick war die Ferienhaussiedlung eine Oase, eine kleine Insel des Seelenfriedens, der Ruhe und Freundschaftlichkeit. Aber wir Kinder spürten, dass alles vorgetäuscht und gekünstelt war. Wir wurden viel zu streng und übereifrig erzogen, ohne Pardon, ohne Milde in moralischen Fragen. In den Köpfen der Erwachsenen war ein genaues Feld der Verdunklung umrissen, und wenn diese Verdunklung eintrat – weil jemand gestohlen, gelogen oder ein Versprechen nicht gehalten hatte, war die Bestrafung unangemessen. Nicht hinsichtlich ihrer Härte, sondern in der Bereitschaft, sich vom Sohn oder der Tochter loszusagen, als habe man es nicht mit einem Kind zu tun, sondern mit einem Feind, der sich in die Familie eingeschlichen hat, einem auf der Geburtsstation untergeschobenen Wechselbalg.
Die Verwandten konnten eine Szene veranstalten: Ist das etwa unser Sohn? Ist das etwa unsere Tochter? Ich erinnere mich, wie einer meiner Freunde mit acht Jahren diese Fragen nicht mehr aushielt – es ging um einen Pflaumendiebstahl –, plötzlich auf seine Eltern zutrat und laut und hartnäckig wiederholte: Ich bin euer Sohn! Ich bin euer Sohn! Sie wichen zurück und wussten nicht, was sie mit dem zitternden Jungen machen sollten, der seine aufgeschnallte Sandale verloren hatte und ohne Wut, ohne Trotz mit der unerwarteten Festigkeit des Schwächeren schrie: Ich bin euer Sohn! Sie, die Erwachsenen, hatten in diesem Moment Angst vor einem achtjährigen Kind. Die Eltern und der Gartenbesitzer standen unverwandt da, bis der Junge kapitulierte, in einen Straßengraben kroch und anfing zu weinen.
Man meinte, die Kinder auf ein Leben vorzubereiten, wo jedes Vergehen nicht für sich genommen schändlich war, sondern weil es vor allem ein schlechtes Licht auf die Verwandten warf, die dann einer näheren Betrachtung unterzogen wurden: Wer hat denn dieses Kind so erzogen? Man wollte schließlich alles andere, als einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Daraus entstand eine herrenlose Moral, und alles war von diesem Richtigmachergetue durchdrungen. Die Aufforderung, nicht zu lügen, führt im Zusammenspiel mit Angst nur zu einer Vermehrung der Lüge und nötigt zu einem raffinierteren Vorgehen.
Die Kindheit in der Ferienhaussiedlung – schon längst wurde sie zur Vorstadt mit anderen, neuen Häusern und undurchdringlicheren Zäunen –, sie war eine Schule der Doppelzüngigkeit. Ich kann das nicht in vollem Maße auf meine Familie und die Familien einiger meiner Freunde beziehen – aber im allgemeinen Umgang war es so. Jedes von uns Kindern führte mehr oder weniger ein Doppelleben, womit weder geheime Bubenstreiche, das Übertreten von Verboten, Unterschlagungen oder eine erzwungene Verschlossenheit gemeint sind. Wir wurden – jeder auf seine Weise – von unseren Verwandten verraten, die uns viel zu sehr als Kinder sahen, die wir nicht waren, aber werden sollten.
Übrigens bin ich meiner Kindheit dankbar. Hätte es nicht die gesteigerte, fast an Schizophrenie grenzende Doktrin der Persönlichkeitsspaltung gegeben in denjenigen, der Sohn, Enkel, Neffe, Sohn von Freunden, der Junge-von-Gegenüber war und in das eigentliche Selbst, wäre ich nicht der geworden, der ich bin. Und selbstverständlich hätte ich nicht die wirkliche Natur des zweiten Großvaters erspüren können.
Eines Tages – ich nehme das vorweg – begriff ich auf naive, kindliche Weise, dass die eigene Sichtweise wie ein Spiegel ist. Wir sehen keine Menschen an, sondern wie Menschen sich in uns spiegeln. Ich meinte, ein Geheimnis entdeckt zu haben, und es blieb nur herauszufinden, wie man den ureigenen Blick finden konnte, um dass zu sehen, was man sonst nicht gesehen hätte.
Nachdem ich darüber nachgedacht hatte, begann ich, mit meinem Schatten zu spielen. Ich versuchte mich so hinzustellen, dass man am Schatten nicht erkennen konnte, dass ich es war, der ihn warf. Ich ging zum Stamm eines Apfelbaums, zu einem Fass, zu einer Vogelscheuche, und indem ich den Kopf einzog und meine Arme versteckte, bemühte ich mich, ihren Schatten zu imitieren. Damit experimentierte ich einige Tage und wählte dafür die Abendstunden, wenn die Schatten konturierter, zäher und länger sind, ich spielte gedankenlos und vergaß dabei die Zeit. Doch als ich einmal, bereits müde und nur noch herumalbernd, mich jäh umdrehte, erstarrte ich: Ich hatte keinen eigenen Schatten mehr. Den Moment der Unterschiebung hatte ich verpasst, und nun stand ich da und hatte Angst, mich zu bewegen. Was würde sein, wenn auch eine Bewegung nicht helfen würde, wenn dieser fremde Schatten sie wiederholte und dabei fremd bliebe? Aber ich war in einer sehr unbequemen Haltung erstarrt, trat von einem Bein aufs andere, kniff die Augen zusammen, und als ich die Lider wieder öffnete, sah ich vor mir wieder meinen eigenen Schatten.
Das Spiel hatte eine gefährliche Bedeutung erlangt, und nun versuchte ich ganz bewusst, den Zustand der erregten Selbstvergessenheit wiederzuerlangen, als ich mich im Spiel ganz den Bewegungen und den letzten Sonnenstrahlen hingegeben und dabei für einen Moment das Bewusstsein verloren hatte, mir fremd geworden war – mit einem unbekannten Schatten.
Allerdings erreichte ich diesen Zustand danach nie wieder. Daraufhin begann ich die Schatten der Erwachsenen zu studieren – das war nun kein Spiel mehr, sondern ein Weg der Erkenntnis. Mir kam es so vor, dass ihre Schatten sich nicht nur durch ihre Umrisse unterschieden. Der meines Vaters war um einiges größer als er selbst, und wenn er das Licht im Zimmer löschte, nachdem er mir eine gute Nacht gewünscht hatte, schien sein Schatten im Raum zu bleiben, aufgelöst in der Dunkelheit, wuchernd und bedrohlich, als wolle er beobachten, ob ich wirklich schliefe. Der Schatten meiner Mutter war fließend, in seinen Umrissen musikalisch, mir kam es so vor, als würde er bei einer Berührung gleich einem Violoncello mit Wohlklang antworten. Der Schatten meiner Großmutter schimmerte wie Wollgarn, wie Stricknadeln – es war ein wohlwollender Schatten.
Den Schatten des zweiten Großvaters hingegen konnte ich nicht ergründen, er rief keine Vorstellungen hervor, wie sehr ich mich auch bemühte, etwas in ihm zu erkennen. Man konnte nicht sagen, dass er gewöhnlich gewesen wäre oder der Phantasie keinen Anhaltspunkt geboten hätte. Mir schien, der zweite Großvater wusste, wie sein Schatten beschaffen war, er lenkte ihn und achtete darauf, dass er nichts von ihm preisgab, ständig zog er ihn zurecht wie einen langen Mantelschoß.
Übrigens ist diese Geschichte vorweggenommen. Ich wollte lediglich die Umstände meiner Kindheit und den Ausgangspunkt der weiteren Geschichte erklären – der Geschichte, wie der zweite Großvater nach und nach in unsere Familie kam, wie ich geboren wurde und in welchem besonderen Verhältnis wir zueinander standen.
Das Ferienhausgrundstück meiner Familie grenzte an das des zweiten Großvaters. Es gab keinen Zaun dazwischen, als Ersatz dafür diente ein Wasserleitungsrohr, und es hatte sich von Anfang an so ergeben, dass die vorherigen Besitzer uns mit dem Verkauf des Grundstücks auch die freiwillige Verpflichtung weitergaben, für den zweiten Großvater zu sorgen. Die Aufteilung der Ferienhausgrundstücke und die Abgetrenntheit der Nachbarn voneinander stützten sich auf sichtbare Kennzeichen – Flechtzäune oder wie bei uns ein Rohr. Was war da von einem Blinden zu erwarten? So kam es also, dass die Abgrenzung nicht funktionierte und das Verhältnis zum zweiten Großvater den Rahmen der Nachbarschaftlichkeit überstieg.
Soweit ich es beurteilen kann, hatte der zweite Großvater kein offensichtliches Interesse an einer Annäherung. Er suchte keine Zuhörer, er brauchte keine Kameradschaft. Alles ergab sich wie von selbst, der zweite Großvater machte sogar den Anschein, als ob er erzwungenermaßen der nachbarlichen Leutseligkeit nachgäbe. Jetzt denke ich, die Annäherung war für ihn ein Versuch. Jahrzehntelang hatte er zurückgezogen und in der Vergangenheit gelebt, und nun riskierte er zum ersten Mal, mit unbekannten Menschen zusammenzukommen, um an ihren Augen und Gefühlen zu erproben, wie gut all das verborgen war, was verborgen werden musste.
Übrigens ist diese Erklärung zu einfach, die Gründe waren vielfältig. Der zweite Großvater verfügte über eine unverwüstliche Gesundheit. Die Natur, die ihm das Sehvermögen genommen hatte, schien ihn nun für lange Zeit mit weiteren, ihm zugemessenen körperlichen Makeln zu verschonen, und alle altersbedingten Kränkeleien gingen an ihm vorüber. Nur die Knochen schmerzten ihn bei schlechtem Wetter – offenbar hatte er sich einmal Erfrierungen zugezogen, und jetzt warnte ihn sein Organismus vorzeitig vor einem bevorstehenden Kälteeinbruch. Trotzdem suchte der zweite Großvater Menschen – und fand sie in meiner Familie –, in deren Mitte er sterben konnte. Dabei wünschte er in erster Linie keine Verlässlichkeit, keine Hilfe für den »Fall X«, sondern Zurückhaltung gegenüber fremden Geheimnissen.
Er knüpfte eine Beziehung – nicht für das Leben, sondern für den vorerst verschobenen Tod. Diese Haltung, diese Entwicklung konnte ich, in der Beziehung steckend, nicht erfassen, ich kann darüber nur anhand meiner Erinnerungen urteilen. Der zweite Großvater wurde kein Familienmitglied und verlangte nicht nach Zuwendung – im Gegenteil, er bemühte sich, keine Last zu sein, er bettelte nicht um Nähe, und sein Verhalten hatte nichts Nachdrückliches, Gekünsteltes, Mitleidheischendes. Doch lag darin die vorgetäuschte Wahrhaftigkeit einer Theaterrolle, wenn ein Schauspieler selbst die geringste Abweichung von der gewählten Darstellungsweise zu vermeiden sucht.
Natürlich kann sich auf diese Weise auch ein Mensch verhalten, dessen Absichten vollkommen edel sind, allerdings wäre diese Hochherzigkeit dann natürlich. Doch alles, was der zweite Großvater tat, wirkte immer ein wenig isoliert und losgelöst von ihm selbst. Ihn trieb eine Absicht an, und nicht die innere Unfähigkeit, sich anders zu verhalten.
Übrigens stammt die letzte Bemerkung aus der Zeit danach – damals dachte niemand so, im Gegenteil. Soweit ich es beurteilen kann, wurde in meiner Familie über den zweiten Großvater als einen aufrichtigen, wenn auch verschlossenen Menschen gesprochen.
Er verstand es, sich nützlich zu machen – durch einen ausgewogenen Ratschlag, durch notwendige Auskünfte. In seiner Gegenwart stellte sich das Gefühl einer Beständigkeit des Lebens ein, das entsteht, wenn jemand in der Nähe ist, der viel erlebt hat und unter Schwierigkeiten zu existieren gewohnt ist. Meine beiden richtigen Großväter waren im Krieg gefallen, und der zweite Großvater nahm nach und nach den Platz des Ältesten in unserer Familie ein, obwohl er sich selbst nicht zu unserer Familie zählte. Er erhob keinen Anspruch auf diesen Platz, bemühte sich nicht, das Andenken an die leiblichen Großväter zu verdrängen, im Gegenteil, er hielt es in hohen Ehren. Ganz langsam fügte er sich mit den Jahren ein: gab uns Setzlinge für den Garten, brachte uns bei, die Bäume zu pfropfen, das widerstandsfähigste Pfropfreis auszuwählen, es am Stamm anwachsen zu lassen, mit Teer zu bestreichen und in den ersten Jahren für es zu sorgen. Und mit der Zeit wuchs er selbst an, verband sich mit uns, als wisse er von der langatmigen Kraft der Zeit, die keine Eile erträgt und nur kleine, alltägliche Anstrengungen zulässt – so werden Texte geschrieben, so lösen sich Aussichtslosigkeit und Widersprüche in Beziehungen. Es sind die kleinen Anstrengungen, die einen Nährboden schaffen und ihn bestellen; ein Nährboden, der anfangs quantitativ wächst, und von einem Moment an beginnt, über eigene Qualitäten zu verfügen, neue Verbindungen hervorzubringen und vormals undenkbare Ereignisse, Zwischenfälle, Gedanken und Taten zu ermöglichen.
Am Ende eines Sommers wurde Konfitüre gekocht – der zweite Großvater machte sich nützlich und wusch die Kupferkessel aus. Tomaten, Gurken und anderes wurde in Salzlake eingeweckt – er brachte mit heißem Wasser abgespülte Gläser. Stachelbeeren, Johannisbeeren, Äpfel – das fruchtige Nass, der Nektar des Sommers wurde eingekocht und verdickte sich, die fruchtbringende Zeit des Sommers wurde mit Korken verschlossen bis zum Anbruch von Winter, Kälte und Dunkelheit. Duftende Sommerkräuter legten sich mit Gurken, Tomaten und Patissonen in ein Glas, boten das Bett für gesalzene Pilze, die einen blasigen, wie von einem Kind gesabberten Saft absonderten.
Eine Familie entsteht durch zeitgleiche Beziehungen zwischen Menschen verschiedenen Alters, und der zweite Großvater wurde nach und nach in diesen Kreis aufgenommen, zunächst als jemand, der nicht fremd war, bis er schließlich einer von uns wurde. Man las ihm aus Romanen, Zeitungen und Zeitschriften vor – seine Haushälterin tat dies hölzern, ohne Intonation, sie ließ nie ein Buch an sich heran. Er wiederum erzählte aus der Vergangenheit, äußerst fragmentarisch, als stoße er ständig an die Grenzen eines Bereichs, über den er sich auferlegt hatte zu schweigen. Bei meinen Verwandten entstand der Eindruck, dass in seiner Vergangenheit eine Tragödie, ein Unrecht lag, vielleicht eine Inhaftierung, eine Verbannung oder eine Freiheitsstrafe. Der zweite Großvater liebte Brettspiele, Lotto und Karten, nur musste immer jemand neben ihm sitzen und mit Berührungen der Hand zeigen, welcher Zug zu machen war. Die Abende im Ferienhaus unter dem Stofflampenschirm wurden dank seiner Anwesenheit so, wie sie sein sollten, so wie Abende in einem Ferienhaus sein müssen, wo Menschen unterschiedlichen Alters zusammenkommen, wo es keine Leerstellen in den Generationen gibt, wo alle in einer gutherzigen Verbindung zueinander stehen, weil es den einen gibt, dessen Gebrechen keine Last ist oder Unannehmlichkeiten bereitet, so dass man ihm leicht und einfach helfen kann. Über den Tisch rollten die bauchigen Fässchen des Brettspiels, Karten legten sich auf das Tischtuch, draußen wurde es dunkel, und es war wahrscheinlich viel zu schön zu fühlen, dass dem einen der Abend eher bevorstand als dem anderen – der Abend des Lebens.