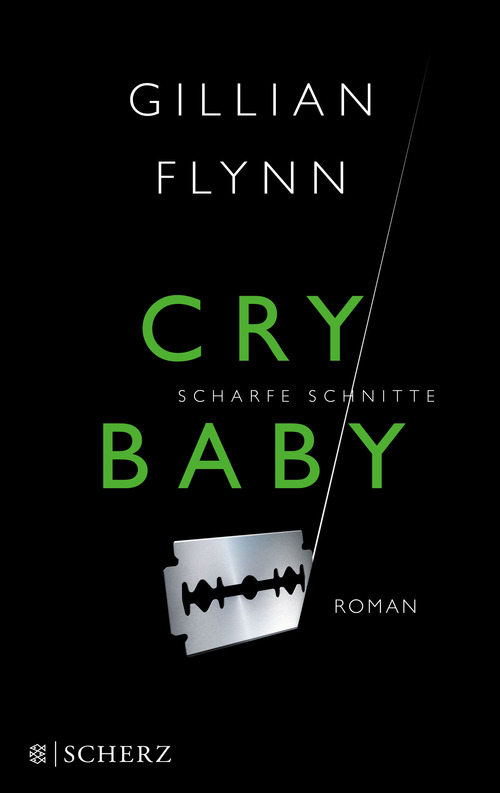
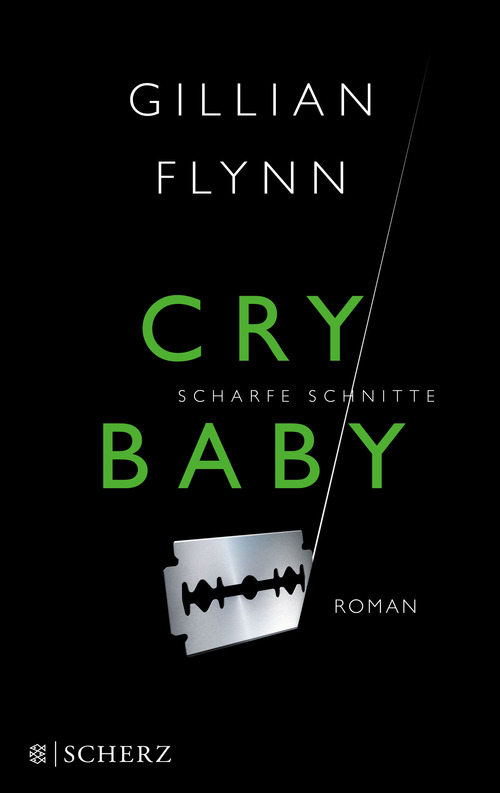
Gillian Flynn
Cry Baby - Scharfe Schnitte
Roman
Aus dem Amerikanischen von Susanne Goga-Klinkenberg
FISCHER E-Books

Gillian Flynn wuchs in Kansas City, Missouri, auf. Nach College und Universitäts-Studium in Kansas und Chicago zog es sie nach Kalifornien, anschließend nach New York. Sie war zehn Jahre lang die leitende TV-Kritikerin von Entertainment Weekly. Im Jahre 2006 erschien ihr erster Roman Cry Baby, mit dem sie großes Aufsehen erregte. Das Buch erhielt gleich zwei British Dagger Awards. Ihr zweiter Roman Finstere Orte erschien 2009 und wurde ebenfalls ein riesiger Erfolg. Im Juli 2012 erschien ihr dritter Roman Gone Girl und löste ein riesiges Medienspektakel aus. Das Buch stand monatelang auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste und wurde mehr als 3 Millionen mal verkauft. Alle drei Bücher werden verfilmt und demnächst im Kino zu sehen sein. Die Autorin lebt heute mit ihrer Familie in Chicago.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Sharp Objects« bei Shaye Areheart Books, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York
© 2006 by Gillian Flynn
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2007
Covergestaltung: Hafen Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402784-5
Für meine Eltern Matt und Judith Flynn
Mein Pullover war neu, knallrot und hässlich. Wir hatten schon den 12. Mai, aber keine zehn Grad, und nachdem ich vier Tage im T-Shirt gezittert hatte, besorgte ich mir lieber etwas im Ausverkauf, statt wieder die Winterklamotten hervorzukramen. So ist der Frühling in Chicago.
Ich hockte an meinem Arbeitsplatz vor dem Computer und recherchierte eine üble, wenn auch nicht weltbewegende Geschichte. In der South Side waren vier Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren entdeckt worden, die man mit ein paar Thunfischsandwichs und einem Liter Milch in ein Zimmer gesperrt hatte. Sie saßen drei Tage dort drinnen und flatterten wie die Hühner zwischen den Nahrungsmitteln und den Fäkalien umher. Die Mutter war abgehauen, um ein Pfeifchen zu rauchen, und hatte sie völlig vergessen. Kann passieren. Keine Brandwunden von Zigaretten, keine Knochenbrüche. Nur ein einziger nicht wiedergutzumachender Ausrutscher. Ich hatte die Mutter nach ihrer Verhaftung gesehen: Tammy Davis, 22 Jahre, blond und fett, auf den Wangen zwei perfekte Kreise aus rosa Rouge, groß wie Wassergläser. Ich konnte sie mir gut auf einem verschlissenen Sofa vorstellen, Lippen am Pfeifenhals, eine einzige Rauchschwade. Dann verschwamm alles, sie ließ die Kinder weit hinter sich, träumte sich zurück in die Junior Highschool, wo die Jungs noch auf sie standen und sie die Hübscheste von allen war, dreizehn, glänzende Lippen, sie kaute Zimtstangen, bevor sie einen küsste.
Ein Bauch. Ein Geruch. Zigaretten und abgestandener Kaffee. Mein Chefredakteur, der verehrte, müde Frank Curry in seinen rissigen Hush Puppies. Die Zähne in braunem Tabakspeichel getränkt.
»Wie weit bist du mit der Story, Kleines?« Auf meinem Schreibtisch lag ein silberner Reißnagel mit der Spitze nach oben. Er schob ihn verstohlen unter seinen gelben Daumennagel.
»Bin fast durch.« Mir fehlte noch die Hälfte.
»Gut. Reinhauen, rausschicken, ratzfatz in mein Büro.«
»Ich kann auch sofort kommen.«
»Reinhauen, rausschicken, ratzfatz in mein Büro.«
»Na gut, zehn Minuten.« Ich wollte meinen Reißnagel zurück.
Er machte einen Schritt aus meiner Nische. Die Krawatte baumelte bis zum Schritt.
»Preaker?«
»Curry?«
»Hau rein.«
Frank Curry hält mich für weich. Vielleicht, weil ich eine Frau bin. Oder weil ich wirklich weich bin.
Currys Büro befindet sich im zweiten Stock. Ich bin sicher, er macht sich vor Aufregung ins Hemd, wann immer er aus dem Fenster guckt und einen Baumstamm sieht. Gute Chefredakteure sehen keine Rinde, sondern die Blätter – falls sie vom 20. oder 30. Stock aus überhaupt noch Bäume sehen. Die Daily Post, Chicagos viertgrößte Zeitung, arbeitet von einem Vorort aus und hat daher jede Menge Platz, um sich auszubreiten. Über drei Etagen, in alle Richtungen, ohne die benachbarten Teppichhändler und Lampengeschäfte zu stören. Ein Bauunternehmer hatte diese Siedlung zwischen 1961 und 1964 errichtet und nach seiner Tochter benannt, die einen Monat vor Fertigstellung einen schweren Reitunfall erlitt. Aurora Springs sollte die Siedlung heißen, er posierte sogar neben dem nagelneuen Ortsschild. Danach verschwand er samt seiner Familie. Die Tochter ist heute über fünfzig, gesund bis auf ein gelegentliches Kribbeln in den Armen und kommt dann und wann von Arizona her, um sich mit ihrem Namensschild fotografieren zu lassen.
Ich habe die Story bei ihrem letzten Besuch geschrieben. Curry fand sie furchtbar, weil er Geschichten aus dem wahren Leben fast immer furchtbar findet. Er besoff sich mit Chambord-Likör, während er den Artikel las, worauf meine ganze Story nach Himbeeren roch. Curry besäuft sich leise, dafür aber umso öfter. Das Trinken ist allerdings nicht der Grund für seinen Weltschmerz, er hatte im Leben einfach Pech gehabt.
Ich ging in sein Büro und machte die Tür zu. Ich hatte mir das Büro eines Chefredakteurs immer ganz anders vorgestellt. Ich sehnte mich nach eichengetäfelten Wänden und einer Tür mit Glasscheibe, auf der sein Name stand. Durch die man von außen sehen konnte, wie ich mit ihm über die Pressefreiheit stritt. Currys Büro hingegen ist nichtssagend und nüchtern wie das ganze übrige Gebäude. Hier könnten ebenso gut Arztpraxen beheimatet sein, in denen Krebsabstriche gemacht werden.
»Erzähl mir von Wind Gap.« Curry bohrte die Spitze eines Kugelschreibers in sein graues Stoppelkinn. Ich sah das winzige blaue Pünktchen, das er hinterlassen würde, förmlich vor mir.
Rasch kramte ich die Fakten zusammen. »Es liegt im äußersten Südosten von Missouri, dem so genannten ›Stiefelabsatz‹. Man kann praktisch nach Tennessee und Arkansas spucken.« Curry genoss es, Reporter zu allen möglichen Themen in die Mangel zu nehmen, wenn es ihm zweckdienlich erschien – die jährliche Mordrate von Chicago, die demographische Entwicklung von Cook County oder, wie jetzt, die Geschichte meiner Heimatstadt, über die ich gar nicht gerne spreche. »Den Ort gibt es etwa seit dem Bürgerkrieg«, fuhr ich fort. »Er liegt am Mississippi und hatte früher einen ziemlich bedeutenden Hafen. Heute leben die meisten Leute von der Schweinezucht. Um die 2000 Einwohner. Alter Geldadel und Abschaum.«
»Und was bist du?«
»Ich bin Abschaum. Von altem Geldadel.« Ich lächelte. Er runzelte die Stirn.
»Und was zum Teufel ist da so los?«
Ich ging im Geiste die verschiedenen Katastrophen durch, die über Wind Gap hereingebrochen sein könnten. Es ist eins dieser lausigen Kaffs, die das Unglück förmlich anziehen: Busunfall oder Wirbelsturm, Explosion im Silo oder Kleinkind im Brunnen. Eigentlich war ich ein bisschen beleidigt. Denn ich hatte wie immer, wenn Curry mich in sein Büro rief, gehofft, er werde mir zu einem Artikel gratulieren, mir ein interessanteres Ressort geben oder eine Gehaltserhöhung anbieten. Auf eine Plauderei über die jüngsten Vorfälle in Wind Gap war ich nun gar nicht vorbereitet.
»Preaker, deine Mutter wohnt noch da, oder?«
»Mutter und Stiefvater.« Dazu eine Halbschwester, die geboren wurde, als ich schon studierte, und deren Existenz mir so unwirklich erscheint, dass ich meistens ihren Namen vergesse. Amma. Und dann natürlich Marian, die längst von uns gegangene Marian.
»Na schön, wann hast du zuletzt mit ihnen gesprochen?« An Weihnachten: ein eisiger Höflichkeitsanruf, nachdem ich mir drei Gläser Bourbon genehmigt hatte. Ich fürchtete, meine Mutter könnte es durch die Telefonleitung riechen.
»Schon länger nicht mehr.«
»Herrgott nochmal, Preaker, lies doch endlich mal, was von den Agenturen kommt. Ein kleines Mädchen wurde dort erdrosselt, letzten August, glaube ich.«
Ich nickte, als wüsste ich Bescheid. Aber es war gelogen. Meine Mutter war der einzige Mensch in Wind Gap, mit dem ich so etwas wie Kontakt pflegte, und sie hatte mir nichts davon gesagt. Eigenartig.
»Jetzt wird wieder eins vermisst. Klingt nach einem Serientäter. Fahr runter und schreib die Story. Aber schnell. Morgen früh bist du da.«
Nur über meine Leiche. »Curry, wir haben hier oben genügend Horrorgeschichten.«
»Klar, und drei Konkurrenzblätter mit doppelt so viel Geld und Personal. Ich hab’s satt, immer bei den heißen Themen leer auszugehen. Das ist unsere ganz große Chance.«
Curry glaubt, er müsse nur die richtige Story bringen, um Marktführer in Chicago zu werden und landesweiten Einfluss zu gewinnen. Letztes Jahr schickte eine Zeitung einen Reporter in dessen texanische Heimatstadt, wo einige Teenager beim Frühjahrshochwasser ertrunken waren. Er schrieb einen elegischen, aber gut recherchierten Artikel über das Wesen von Wasser und Trauer, über das Basketballteam, das seine drei besten Spieler verloren hatte, und den örtlichen Bestatter, der wegen seiner mangelnden Erfahrung im Herrichten von Ertrunkenen verzweifelt war. Die Story gewann den Pulitzer-Preis.
Ich wollte nicht hinfahren. Wehrte mich so sehr dagegen, dass ich mich an die Sessellehnen klammerte, als müsste Curry mich notfalls mit Gewalt losreißen. Er betrachtete mich aus wässrigen haselnussbraunen Augen. Räusperte sich, warf einen Blick auf das Foto seiner Frau und lächelte wie ein Arzt, der einem etwas Schlimmes mitteilen muss. Curry tobt gerne, weil es zu seinem Bild vom Chefredakteur alter Schule passt, ist aber einer der anständigsten Menschen, die ich kenne.
»Hör mal, Kleines, wenn’s nicht geht, geht’s nicht. Aber es könnte dir gut tun. Eine Art Reinigung. Damit du wieder auf die Beine kommst. Ist eine verdammt gute Story – und die brauchen wir. Du brauchst sie.«
Curry hat mich immer unterstützt. Er sagt, ich sei seine beste Reporterin und hätte einen erstaunlichen Verstand. Seit nunmehr zwei Jahren enttäusche ich seine Erwartungen. War manchmal ein richtiger Reinfall.
Ich konnte förmlich spüren, wie er mich innerlich drängte, ihm zu vertrauen. Ich nickte, zuversichtlich, wie ich hoffte.
»Ich gehe packen.« Meine Hände hinterließen verschwitzte Abdrücke auf den Lehnen.
Ich besitze keine Haustiere, die versorgt, und keine Pflanzen, die von Nachbarn gegossen werden müssen. Zu meiner eigenen Beruhigung stopfte ich Klamotten für fünf Tage in einen Matchsack und hoffte, dass ich spätestens Ende der Woche wieder aus Wind Gap verschwinden könnte. Als ich mich noch einmal umsah, traf mich die Erkenntnis wie ein Blitz: Meine Wohnung sah aus wie eine Studentenbude – billig, provisorisch und ziemlich farblos. Ich nahm mir fest vor, mir als Belohnung für die tolle Story, die ich ausgraben würde, ein vernünftiges Sofa anzuschaffen.
Auf dem Tisch neben der Tür stand ein Teenagerfoto von mir, auf dem ich Marian auf dem Arm halte. Sie ist etwa sieben. Wir lachen beide. Sie hat die Augen überrascht aufgerissen, während ich meine zukneife. Ich drücke sie an mich, ihre mageren Beine baumeln vor meinen Knien. Ich weiß nicht mehr, worüber wir lachen. Im Laufe der Zeit ist ein schönes Geheimnis daraus geworden. Ich glaube, es ist mir lieber so.
Ich dusche nie. Ich bade. Ich kann den Wasserstrahl nicht aushalten, er lässt meine Haut summen, als hätte jemand einen Schalter gedrückt. Also stopfte ich ein dünnes Hotelhandtuch in den Abfluss der Dusche, richtete den Duschkopf gegen die Wand und hockte mich in eine Pfütze von knapp zehn Zentimetern Tiefe.
Kein zweites Handtuch, also rannte ich zum Bett und trocknete mich mit der billigen Flauschdecke ab. Dann trank ich warmen Bourbon und verfluchte die defekte Eismaschine.
Wind Gap liegt etwa elf Stunden südlich von Chicago. Curry war so großzügig gewesen, mir eine Übernachtung im Motel und ein Frühstück zu bezahlen, falls ich an einer Tankstelle aß. In Wind Gap würde ich dann bei meiner Mutter wohnen. Das hatte er für mich entschieden. Ich wusste schon, wie sie reagieren würde, wenn ich bei ihr auftauchte. Ein rasches, schockiertes Erröten, die Hand zur Frisur, eine ungeschickte Umarmung. Sie würde sich für die Unordnung im Haus entschuldigen, das gar nicht unordentlich war. Und mit höflichen Umschreibungen danach fragen, wie lange ich zu bleiben gedachte.
»Wie lange haben wir das Vergnügen, Liebes?«
Übersetzt: »Wann fährst du wieder?«
Die Höflichkeit war am schlimmsten.
Eigentlich sollte ich mir Notizen machen, mich vorbereiten, Fragen entwerfen. Stattdessen trank ich weiter Bourbon, warf Aspirin hinterher, schaltete das Licht aus. Das feuchte Schnurren der Klimaanlage und das elektronische Piepsen eines Videospiels nebenan schläferten mich ein. Ich war nur dreißig Meilen von meiner Heimatstadt entfernt, brauchte aber eine letzte Nacht mit mir allein.
Am Morgen verschlang ich einen alten Donut mit Gelee und fuhr weiter nach Süden. Es wurde heißer, der Wald beiderseits der Straße dichter und üppiger. Dieser Teil von Missouri ist seltsam flach – meilenweit öde Bäume, nur unterbrochen vom schmalen Band des Highways. Immer die gleiche Aussicht.
Aus der Ferne kann man Wind Gap nicht erkennen, da das höchste Gebäude nur zweigeschossig ist. Doch nach zwanzig Minuten wusste ich, was kam. Zuerst tauchte eine Tankstelle auf. Davor eine Gruppe gelangweilter, magerer Halbwüchsiger mit nacktem Oberkörper. Ein Kleinkind in Pampers warf mit beiden Händen Schotter in die Luft, während seine Mutter ihren alten Pick-up betankte. Sie hatte die Haare goldblond gefärbt, doch sie waren fast bis zu den Ohren braun nachgewachsen. Sie rief den Jungs etwas zu, das ich im Vorbeifahren nicht verstehen konnte. Bald darauf wurde der Wald lichter. Ich kam an einem winzigen Einkaufszentrum mit Sonnenstudio, Waffengeschäft und Stoffhandlung vorbei. Es folgte eine einsame Sackgasse mit alten Häusern, Teil einer Siedlung, die nie fertiggestellt worden war. Und dann erreichte ich die eigentliche Stadt.
Ich hielt unwillkürlich die Luft an, als ich am Willkommensschild vorbeifuhr, so wie Kinder es an Friedhöfen tun. Seit acht Jahren war ich nicht mehr hier gewesen, aber diese Szenerie erkannte ich im Schlaf. Am Ende jener Straße wohnte meine Klavierlehrerin aus der Grundschule, eine ehemalige Nonne, die aus dem Mund nach Eiern roch. Der Weg dort drüben führte zu einem winzigen Park, in dem ich an einem schwitzig heißen Sommertag meine erste Zigarette geraucht hatte. Dort ging es nach Woodberry und zum Krankenhaus.
Zunächst wollte ich zur Polizeiwache am Ende der Main Street, die einzige Straße in ganz Wind Gap, die diesen Namen verdient. Dort findet man einen Schönheitssalon und eine Eisenwarenhandlung, einen Billigladen und eine Bücherei mit ungefähr zwölf Regalen. Ein Bekleidungsgeschäft namens Candy’s Casuals, in dem man Pullover, Rollis und Sweatshirts kaufen kann, die mit Enten und Schulgebäuden bedruckt sind. Die meisten netten Frauen von Wind Gap sind Lehrerinnen, Mütter oder arbeiten in Läden wie Candy’s Casuals. In einigen Jahren wird es sicher auch ein Starbucks geben, das der Stadt endlich die lang ersehnte, vorgefertigte Mainstream-Coolness bringt. Doch bislang gibt es auf der Main Street nur ein schmuddliges Café, das von einer Familie geführt wird, deren Name mir entfallen ist.
Die Hauptstraße lag verlassen da. Keine Autos, keine Leute. Ein Hund trottete den Gehweg entlang. An sämtlichen Laternenpfählen hingen gelbe Bänder und körnige Fotos eines Mädchens. Ich parkte und schälte einen Zettel ab, den wohl ein Kind schief an ein Stoppschild geklebt hatte. Er war handgeschrieben. »Vermisst« stand in fetten Buchstaben darüber, die mit Textmarker ausgemalt waren. Auf dem Foto war ein dunkeläugiges Mädchen mit katzenhaftem Lächeln und üppigem Haarschopf zu sehen. Der Typ Mädchen, den Lehrer gern als »schwierig« bezeichnen. Mir gefiel sie.
Natalie Jane Keene
Alter: 10
Vermisst seit dem 11.5.
Zuletzt gesehen im Jacob J. Garrett-Park
in blauen Jeansshorts und rotgestreiftem T-Shirt
Hinweise: 588–7377
Ich hatte gehofft, dass man mir auf der Polizeiwache sagen würde, dass Natalie Jane wohlbehalten gefunden worden sei. Dass sie sich bloß verlaufen oder im Wald den Knöchel verstaucht habe oder von zu Hause weggelaufen sei, sich dann aber eines Besseren besonnen habe. Dann wäre ich einfach ins Auto gestiegen und sofort wieder nach Chicago zurückgefahren und hätte kein Wort mehr darüber verloren.
Doch wie sich herausstellte, waren die Straßen deshalb so verlassen, weil die halbe Stadt die Wälder nördlich von Wind Gap absuchte. Chief Bill Vickery würde bald zur Mittagspause zurückkehren. Im Warteraum war es heimelig wie in einer Zahnarztpraxis. Ich hockte auf dem letzten orangefarbenen Sitz der Reihe und blätterte in Redbook. Ein elektrischer Lufterfrischer verströmte zischend seinen Plastikduft, der an eine Landbrise erinnern sollte. Dreißig Minuten später hatte ich drei Zeitschriften durch und konnte den Geruch nicht mehr ertragen. Als Vickery endlich hereinkam, nickte die Empfangsdame zu mir hinüber und flüsterte ebenso eifrig wie verächtlich: »Von der Zeitung.«
Vickery, ein schlanker Typ von Anfang fünfzig, hatte seine beigefarbene Uniform durchgeschwitzt. Das Hemd klebte am Oberkörper, die Hose beulte sich, wo der Hintern hätte sein sollen.
»Zeitung?« Er starrte mich über seine Bifokalbrille an. »Von welcher Zeitung?«
»Chief Vickery, ich heiße Camille Preaker und arbeite in Chicago für die Daily Post.«
»Chicago? Warum kommen Sie von so weit her?«
»Ich würde gern mit Ihnen über die Mädchen sprechen – Natalie Keene und das andere Mädchen, das letztes Jahr ermordet wurde.«
»Herrgott nochmal, wie haben Sie denn davon Wind bekommen?«
Er sah die Empfangsdame an, dann wieder mich, als hätten wir uns gegen ihn verschworen. Schließlich bedeutete er mir, ihm zu folgen. »Keine Anrufe, Ruth.«
Die Empfangsdame verdrehte die Augen.
Bill Vickery ging vor mir her durch einen holzgetäfelten Flur, den schachbrettartig aufgehängte Fotos von Forellen und Pferden in billigen Rahmen säumten. Sein Büro war klein, quadratisch, fensterlos, mit Metallregalen. Er setzte sich und zündete sich eine Zigarette an, ohne mir eine anzubieten.
»Ich will nicht, dass das bekannt wird, Miss. Das lasse ich auf keinen Fall zu.«
»Bedauere, Chief Vickery, aber Sie haben keine Wahl. Es sind Kinder in Gefahr, das sollte die Öffentlichkeit wissen.« Diesen Ansatz hatte ich mir unterwegs überlegt, um mich ins rechte Licht zu rücken.
»Was geht Sie das an? Es sind doch nicht Ihre Kinder, sondern Kinder aus Wind Gap.« Er stand auf, setzte sich wieder, räumte Papiere um. »Es ist wohl kaum gelogen, wenn ich behaupte, dass sich in Chicago noch nie einer für die Kinder in Wind Gap interessiert hat.« Seine Stimme brach beim letzten Wort. Er zog an seiner Zigarette, drehte den dicken Goldring, den er am kleinen Finger trug, blinzelte hektisch. Ich fragte mich, ob er gleich in Tränen ausbrechen würde.
»Vermutlich haben Sie recht. Ich will die Sache nicht ausschlachten, aber sie ist mir wichtig. Falls es Sie interessiert, ich komme selbst aus Wind Gap.« Na bitte, Curry, ich gebe mir alle Mühe.
Der Chief glotzte mich an.
»Wie heißen Sie doch gleich?«
»Camille Preaker.«
»Und wieso kenne ich Sie nicht?«
»Hatte noch nie Probleme mit der Polizei, Sir.« Ich deutete ein Lächeln an.
»Ihre Familie heißt also Preaker?«
»Meine Mutter hat vor fünfundzwanzig Jahren wieder geheiratet. Adora und Alan Crellin.«
»Ach, die kenne ich.« Klar, die kannte hier jeder. Geld, richtig altes Geld, war selten in Wind Gap. »Aber ich will Sie trotzdem nicht hier haben, Miss Preaker. Wenn Sie die Story drucken, bringt man uns für immer mit … mit dem hier in Verbindung.«
»Vielleicht würde ein bisschen Publicity ja bei der Suche helfen«, sagte ich. »Soll vorkommen.«
Vickery saß ganz still da und betrachtete seine zerknüllte Essenstüte. Sie roch nach Mortadella. Er murmelte etwas, von dem ich nur die Worte »JonBenet« und »Scheiße« verstand.
»Nein danke, Miss Preaker. Ansonsten kein Kommentar. Ich habe nichts über die laufenden Ermittlungen zu sagen. Das können Sie gern zitieren.«
»Sie wissen, es ist mein Recht, hier zu sein. Machen wir es uns doch nicht so schwer. Geben Sie mir irgendeine Information, dann lasse ich Sie eine Weile in Ruhe. Ich will Ihnen nicht im Weg stehen, aber ich muss auch meine Arbeit tun.« Diesen Satz hatte ich mir auf der Höhe von St. Louis überlegt.
Ich verließ die Polizeiwache mit einer fotokopierten Karte von Wind Gap, auf der Chief Vickery mit einem winzigen X den Ort markiert hatte, an dem im vergangenen Jahr die Mädchenleiche gefunden worden war.
Ann Nash, zehn Jahre, wurde am 27. August im Falls Creek entdeckt, einem steinigen, laut dahinrauschenden Bach, der mitten durch die North Woods fließt. Ein Suchtrupp hatte seit dem Vorabend den Wald durchkämmt, doch es waren Jäger, die sie gegen fünf Uhr morgens fanden. Sie war gegen Mitternacht mit einer Wäscheleine erdrosselt worden, die zweimal um ihren Hals geschlungen war. Danach hatte man sie in den Bach geworfen, der wegen der sommerlichen Trockenheit wenig Wasser führte. Die Wäscheleine hatte sich an einem großen Felsen verfangen, und das Mädchen war die Nacht über im trägen Wasser dahingetrieben. Sie wurde im geschlossenen Sarg aufgebahrt. Mehr wollte Vickery nicht sagen. Und ich hatte eine geschlagene Stunde gebraucht, um das bisschen aus ihm herauszubekommen.
Vom Münztelefon in der Bücherei rief ich die Nummer auf dem Suchplakat an. Eine ältere Frauenstimme meldete sich mit den Worten »Natalie Keene Hotline«, doch ich hörte im Hintergrund den Geschirrspüler rauschen. Sie teilte mir mit, dass die Suche in den North Woods ihres Wissens noch im Gange sei. Wer helfen wolle, solle sich auf der Hauptzufahrtsstraße melden und Trinkwasser mitbringen. Man erwarte Höchsttemperaturen.
Am Suchstützpunkt saßen vier blonde Mädchen steif auf einer Picknickdecke. Sie deuteten auf einen Waldweg, den ich entlanggehen sollte, bis ich den Suchtrupp gefunden hätte.
»Was machen Sie denn hier?«, fragte die Hübscheste. Ihr gerötetes Gesicht war rundlich wie das eines ganz jungen Mädchens, und sie hatte die Haare mit Bändern zu Zöpfen gebunden, doch die Brüste, die sie stolz nach vorn reckte, waren die einer erwachsenen Frau. Einer glücklichen erwachsenen Frau. Sie lächelte, als würden wir uns kennen, was unmöglich sein konnte. Als ich das letzte Mal hier war, musste sie noch im Kindergarten gewesen sein, und doch kam sie mir irgendwie vertraut vor. Vielleicht die Tochter einer alten Schulfreundin. Das Alter könnte hinkommen, falls sie gleich nach der Schule schwanger geworden wäre. Was nicht auszuschließen war.
»Ich wollte nur helfen.«
»Okay«, meinte sie grinsend und entließ mich, indem sie sich ganz darauf konzentrierte, den Lack von einem Zehennagel abzukratzen.
Ich schlug den Waldweg ein, der Schotter knirschte unter meinen Füßen, und inmitten der Bäume schien es tatsächlich noch wärmer zu sein. Die Luft war dschungelfeucht. Goldrute und Lorbeersumach streiften meine Knöchel, und überall schwebten weiße Pappelsamen, stahlen sich in meinen Mund, hafteten an meinen Armen. Plötzlich fiel mir ein, dass wir sie früher Feenkleidchen genannt hatten.
In der Ferne hörte ich Leute nach Natalie rufen, die drei Silben hoben und senkten sich wie ein Lied. Noch zehn Minuten Fußmarsch, dann hatte ich sie entdeckt: etwa fünfzig Menschen, die sich in langen Reihen vorwärts bewegten und das Unterholz mit Stöcken abtasteten.
»Hallo? Gibt’s was Neues?«, rief ein Mann mit Bierbauch, der ganz in meiner Nähe stand. Ich verließ den Pfad und ging zu ihm hinüber.
»Kann ich helfen?« Ich war noch nicht so weit, dass ich einfach das Notizbuch zücken konnte.
»Sie können hier neben mir gehen«, sagte er. »Helfer können wir immer gebrauchen. Je mehr Augen, desto besser.« Ein paar Minuten schritten wir schweigend nebeneinander. Der Mann räusperte sich bisweilen mit einem feuchten, kollernden Husten.
»Manchmal denke ich, wir sollten den Wald einfach niederbrennen«, sagte er unvermittelt. »Hier passiert nichts Gutes. Sind Sie mit den Keenes befreundet?«
»Eigentlich bin ich von der Zeitung. Chicago Daily Post.«
»Hm … Na so was. Und Sie schreiben über das hier?«
Plötzlich erscholl ein lautes Heulen, ein Mädchen schrie: »Natalie!« Meine Hände schwitzten, als wir auf den Schrei zurannten. Menschen taumelten uns entgegen. Ein junges Mädchen mit weißblondem Haar stieß uns beiseite, das Gesicht rot und geschwollen. Es wankte wie betrunken und brüllte immer wieder Natalies Namen zum Himmel empor. Ein älterer Mann, vielleicht der Vater, nahm sie in die Arme und führte sie zurück zur Straße.
»Hat man sie gefunden?«, rief mein Suchpartner.
Allgemeines Kopfschütteln. »Hat sich wohl nur erschrocken«, meinte ein anderer Mann. »War zu viel für sie. Mädchen sollten hier sowieso nicht mitmachen.« Er schaute mich nachdrücklich an, nahm die Baseballkappe ab, um sich die Stirn abzuwischen, und blickte wieder zu Boden.
»Traurige Arbeit«, meinte mein Partner. »Traurige Zeiten.« Wir bewegten uns langsam vorwärts. Ich trat eine verrostete Bierdose beiseite. Und noch eine. Ein einzelner Vogel flog auf Augenhöhe vorüber und stieß steil nach oben in die Wipfel. Ein Grashüpfer landete auf meinem Handgelenk. Ein unheimlicher Zauber.
»Würden Sie mir etwas über die Sache erzählen?« Ich winkte mit meinem Notizbuch.
»Wüsste nicht, was ich Ihnen sagen soll.«
»Nur was Sie so denken. Zwei Mädchen in einer Kleinstadt …«
»Niemand weiß, ob das eine mit dem anderen zu tun hat, oder? Außer Sie wissen mehr als ich. Wir gehen davon aus, dass Natalie putzmunter wieder auftaucht. Ist ja noch keine zwei Tage her.«
»Gibt es irgendwelche Theorien über Ann?«
»Muss ein Verrückter gewesen sein. Ein Typ auf der Durchreise, der seine Pillen nicht genommen hat oder der Stimmen hört. So in der Art.«
»Wie kommen Sie darauf?«
Er blieb stehen, holte ein Päckchen Kautabak aus der Gesäßtasche, schob sich einen dicken Priem in den Mund und kaute, bis der erste kleine Riss den Tabak freisetzte. Mein eigener Mund prickelte vor Mitgefühl.
»Warum sonst sollte jemand einem toten Mädchen alle Zähne ziehen?«
»Er hat ihr die Zähne gezogen?«
»Alle, bis auf den hinteren Teil eines Milchbackenzahns.«
Nach einer weiteren ergebnislosen Stunde, in der ich wenig Neues erfuhr, trennte ich mich von meinem Suchpartner Ronald Kamens und ging nach Süden zu der Stelle, an der man im letzten Jahr Anns Leiche gefunden hatte. Es dauerte eine Viertelstunde, bis Natalies Name verklungen war. Weitere zehn Minuten, und ich konnte das helle Rauschen des Falls Creek hören.
Ein Kind durch diesen Wald zu tragen wäre nicht leicht. Äste und Laub lagen auf dem Weg, Wurzeln ragten aus dem Boden. Falls Ann ein typisches Mädchen aus Wind Gap gewesen war, einer Stadt, die von ihren Frauen größtmögliche Weiblichkeit verlangte, hatte sie ihr Haar lang und offen getragen, so dass es sich in den Zweigen verfangen hätte. Für mich sah jede Spinnwebe aus wie eine schimmernde Strähne.
Dort, wo man die Leiche entdeckt hatte, war das Gras noch flachgedrückt von der Spurensuche. Ich sah ein paar frischere Zigarettenkippen, die Neugierige hinterlassen hatten. Gelangweilte Jugendliche, die einander mit einem Verrückten erschreckten, der eine Spur aus blutigen Zähnen hinterließ.
Im Bach hatten große Steine gelegen, an denen sich die Wäscheleine verfangen hatte, so dass Ann die halbe Nacht wie eine Gehenkte im Wasser trieb. Nun floss der Bach geschmeidig in seinem Bett aus Sand. Mr. Ronald Kamens hatte mir stolz erzählt, dass die Leute von Wind Gap die Steine herausgehebelt, auf einen Laster geladen und draußen vor der Stadt zerschlagen hatten. Ein ergreifendes Glaubensbekenntnis, als könnte dieser Akt der Zerstörung weiteres Unheil fernhalten. Vergeblich, wie ich befürchtete.
Ich setzte mich ans Ufer des Bachs und fuhr mit den Handflächen über den steinigen Boden. Hob einen glatten, heißen Kiesel auf und drückte ihn an die Wange. Ich fragte mich, ob Ann je hergekommen war, als sie noch lebte. Vielleicht hatten die Kinder von Wind Gap inzwischen einen interessanteren Zeitvertreib für lange Sommertage gefunden.
Als ich noch ein Kind war, gingen wir weiter flussabwärts schwimmen, wo riesige Tafelfelsen flache Teiche bildeten. Flusskrebse zuckten zwischen unseren Füßen hindurch, und wir stürzten uns auf sie und kreischten, wenn wir tatsächlich einen berührten. Keiner trug einen Badeanzug, alles lief spontan. Wir schüttelten uns wie nasse Hunde und radelten in klatschnassen Shorts und Tops nach Hause.
Gelegentlich kamen ältere Jungs mit Schrotflinten und gestohlenem Bier vorbei, die Gleithörnchen oder Hasen schießen wollten. Sie trugen blutige Fleischbrocken am Gürtel. Sie waren frech, besoffen und stanken nach Schweiß, ignorierten uns auf geradezu aggressive Weise, und ich hatte echten Respekt vor ihnen. Heute weiß ich, dass es verschiedene Typen von Jägern gibt. Der Gentlemanjäger, der von Teddy Roosevelt und der großen Beute träumt, der sich nach einem Tag auf der Pirsch bei einem steifen Gin Tonic entspannt, ist nicht der Typ Jäger, den ich als Kind erlebte. Die Jungs, die ich kannte, waren auf Blut aus. Sie gierten nach dem tödlichen Zucken, das ein von Schrot durchsiebtes Tier durchfuhr, ein Tier, das eben noch geschmeidig dahingeglitten war und durch ihre Kugel nun abrupt zur Seite geschleudert wurde.
Als ich ungefähr zwölf war, schlich ich mich mal in den Jagdschuppen eines Nachbarjungen, in dem die Tiere abgezogen und zerlegt wurden. Streifen von feuchtem, rosigem Fleisch baumelten zum Trocknen an Leinen. Der Lehmboden war rostrot vom Blut. Die Wände mit Aktfotos tapeziert. Manche Frauen hatten die Beine weit gespreizt, andere wurden von Männern niedergedrückt, die in sie eindrangen. Eine Frau mit glasigen Augen und prallen, geäderten Brüsten war gefesselt, ein Mann nahm sie von hinten. Ich konnte sie alle in der dicken, blutgetränkten Luft förmlich riechen.
An jenem Abend schob ich einen Finger in meinen Slip und masturbierte zum ersten Mal, keuchend und von Ekel erfüllt.
Happy Hour. Ich gab die Suche auf und schaute bei Footh’s, einer einfachen Landkneipe, hinein, bevor ich in die Grove Street 1665 fuhr. Zum Haus von Betsy und Robert Nash, den Eltern von Ashleigh (dreizehn), Tiffanie (elf), der verstorbenen Ann (auf ewig neun) und des sechsjährigen Bobby Junior.
Drei Mädchen, dann endlich der kleine Junge. Während ich meinen Bourbon schlürfte und Erdnüsse knackte, dachte ich, wie zunehmend verzweifelt die Nashs gewesen sein mussten, wenn wieder ein Kind ohne Penis herausgeflutscht war. Zuerst Ashleigh, kein Junge, aber reizend und gesund. Sie hatten sich ohnehin zwei Kinder gewünscht. Ashleigh bekam einen ausgefallenen Namen mit extravaganter Schreibweise und einen Schrank voller Prinzessinnenkleidchen. Sie hofften das Beste und versuchten es noch einmal, heraus kam Tiffanie. Allmählich wurden sie nervös, der Empfang fiel schon weniger triumphal aus. Als Mrs. Nash erneut schwanger war, kaufte ihr Mann einen winzigen Baseballhandschuh, um dem Klümpchen in ihrem Bauch den Dreh in die richtige Richtung zu geben. Man stelle sich die rechtschaffene Empörung vor, als Ann geboren wurde. Sie verpassten ihr den Namen irgendeiner Verwandten – sogar ohne schmückendes »e« am Ende.
Dann kam zum Glück Bobby. Drei Jahre nach der Enttäuschung mit Ann – Unfall oder letzter Versuch? – erhielt Bobby den Namen seines Vaters und wurde gehätschelt und getätschelt, worauf die kleinen Mädchen sehr schnell begriffen, wie unbedeutend sie waren. Vor allem Ann. Wer braucht schon drei Töchter? Wenigstens bekam sie nun, da sie tot war, ein bisschen Aufmerksamkeit.
Ich kippte meinen zweiten Bourbon in einem einzigen Schluck, lockerte die Schultern, klopfte mir auf die Wangen und stieg in meinen großen blauen Buick. Ich hätte gern noch einen getrunken. In der Privatsphäre anderer herumzuschnüffeln ist nicht mein Ding. Wer gibt mir das Recht dazu? Vermutlich bin ich deswegen eine zweitklassige Reporterin. Eine von vielen auf jeden Fall.
Den Weg zur Grove Street kenne ich noch. Sie liegt zwei Blocks hinter meiner Highschool, die alle Kinder im Umkreis von siebzig Meilen besuchen. Die Millard Calhoon H.S. wurde 1930 gegründet und symbolisierte Wind Gaps letztes finanzielles Aufbäumen vor der Depression. Sie war nach dem ersten Bürgermeister der Stadt, einem Bürgerkriegshelden, benannt. Einem konföderierten Helden, aber Held blieb Held. Im letzten Kriegsjahr hielt Mr. Calhoon in Lexington allein gegen einen Trupp Yankees die Stellung und rettete so die kleine Stadt in Missouri. (Steht jedenfalls auf der Plakette neben der Schultür.) Er eilte zwischen Bauerngehöften und sauber eingezäunten Häusern umher und scheuchte die Damen höflich hinein, damit sie den Yankees nicht in die Hände fielen. Wenn man heute nach Lexington kommt und sich das Calhoon-Haus anschauen möchte, wird man zu einem schönen Gebäude im typischen Stil seiner Zeit geführt, in dessen Brettern noch die Nordstaatlerkugeln stecken. Mr. Calhoons Südstaatlerkugeln wurden wohl mit den Männern begraben, die sie getötet hatten.
Calhoon selbst starb 1929, kurz vor seinem hundertsten Geburtstag. Er saß gerade in dem Pavillon auf dem Dorfplatz, den man inzwischen abgerissen hat, und ließ sich von einer großen Blaskapelle feiern, als er sich plötzlich mit den Worten »Mir ist das alles zu laut« an seine zweiundfünfzigjährige Frau lehnte und einen schweren Herzinfarkt erlitt. Er kippte samt Stuhl in die Teekuchen, die ihm zu Ehren mit Sternen und Streifen verziert waren, und verschmutzte seine schmucke Bürgerkriegsuniform.
Für Calhoon habe ich eine echte Schwäche. Manchmal ist mir auch alles zu laut.
Das Haus der Nashs war nicht weiter auffällig. Ein typisches Fertighaus, wie man sie Ende der 70er Jahre überall im Westen der Stadt erbaut hatte; eines dieser gemütlichen Gebäude im Ranchstil, bei denen die Garage der absolute Mittelpunkt ist. In der Einfahrt hockte ein schmutziger blonder Junge auf einem Dreirad, für das er viel zu groß war, und trat keuchend in die Pedale. Er kam nicht von der Stelle.
»Soll ich dich anschieben?«, fragte ich beim Aussteigen. Ich habe kein Händchen für Kinder, aber ein Versuch konnte nicht schaden. Er schaute mich schweigend an und steckte sich den Finger in den Mund. Sein ärmelloses T-Shirt war hochgerutscht, der runde Bauch lugte grüßend hervor. Bobby Junior sah dumm und verängstigt aus. Nicht gerade der Sohn, den sich die Nashs erhofft hatten.
Ich ging auf ihn zu. Er sprang vom Dreirad, das an ihm festklemmte, bis es krachend zu Boden fiel.
»Daddy!« Er rannte heulend zum Haus, als hätte ich ihn gekniffen.
Ein Mann erschien in der Haustür. Hinter ihm gurgelte ein dreistöckiger Zimmerbrunnen in Muschelform, auf dessen Spitze eine Jungenfigur kauerte. Selbst von draußen roch das Wasser alt.
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Sind Sie Robert Nash?«
Auf einmal wirkte er misstrauisch. Vermutlich hatte ihn die Polizei genau das Gleiche gefragt, als sie ihm die Nachricht vom Tod seiner Tochter überbrachte.
»Ja, was gibt’s?«
»Es tut mir leid, dass ich Sie zu Hause störe. Camille Preaker, ich komme aus Wind Gap.«
»Hm.«
»Inzwischen arbeite ich allerdings in Chicago für die Daily Post. Ich bin wegen Natalie Keene hier … und dem Mord an Ihrer Tochter.«
Ich war auf Gebrüll, Türenschlagen, Beschimpfungen, einen Boxhieb vorbereitet. Doch Bob Nash schob die Hände in die Hosentaschen und wippte auf den Fersen.
»Wir können im Schlafzimmer reden.«
Er hielt mir die Tür auf, und ich stieg über das Durcheinander im Wohnzimmer. Zerknitterte Laken und kleine T-Shirts quollen aus Wäschekörben. Ich ging vorbei an einem Badezimmer mit einer leeren Klopapierrolle mittendrin und durch einen Flur, der mit verblassenden Fotos unter schmieriger Folie gesprenkelt war: kleine blonde Mädchen, die sich liebevoll um ein schreiendes Baby drängten; ein junger Nash, den Arm steif um seine frisch angetraute Braut gelegt, während beide ein Kuchenmesser hielten. Im Schlafzimmer – Vorhänge mit passender Bettwäsche, ordentliche Kommode – begriff ich, warum Nash diesen Raum für unser Gespräch ausgewählt hatte. Es war das einzige Zimmer im ganzen Haus, das halbwegs zivilisiert wirkte, ein Außenposten am Rand des erbarmungslosen Dschungels.
Nash setzte sich auf eine Bettkante, ich auf die andere. Stühle gab es nicht. Wir hätten Darsteller in einem billigen Porno sein können, wenn man von dem Kirschgetränk absah, das Nash für uns angerührt hatte. Er selbst sah gepflegt aus: gestutzter Schnurrbart, schütteres, mit Gel geglättetes blondes Haar, ein leuchtend grünes Polohemd, das im Bund der Jeans steckte. Ich nahm an, dass er hier für Ordnung sorgte; der Raum wirkte schlicht und sauber wie der eines Junggesellen, der sich richtig angestrengt hat.
Zum Glück kam er gleich zur Sache. Nicht wie der Typ bei einer Verabredung, der erst Süßholz raspelt, obwohl es nur ums Bumsen geht.
»Ann ist im letzten Sommer dauernd Rad gefahren«, begann er von sich aus. »Immer um den Block. Weiter wollten meine Frau und ich sie nicht lassen. Sie war erst neun. Wir behüten unsere Kinder sehr. Aber gegen Ende der Ferien sagte meine Frau, na schön. Ann hatte so gejammert, dass sie ihr erlaubte, zu ihrer Freundin Emily zu fahren. Sie ist nie dort angekommen. Das wurde uns erst um acht Uhr klar.«
»Wann war sie losgefahren?«
»Gegen sieben. Emily wohnt zehn Straßen weiter, und irgendwo unterwegs haben die sie geschnappt. Das wird sich meine Frau nie verzeihen. Nie.«
»Warum sagen sie, die hätten sie geschnappt?«
»Die, er, egal. Das Schwein. Der kranke Mädchenmörder. Während meine Familie und ich schlafen, während Sie Ihre Artikel schreiben, läuft da draußen einer rum und sucht nach Kindern, die er töten kann. Wir beide wissen doch, dass die kleine Keene nicht einfach so verschwunden ist.«
Er kippte das Kirschgetränk in einem Zug hinunter und wischte sich den Mund ab. Die Kommentare waren gut, wenn auch zu glatt. Das kommt häufig vor und hängt eindeutig mit dem Fernsehkonsum der Leute zusammen. Vor einer Weile interviewte ich eine Frau, deren zweiundzwanzigjährige Tochter soeben von ihrem Freund ermordet worden war, und sie kam mir mit einem Satz, den ich zufällig am Abend vorher in einem Anwaltsfilm gehört hatte: Ich würde gern sagen, dass er mir leidtut, aber ich fürchte, ich werde nie wieder Mitleid empfinden können.
»Und Sie haben keine Vorstellung, wer Ihnen oder Ihrer Familie hätte schaden wollen, indem er Ann das antat?«
»Miss, ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, Stühle zu verkaufen, ergonomische Stühle – und zwar am Telefon. Ich sitze mit zwei Kollegen in einem Büro in Cape Hayti. Da komme ich keinem in die Quere. Meine Frau hat eine Halbtagsstelle in der Grundschule. Bei uns gibt es keine Familiendramen. Irgendjemand hat einfach beschlossen, unser kleines Mädchen zu töten.« Der letzte Satz klang resigniert, als hätte er diese Version akzeptiert.
Bob Nash öffnete die Schiebetür aus Glas, die auf eine winzige Terrasse führte, blieb aber im Zimmer stehen. »Vielleicht war’s ein Homo«, sagte er dann. In dieser Gegend war eine solche Wortwahl eine eher harmlose Umschreibung.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Er hat sie nicht vergewaltigt. Alle sagen, das sei bei einem solchen Fall ungewöhnlich. Es ist unser einziger Trost. Lieber tot als vergewaltigt.«
»Und es gab keinerlei Anzeichen für eine sexuelle Belästigung?«, fragte ich leise und sanft, wie ich hoffte.
»Nein. Auch keine blauen Flecken, Schnitte, Spuren von … von Folter. Er hat sie einfach erdrosselt. Und ihr die Zähne gezogen. Das war eben nicht so gemeint, von wegen lieber tot als vergewaltigt. War blöd von mir. Aber Sie wissen, was ich meine.«
Ich sagte nichts, sondern ließ den Kassettenrekorder weiter surren, hielt die Luft an. Das Eis in Nashs Glas klirrte. Nebenan spielten Leute im letzten Tageslicht Volleyball.
»Daddy?« Ein hübsches blondes Mädchen mit langem Pferdeschwanz spähte zur Tür herein.
»Jetzt nicht, Liebes.«
»Ich hab Hunger.«
»Du kannst dir was machen«, antwortete Nash. »Im Gefrierschrank sind Waffeln. Sieh zu, dass Bobby auch was isst.«
Das Mädchen zögerte, schaute auf den Teppich zu seinen Füßen und schloss dann leise die Tür. Ich fragte mich, wo die Mutter wohl sein mochte.
»Waren Sie zu Hause, als Ann an jenem Abend das Haus verließ?«
Er legte den Kopf schief und sog an seinen Zähnen. »Nein. Ich war auf dem Heimweg von Hayti. Eine Stunde Fahrt. Ich hab meiner Tochter nichts getan.«
»So war das nicht gemeint«, log ich. »Mich interessierte nur, ob Sie sie noch gesehen haben.«
»Ich habe sie an dem Morgen zuletzt gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob wir miteinander geredet haben. Wahrscheinlich nicht. Vier Kinder am Morgen sind ein bisschen viel.«
Nash ließ das Eis im Glas kreisen. Fuhr mit dem Finger unter seinem stachligen Schnurrbart entlang. »Bisher hat uns niemand geholfen. Vickery ist völlig überlastet. Sie haben einen super wichtigen Ermittler aus Kansas City geschickt. Noch jung, ziemlich von sich eingenommen. Sitzt hier bloß seine Zeit ab. Möchten Sie ein Bild von Ann?« Er holte ein Schulfoto aus der Brieftasche, auf dem ein Mädchen mit schiefem Lächeln zu sehen war. Das hellbraune Haar war unregelmäßig auf Kinnlänge geschnitten.
»Meine Frau wollte ihr am Abend vorher Wickler in die Haare drehen. Da hat Ann sie einfach abgeschnitten. War ein eigensinniges Ding. Ein Wildfang. Hat mich gewundert, dass man ausgerechnet sie geschnappt hat. Ashleigh war nämlich immer die Hübsche. Auf die die Leute gucken.« Er warf noch einen Blick auf das Foto. »Sie muss sich ganz schön gewehrt haben.«
Bevor ich ging, nannte Nash mir noch die Adresse der Freundin, die Ann an jenem Abend besuchen wollte. Ich fuhr langsam dorthin. Die Grundstücke, an denen ich vorbeikam, waren penibel quadratisch ausgerichtet. Hier im Westen von Wind Gap stehen die neueren Häuser, und der Rasen ist grüner, weil man ihn erst dreißig Jahre zuvor in Soden angeliefert und säuberlich ausgerollt hat. Er ist nicht so dunkel, steif und stachlig wie das Gras, das vor dem Haus meiner Mutter wächst. Auf diesen Halmen konnte man allerdings besser pfeifen. Man konnte sie in der Mitte teilen, drauf blasen und einen Quietschton erzeugen, bis die Lippen juckten.
Ann Nash hätte mit dem Rad ganze fünf Minuten bis zu ihrer Freundin gebraucht. Vielleicht fünfzehn, wenn sie einen Umweg gefahren wäre, um die erste Fahrt allein auch wirklich zu genießen. Mit neun ist man zu alt, um immer nur um denselben Block zu fahren. Was war aus dem Rad geworden?
Langsam rollte ich an dem Haus vorbei, in dem Emily Stone wohnte. Als der Abend blau erblühte, konnte ich ein Mädchen an einem erleuchteten Fenster vorbeilaufen sehen. Wetten, dass Emilys Eltern seitdem zu ihren Freunden sagten: »Wir drücken sie jetzt jeden Abend ein bisschen fester«? Wetten, dass Emily sich fragte, wohin man Ann zum Sterben gebracht hatte?
Ich jedenfalls fragte mich das. Es ist nicht leicht, einem Menschen über zwanzig Zähne auszureißen, so klein und leblos er auch sein mag. Es musste an einem besonderen Ort geschehen sein, einem sicheren Ort, an dem sich der Täter zwischendurch ausruhen konnte.
Ich schaute mir Anns Foto noch einmal an, dessen Ränder sich schützend zum Gesicht wölbten. Der trotzige Haarschnitt und das Grinsen erinnerten mich an Natalie. Dieses Mädchen hier gefiel mir auch. Ich steckte das Foto ins Handschuhfach. Dann schob ich meinen Ärmel hoch und schrieb mit blauem Kugelschreiber ihren vollen Namen – Ann Marie Nash – auf die Innenseite meines Arms.
Ich bog in keine Einfahrt, um zu wenden – die Leute waren nervös genug –, sondern fuhr an der nächsten Straße links und nahm einen Umweg zum Haus meiner Mutter. Ich überlegte, ob ich vorher anrufen sollte, ließ es aber bleiben. Zu spät am Abend und unnötig höflich. Hatte man erst die Staatsgrenze überquert, fragt man nicht mehr, ob man kurz hereinschneien kann.
Ihr stattliches Haus liegt im südlichen Zipfel von Wind Gap, dem reichen Teil der Stadt, falls man drei Häuserblocks als eigenen Stadtteil bezeichnen kann. Sie wohnt in einem riesigen Haus im viktorianischen Stil samt Dachbalkon, einer Veranda, die das ganze Haus umgibt, und einer Kuppel auf dem Dach. Hier bin ich aufgewachsen. Das Haus steckt voller Kämmerchen und Nischen und wirkt seltsam verwinkelt. Die Menschen des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Südstaatler, brauchten viel Platz, um einander aus dem Weg zu gehen, um Tuberkulose und Influenza zu vermeiden, gierigen Gelüsten zu widerstehen und sich vor schwülen Gefühlen zu schützen. Je mehr Platz, desto besser.
Das Haus liegt oben auf einer steilen Anhöhe. Man kann entweder im ersten Gang die Einfahrt hochkriechen und unter einem überdachten Anbau parken oder unten parken und die dreiundsechzig Stufen nehmen, die links von einem zigarrendünnen Geländer gesäumt werden. Als Kind stieg ich immer die Treppe hinauf und rannte die Einfahrt hinunter. Ich dachte, das Geländer sei nur deshalb auf der linken Seite angebracht, weil ich Linkshänderin bin. Wie vermessen von mir.
Ich parkte unten, um nicht aufdringlich zu erscheinen. Als ich nassgeschwitzt oben ankam, hob ich mein Haar, um mir den Nacken zu kühlen, und wedelte mit meiner Bluse. Vulgäre Schweißflecken auf blauem Grund. Ich roch deftig, wie meine Mutter zu sagen pflegte.
Früher hatte sich die Türklingel wie ein Katzenschrei angehört, jetzt klang sie gedämpft und seltsam abgehackt. Wie früher das Pling, das anzeigte, wenn man eine Märchenplatte umdrehen musste. Es war Viertel nach neun, gerade spät genug, um sie vielleicht schon aus dem Bett zu holen.
»Wer ist da, bitte?«, fragte meine Mutter mit schriller Stimme.
»Hi, Momma. Ich bin’s, Camille.« Ich versuchte, ruhig zu sprechen.
»Camille.« Sie öffnete die Tür und blieb auf der Schwelle stehen. Sie wirkte nicht überrascht und machte auch keine Anstalten, mich zu umarmen, nicht mal schlaff und lustlos wie sonst. »Ist was passiert?«
»Nein, Momma, alles klar. Ich habe beruflich hier zu tun.«
»Beruflich. Beruflich? Mein Gott, Liebes, tut mir leid, komm doch rein. Leider bin ich nicht auf Besucher eingerichtet.«
Das Haus war perfekt, bis hin zu den Vasen mit Dutzenden von Tulpen, die die Diele schmückten. Die Luft war so voller Pollen, dass mir die Augen tränten. Natürlich fragte meine Mutter nicht, welche beruflichen Angelegenheiten mich hergeführt hatten. Sie neigte ohnehin nicht zu tiefer gehenden Fragen. Entweder nahm sie übertriebene Rücksicht auf die Privatsphäre anderer Menschen oder interessierte sich einfach nicht für sie. Welche Alternative mir besser gefiel, kann sich jeder selbst überlegen.
»Möchtest du etwas trinken, Camille? Alan und ich nehmen gerade einen Amaretto sour.« Sie deutete auf das Glas in ihrer Hand. »Ich gebe ein bisschen Sprite dazu, das unterstreicht die Süße. Ich habe aber auch Mangosaft, Wein, Eistee oder Eiswasser. Oder Mineralwasser. Wo übernachtest du?«
»Jetzt, wo du mich fragst: Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte ein paar Tage bei euch bleiben.«
Pause. Ihre langen blassrosa Fingernägel klickten gegen das Glas. »Sicher, das ist in Ordnung. Warum hast du nicht angerufen, dann hätte ich Bescheid gewusst und dir etwas zum Abendessen gemacht. Sag Alan hallo. Wir sitzen hinten auf der Veranda.«