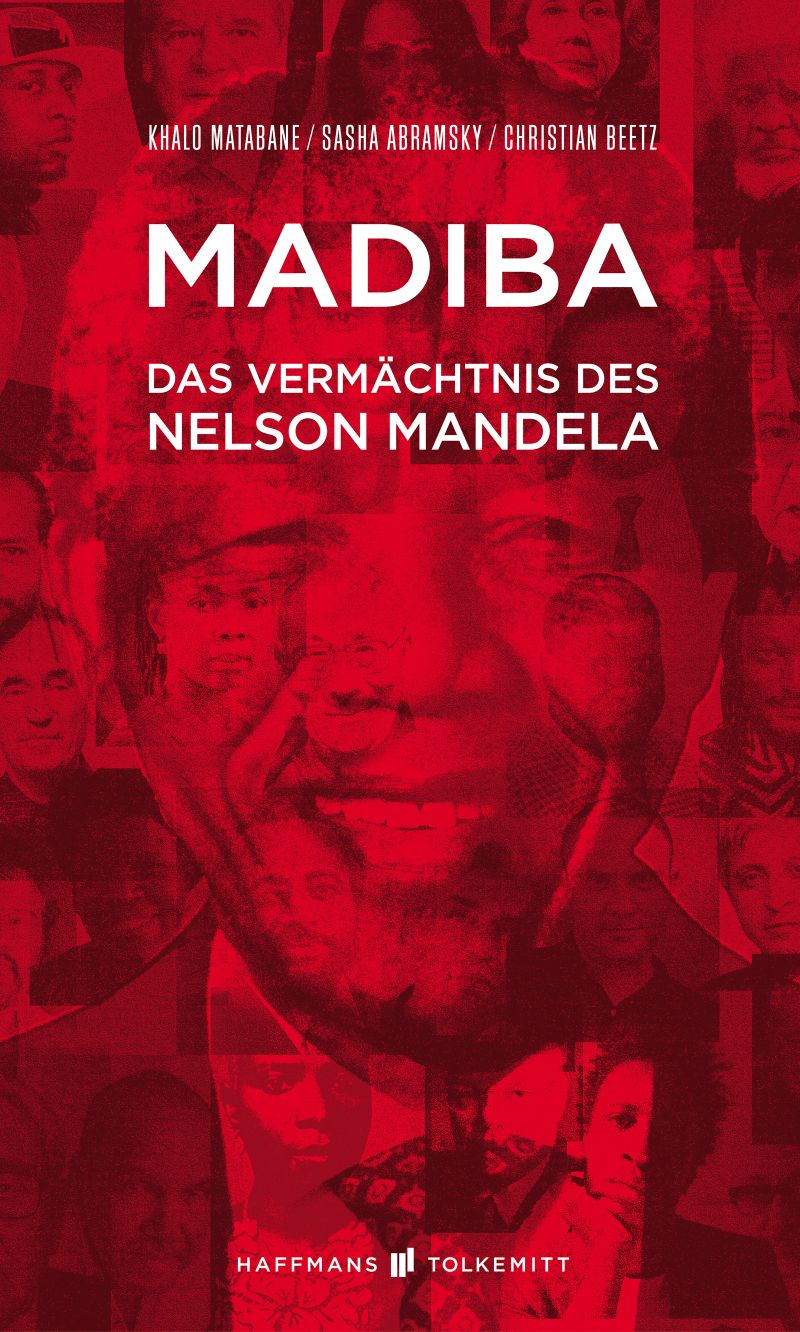
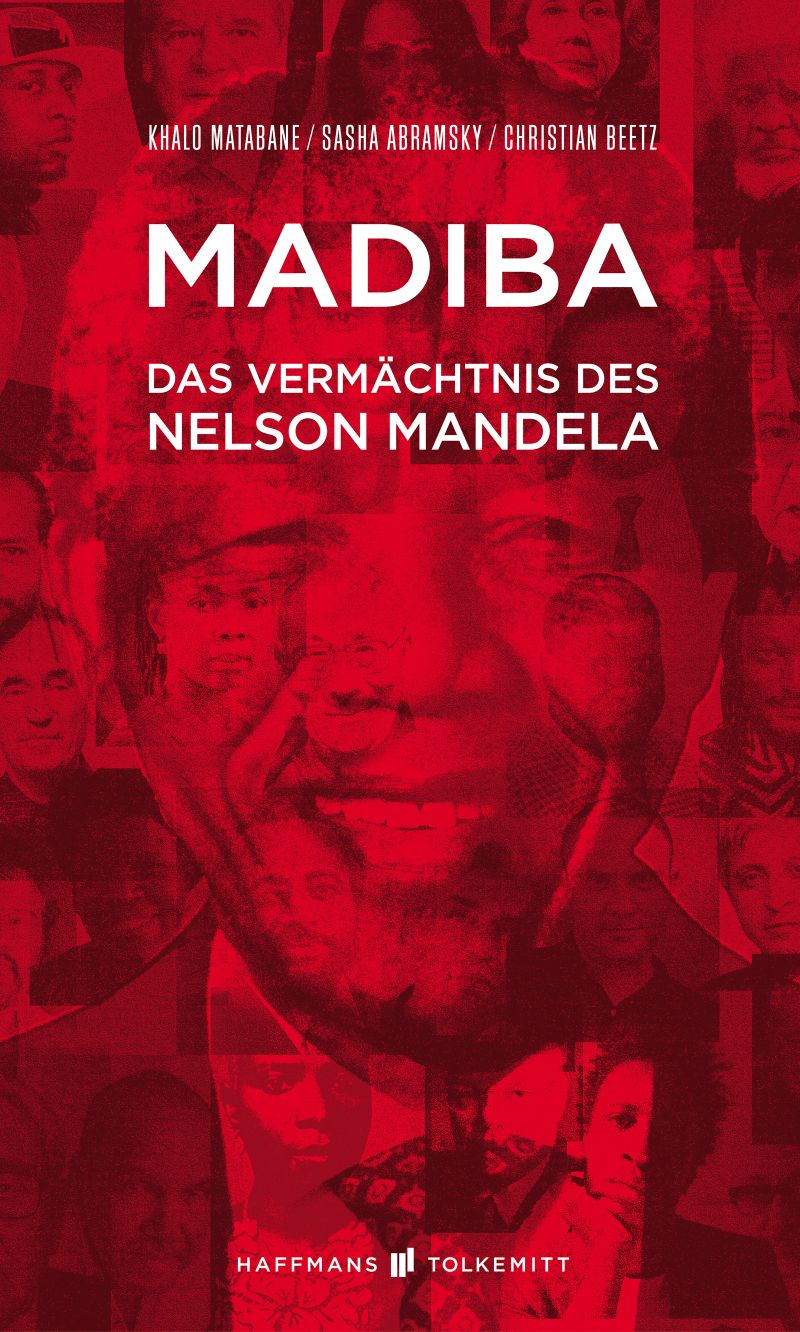
Khalo Matabane
Sasha Abramsky
Christian Beetz
MADIBA
Das Vermächtnis
des
NELSON MANDELA
Aus dem Englischen
von Andreas Simon dos Santos
& Nicolai von Schweder-Schreiner

Alle Bilder entnommen aus dem Film
»Madiba – Das Vermächtnis des Nelson Mandela«
(2013, Born Free Media/gebrueder beetz filmproduktion)
Deutsche Erstausgabe
1. Auflage, Januar 2014.
Copyright © 2014 Haffmans & Tolkemitt GmbH,
Inselstraße 12, D-10179 Berlin
www.haffmans-tolkemitt.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht
der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung,
der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen,
des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen,
des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung,
der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Internet,
auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung
in andere Sprachen.
Lektorat: Katharina Theml, Büro Z, Wiesbaden.
Umschlag von Hendrik Hellige, Berlin.
Herstellung von Urs Jakob, Werkstatt im Grünen Winkel,
CH-8400 Winterthur.
Satz & Lithos: Fotosatz Amann, Memmingen.
E-Book Konvertierung von Calidad Software Services,
Puducherry, Indien
ISBN 978-3-942989-68-8
E-Book ISBN: 978-3-942989-69-5
Inhalt
Einleitung
PALLO JORDAN
GREG MARINOVICH
CHARITY KONDILE
ESTHER BEJARANO
DALAI LAMA
NURUDDIN FARAH
ESTHER VIVAS
PUMLA GQOLA
JOACHIM GAUCK
HENRY KISSINGER
SALMAN KHURSHID
KO UN
BINYAVANGA WAINAINA
JULIETTE BINOCHE
ELIA SULEIMAN
TARIQ ALI
TALIB KWELI
JOHN CARLIN
RIAN MALAN
KIDJO
RULA JEBREAL
COLIN POWELL
WOLE SOYINKA
ALBIE SACHS
MANDLA LANGA
PETER HAIN
ARIEL DORFMAN
ADAM HABIB
NADINE GORDIMER
Personenregister
Einleitung
von Sasha Abramsky
NELSON MANDELA ist eine der großen Gestalten auf der Weltbühne des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Wie kein anderer zeitgenössischer Politiker gewann er nicht nur die Achtung eines breiten Spektrums von Menschen unterschiedlichster politischer Überzeugungen, sondern er wurde geliebt. Die Menschen nahmen Anteil an Mandelas Schicksal – an den Qualen seiner Gefängniszeit, an seinen Taten nach seiner Freilassung, an der Botschaft seines Lebenswegs. Nicht nur sein Einzelschicksal berührte die Menschen, sondern er wurde für sie zum Inbegriff edler Gesinnung und der Unbeugsamkeit des menschlichen Geistes. Mit seinem Lebensweg – vom berüchtigten Gejagten, der »Schwarzen Pimpernell« der weißen Propaganda, zum Gefängnisinsassen aus Gewissensgründen bis hin zum Verwandler und Heiler eines rassisch gespaltenen Südafrika und zum Präsidenten der reichsten afrikanischen Nation – wurde Mandela für viele zum Hoffnungsträger und Heilsbringer.
Wenig überraschend überdeckte das Image, das Symbol Mandela, häufig die Realität, dass auch er nur eine einzelne, sehr menschliche Person war; dass er trotz all seiner hehren Ideale und Träume keine Glückseligkeit bringen konnte, weder seinem eigenen Land noch den vielen anderen auf der ganzen Welt, die unter Konflikten, Spaltungen, Armut und Ungerechtigkeit leiden.
Vom 11. Februar 1990 an, jenem Tag, als Mandela als freier Mann das Gefängnis verließ, bis zum Tag seines Todes im Alter von 95 Jahren in den späten Abendstunden des 5. Dezember 2013 überstrahlte der Mythos den Menschen. Mandela wurde zu einem Aushängeschild, jemandem, den man in öffentlichen Diskussionen kaum kritisieren durfte, einer Gestalt von Weltgeltung, der man auf der internationalen Bühne begegnet sein musste. Die Berühmten rissen sich um ihn wie einst um Gandhi mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor, er wurde so geliebt und oft zitiert wie Martin Luther King. Er wurde zum »Madiba« der Welt, ein liebenswerter, beinahe knuddeliger Elder Statesman, der mit seinem ansteckenden Lächeln und seinen herzlichen Umarmungen die hoch geschätzte Fähigkeit besaß, noch den zynischsten Nachrichtenjournalisten zu verzücken. Wer wollte nicht gerne etwas von diesem Zauber abbekommen?
Als sich die Nachricht vom Tod der 95-jährigen Führungsgestalt am frühen Morgen des 6. Dezember verbreitete, brach eine weltweite Welle der Trauer los, die so spontan wie faszinierend war – wobei sich die Faszination ebenso daraus speiste, wer Worte der Trauer fand, wie aus dem, was gesagt wurde: Britische und amerikanische Politiker aus konservativen Parteien, die sich eine Generation zuvor noch überschlagen hatten, Mandela als Terroristen zu brandmarken, priesen den verstorbenen südafrikanischen Politiker nun als Helden des Wandels. Er habe, so bekräftigten sie, allen den Weg nach vorn gewiesen. Mit seiner Großzügigkeit und seiner Weigerung, sich mit einer Politik der Rache zu revanchieren, habe er die besseren Geister der Welt geweckt. In Ländern, die von erbitterten politischen Kämpfen zerrissen sind, bewirkte Mandelas Tod eine vorübergehende Eintracht der gegnerischen Parteien. In den Vereinigten Staaten beteuerte Präsident Obama im bewussten Rückgriff auf die Sprache, die Abraham Lincolns Kriegsminister Edwin Stanton verwendete, als er dem ermordeten Unionsführer 1865 Tribut zollte, dass Mandela »nicht länger uns gehört. Er gehört allen Zeitaltern.« Auf der anderen Seite des politischen Spektrums lobte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, Mandela als eine »unermüdliche Stimme der Demokratie«. Sein »langer Weg zur Freiheit«, fuhr der Kongressabgeordnete fort, »bewies einen fortdauernden Glauben an Gott und Respekt für die Menschenwürde«.
Und doch, in so vieler Hinsicht ist der Mann selbst eine weit interessantere Person als die mythologische Gestalt, deren Tod weltweit solche außergewöhnlichen Lobreden auslöste.
Für sich allein genommen war Mandela ein außerordentlicher Mensch: ein leidenschaftlicher Revolutionär, der zum bewaffneten Kampf gegen den Apartheidstaat rief; einer der eloquentesten und langlebigsten Freiheitskämpfer Afrikas; ein Mann, der hinter Gittern ein beinahe drei Jahrzehnte währendes Selbstgespräch darüber führte, wie das Land, das ihn eingekerkert hatte, am besten zu verändern wäre, und der dabei zu dem Schluss gekommen war, dass ein Vorankommen allein durch einen friedlichen, auf dem Verhandlungsweg erreichten Wandel möglich wäre; der die Großherzigkeit besaß, jenen zu vergeben, die ihm Unrecht getan und so vielen seiner Kampfgefährten Leid zugefügt hatten – häufig mit tödlichen Folgen. Ein Mann, der mit Mitte siebzig in einer demokratischen Wahl ohne Rassendiskriminierung zum Präsidenten Südafrikas gewählt wurde, was nur wenige Jahre zuvor kaum ein Beobachter für möglich gehalten hätte. Und der dann eine Wahrheits- und Versöhnungskommission einsetzte, um das Unrecht, die Erniedrigung, die alltägliche Gewalt des Apartheidstaates zu dokumentieren, ohne eine Politik staatlich sanktionierter Rache zu entfesseln, die nur zu leicht in einen Bürgerkrieg hätte führen können. »Ich war völlig überwältigt von seiner Großherzigkeit«, sagt der nigerianische Schriftsteller und politische Aktivist Wole Soyinka. »Zu so etwas wäre ich nie in der Lage. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission ist in meinen Augen ein Wunder an Menschlichkeit.«
Der Katalog von Mandelas Errungenschaften ist lang. Aber wie er selbst nur allzu gut wusste, war nicht alles eitel Sonnenschein. Seine Ehe mit Winnie Mandela zerbrach unter einer Reihe von Anschuldigungen gegen die Clique brutaler Schläger, mit der sie sich während seiner Gefangenschaft umgab. Die Wirtschaft in Südafrika, entlang von Rassengrenzen gespalten, blieb auch nach dem Ende der Apartheid von furchtbarer Ungleichheit geprägt und bot Abermillionen von schwarzen Südafrikanern und verzweifelten Migranten aus anderen Teilen des Kontinents kaum Chancen. Zahlreiche Shantytowns verschandelten das Land. Südafrika gehörte zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an HIV-Infizierten auf der Welt. Und die Rate der Gewaltverbrechen in Südafrika schoss in die Höhe. Es stimmt, Mandelas Politik dürfte wohl einen Bürgerkrieg verhindert haben; doch die Gewalt und Krankheiten, die mit Massenarbeitslosigkeit und einem erschütternden Maß an Ungleichheit einhergingen, waren Warnsignale, dass im neuen Südafrika noch nicht alles zum Besten stand.

Madiba. Das Vermächtnis des Nelson Mandela möchte diesen komplexen Realitäten nachspüren, die Mandela verhüllenden mythologischen Schleier lüften und in einer Serie offener Gespräche die Bedeutung erkunden, die er für die Südafrikaner wie für seine Freunde, Kollegen und Kritiker aus aller Welt hatte. Die Absicht ist nicht, Mandela oder sein Erbe zu schmälern, sondern noch tiefer zu verstehen: Mandela als eine dreidimensionale Gestalt vorzustellen und die Regenbogennation, über deren Gründung er präsidierte, als komplexes, im Werden begriffenes Unterfangen zu erfassen.
Das Buch entstand aus einem Filmprojekt, das in Südafrika mit einer Idee von Regisseur Khalo Matabane seinen Anfang nahm. Matabane, der in mehreren Filmen der Gewalt des Apartheidregimes nachging und die Lebenswege von Menschen nachzeichnete, die gegen das unterdrückerische System kämpften, war seit langem von Mandela und seiner Bedeutung für die Menschen in Südafrika und darüber hinaus fasziniert. »Ich bin unter der Apartheid geboren, in einer konservativen Gemeinde in Limpopo im Norden Südafrikas«, erzählt Matabane. »Nelson Mandela war für mich ein Held, und als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, dachte ich, die Apartheid, der Rassismus und die Ungerechtigkeit würden im Nu verschwinden. Ich war ein Teenager. Ich weiß nicht genau, wie ich mir die Freiheit vorgestellt hatte, aber sie besaß für mich etwas Magisches.« Natürlich war die Wirklichkeit verzwickter und beileibe nicht so schön, und mit der Zeit wuchs bei vielen Südafrikanern ein tiefes Misstrauen gegen den Prozess der Aussöhnung mit den Nutznießern des Apartheidsystems. Inmitten dieser Enttäuschung blieb Mandela für einige beinahe ein Heiliger, andere fingen dagegen an, ihn mit anderen Augen zu betrachten. »Ich glaube, was dann im weiteren Verlauf geschah, war, dass sich die Schwarzen insgesamt als großzügig erwiesen haben, und wir hatten angenommen, dass unsere weißen südafrikanischen Mitbürger – ich meine verallgemeinernd gesprochen – das Geschenk, das wir ihnen mit der Versöhnung gemacht haben, anerkennen, auf uns zugehen und ihrerseits eingestehen würden, was sie uns angetan haben. Aber das ist nie passiert.«
Mandela, sagt Matabane, »ist zu einem Heiligen und einem Mythos geworden; niemand möchte diesen Mythos zerstören oder in Zweifel ziehen. Natürlich gibt es Menschen, die öffentlich abschätzig über ihn reden, aber daran liegt mir nichts. Ich bin an seinen Widersprüchen interessiert.«
Während die Ikone betagter wurde – und die Weltmedien eine makabere Wache am Sterbebett des merklich leidenden Mandela begannen, die sich über zwei Jahre hinziehen sollte, machten sich Matabane und sein Team daran, Menschen zu befragen, deren Wege sich in mancher Hinsicht entweder mit Mandelas Lebensgeschichte kreuzten oder von ähnlichen Erfahrungen wie jenen des ANC-Führers geprägt sind (weil sie politische Gefangene waren; staatliche Gewalt gegen sich oder ihre Familien erdulden mussten; vergleichbare Lernprozesse der Versöhnung und sogar der Vergebung gegenüber Menschen und Organisationen, die ihnen großes Leid zugefügt hatten, durchgemacht haben). Um sich seiner eigenen Beziehung zu dieser überlebensgroßen Gestalt klarer zu werden, schrieb Matabane selbst einen Brief an Mandela. »Als ich in den 1980er Jahren in dem Dorf aufwuchs, erzählte mir meine verstorbene Großmutter heroische Geschichten von Ihnen«, schrieb der Filmemacher. »Sie waren ein Freiheitskämpfer, der eines Tages die Gefängnismauern einreißen und eine Armee anführen würde, um unser Volk zu befreien. Sie besaßen geheimnisvolle Kräfte, mit denen Sie Ihre Feinde schließlich vernichten würden. Meine Großmutter warnte mich, Ihren Namen niemals jemand anderem gegenüber auszusprechen, auch nicht vor meinen Freunden, weil mich das in Schwierigkeiten bringen könnte. Ich stellte Sie mir wie eine Sagengestalt vor, halb Mensch, halb Ungeheuer, mit einem riesigen Auge in der Stirnmitte und sechs Zehen an jedem Fuß. Das war für viele Jahre meine Erinnerung an Sie, und sie gab mir angesichts von Unterdrückung und Brutalität Hoffnung.«
Als mit den Monaten das Projekt wuchs, wurde klar, dass die Interviews nicht nur eine faszinierende Dokumentation abgeben würden – Matabanes Team wurde mittlerweile von der deutschen Filmproduktionsfirma der Gebrüder Beetz unterstützt –, sondern auch ein zum Nachdenken anregendes Buch, das in vieler Hinsicht ebenso sehr eine Reflexion über die moralischen Werte der modernen Welt wie über Mandela selbst sein würde.
So entstand die Idee zu Madiba. Das Vermächtnis des Nelson Mandela.

Kein anderes Werk über Mandela führt in dieser Weise die Stimmen der Mächtigen und Berühmten mit denen der unbekannten und einfachen Menschen zusammen wie dieses Buch.
Wie sieht Charity Kondile, eine Mutter, die ihren Sohn durch die Gewalt der Apartheid verloren hat, den Prozess der Versöhnung, den Mandela in Gang gesetzt hat? »Ich bin nur eine gewöhnliche Mutter, ich sitze nicht im Parlament«, sagt Kondile, als sie über ihren Wunsch spricht, die Mörder ihres Sohnes für ihr Verbrechen ins Gefängnis zu bringen. »Aber zumindest hätte ich dann das Gefühl, dass die Leute froh sind, weil diese Täter hinter Gittern sind. Die Menschen würden dann wenigstens verstehen, dass der Staat auf ihrer Seite ist. Denn wenn wir uns anschauen, wie es jetzt ist, dann haben wir das Gefühl, als würde der Staat in gewisser Weise hinter den Mördern, hinter den Tätern stehen.«
Wie verstehen Staatsmänner wie Henry Kissinger oder Colin Powell Mandelas Motive und Taten? »Ich habe etwas von ihm gelernt«, sagt Colin Powell, »und zwar, dass man die Fehler der Vergangenheit auf sich beruhen lassen und lieber nach vorn schauen sollte.«
Wie beurteilt jemand wie Albie Sachs, der viele Jahre gegen die Apartheid gekämpft hat, den südafrikanischen Staat nach dem Ende des Unrechtsregimes? Wie sieht der Dalai Lama, auch er eine Persönlichkeit von Weltgeltung, die mehr Mythos als Realität geworden ist, die überlebensgroße Gestalt Nelson Mandelas? Wie versteht ein Dichter, der lange über Mandela geschrieben hat, das Erbe Mandelas; wie sieht es ein Musiker, für den der inhaftierte Führer zur Muse wurde? Was hatten Berühmtheiten eigentlich davon, sich neben einer über neunzigjährigen Ikone ablichten zu lassen?
Wie beurteilt ein Fotojournalist, der alle Schrecken bewaffneter Konflikte erlebt hat, einen einstigen Revolutionär, der sich neu erfunden hat und auf der Weltbühne zu einem der wenigen wirklich unverzichtbaren politischen Führer geworden ist? »Ich halte Nelson Mandela für einen großartigen Mann, aber eben auch für einen Politiker, und das meine ich nicht als Kompliment«, sagt Fotograf Greg Marinovich. »Er ist für mich ein großer Mensch, eine der Ikonen unserer Zeit. Ich finde es großartig, sein Zeitgenosse zu sein. Er übt eine solche Macht aus, und er hat Erstaunliches geleistet und ein bedeutendes Leben geführt – bedeutender, als jeder von uns je sein oder sich erträumen kann. Doch auf der anderen Seite war er ein Politiker, und Politiker, wissen Sie, die benutzen die Menschen.«
Wie sieht ein weißer südafrikanischer Schriftsteller, Rian Malan, Mandela und seinen Umgang mit den Nutznießern der Apartheid? »Ich weiß, dass kein Weißer in Südafrika unschuldig war, wir haben alle von dem System profitiert. Und als Mandela kam und mir Absolution erteilte, habe ich mich beschämt und erniedrigt gefühlt. Jeden Tag ist man aufgewacht und hat sich beschissen gefühlt, wenn man als Weißer nicht die Augen verschloss und über die eigene Selbstsucht angesichts der Entbehrungen anderer Menschen nachdachte. … Und plötzlich kommt Mandela an und trinkt Tee mit Betsie Verwoerd [der Witwe des einstigen südafrikanischen Premierministers Hendrik Verwoerd] und bringt die Weißen auf seinen Kurs. ›Sei willkommen, Bruder. Mach bei uns mit, kremple die Ärmel hoch. Gemeinsam packen wir das.‹ Das war eine Atombombe, die im Kopf einer Menge weißer Männer wie mir hochgegangen ist. ›Shit, wer ist dieser Kerl, wie kann der so reden nach all den Jahren im Knast?‹« Und Malan resümiert seinen Zwiespalt: »Dass Mandela den Weißen die Apartheid verzieh, das hat mich sehr peinlich berührt. Es geht auf Jesus Christus am Kreuz zurück: ›Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.‹ In ihm steckt etwas von einem Heiligen, wenn man so will.«

Vor mehreren Jahren sprach die gefeierte nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie von der »Gefahr einer einzigen Geschichte«. Eine solche Geschichte, schrieb sie, »schafft Stereotypen, und das Problem bei Stereotypen ist nicht, dass sie nicht stimmen, sondern dass sie unvollständig sind. Sie machen aus einer einzelnen Geschichte die einzige Geschichte.«
In den letzten Jahren wurde Mandela zunehmend vergöttert und seine außergewöhnliche und vielschichtige Geschichte allzu häufig auf eine »einzige Story« reduziert. Es ist leichter, sich einer Legende zuzuneigen, als den echten dreidimensionalen Menschen wirklich zu verstehen. Dieses Buch und der Film, der es begleitet, sind bestrebt, den Lesern und Zuschauern auf der ganzen Welt die Person Mandela, nicht den Mythos, näherzubringen. In den Tagen nach Mandelas Tod, als Kommentatoren und Politiker an sein Leben erinnerten, hörte eine Generation junger Menschen, die in einer Welt nach dem Ende der Rassentrennung aufwuchs, die Geschichte der Apartheid und des Kampfes – in Südafrika wie auf der ganzen Welt – gegen ihre Übel. Dieses Buch wird diesen Dialog einen Schritt weiter führen und nicht nur die herausragende Persönlichkeit Mandelas und ihre Umgestaltungskraft beleuchten, sondern auch die äußerst komplexen Wirkungen auf die kulturelle und politische Landschaft Südafrikas und die Kakophonie der Gefühle, die Mandelas Geschichte und seine Betonung der Versöhnung im südafrikanischen Volk bis heute auslösen.
»Als Sie aus dem Gefängnis entlassen wurden, war ich ein Teenager. Wir waren aus dem Dorf weggezogen und ich lebte nun mit meiner Mutter in Johannesburg. Ich habe Ihre Freilassung im Fernsehen gesehen. Sie sahen anders aus, als ich Sie mir vorgestellt hatte. Sie trugen einen Anzug, wirkten gebrechlich und winkten und lächelten der Menge zu«, schrieb Matabane in seinem Brief an Mandela. »Sie sahen normal aus, wie mein Großvater. Ich wartete auf Ihre Erklärung, wie Sie für die Bestrafung der Schuldigen am Tod, an der Inhaftierung, der Folter, der Verschleppung und Erniedrigung unseres Volkes sorgen würden. Auch ich habe Erinnerungen und Narben, trage mein eigenes Päckchen. Ich erinnere mich, wie ich mit meinem Großvater und meiner Großmutter in die Stadt fuhr und mit ansehen musste, wie sie beim Einkauf durch die Ladenfenster bedient wurden, während Weiße in die Geschäfte hineingingen. Ich erlebte auch, wie sie manchmal schlecht behandelt oder von Jugendlichen angepöbelt wurden, die ihre Enkel hätten sein können. Die Erniedrigung in ihren Gesichtern war unerträglich.
Jede Nation trägt an der Bürde der Geschichte und Erinnerung. Wann sollten wir uns erinnern und was sollten wir vergessen, und wer bestimmt darüber? Was machen wir mit Menschen, die Gräueltaten verübt haben, von denen manche keine Reue zeigen? Was macht man mit den Handlangern, die sagen, dass auch sie Opfer waren und nur Befehle befolgten? Was ist mit den Anführern, die behaupten, es gebe keine Beweise dafür, dass solche Befehle von ihnen kamen, die nicht gewusst haben wollen, dass Gräuel verübt wurden? Was ist mit Familienmitgliedern, Freunden, Liebhabern und Nachbarn, die einander verrieten? Was ist mit den Männern, die Frauen missbrauchten und vergewaltigten, manchmal ihre eigenen Kameradinnen?
Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich mich fortreißen lasse, aber im Rückblick auf den Tag, an dem Sie freigelassen wurden, kann ich mir nicht erklären, warum ich enttäuscht war. Ich fing an, mir verschiedene Theorien zurechtzulegen. Es kam mir in den Sinn, dass man uns vielleicht alle hinters Licht geführt hatte; dass es nicht Sie waren, der entlassen worden war, sondern ein Gaukler, der sich für Sie ausgab. Ein weiterer Gedanke war, dass meine Großmutter vielleicht all die Geschichten über Sie erfunden hatte, um sich Hoffnung zu machen, oder, schlimmer noch: Was, wenn ich selbst die Geschichten erfunden hatte, um meine ziemlich langweilige Kindheit interessanter, bunter, tiefer und politischer zu machen? Was war Wirklichkeit und was Fiktion? Konnte ich meinen eigenen Erinnerungen trauen?
Ich war allein an jenem Tag, und in mir meldete sich ein Schuldgefühl. Wer war ich schon, Sie zur Rede zu stellen? Sie waren gerade nach 27 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Weder meine Familie noch ich hatten je das System herausgefordert. Wir waren nie verhaftet oder gefoltert worden. Wie viele andere Menschen hatten wir Angst und gingen unserem alltäglichen Leben nach. Wir hielten uns über Wasser. Ich beschloss, zu den Tausenden von Menschen auf den Straßen von Johannesburg zu stoßen, die sangen: ›Nelson Mandela o Baba Wethu‹ [Nelson Mandela ist unser Vater]. Die folgenden Tage und Jahre haben sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis geprägt. Sie waren die besten meines Lebens. Ich dachte, der Alptraum, der jahrhundertelang auf unserem Volk gelastet hatte, sei endlich vorbei. Ich malte mir ein geniales nationales Aufbauprogramm aus, das den Menschen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Land und anständigem Wohnraum verschaffen würde. Auf meinen Reisen traf ich Menschen, die mir rieten, nicht allzu optimistisch zu sein. Sie genossen seit vielen Jahren die Freiheit, und auch sie hatten die Euphorie eines freien Landes erlebt, nur um mit anzusehen, dass ihre Träume nicht in Erfüllung gingen.«
Für die heutigen jungen Frauen und Männer im Südafrika des 21. Jahrhunderts, aber auch für einen Großteil der übrigen Welt bleibt der Name Mandela geradezu ein Kürzel für utopische Hoffnungen ebenso wie für enttäuschte Erwartungen. »Die Ungleichheit in der südafrikanischen Gesellschaft gehört zur höchsten weltweit«, fährt Matabane in seinem Schreiben an Mandela fort. »In jüngster Zeit haben wir viele Proteste erlebt. Der Traum verwandelt sich in einen Alptraum. Es gibt sogar Shantytowns, die nach Ihnen benannt sind. Ich frage mich, wie Sie sich dabei fühlen.«
In den 1980er Jahren wurde Nelson Mandela zu einem Schlagwort. Rund um den Globus machten fortschrittliche Kräfte gegen die Apartheid mobil und skandierten vor südafrikanischen Botschaften: »Lasst Nelson Mandela frei!« In den 1990er und 2000er Jahren wurde er trotz der Krisen, die das von ihm und seinen Nachfolgern geführte Land heimsuchten und die Matabane in seinem Brief ansprach, zu einem Aushängeschild: Ein Hollywoodstar nach dem anderen, ein hoher Staatsgast nach dem anderen flog in Südafrika ein, um einem Helden ihre Reverenz zu erweisen.
Die Begegnungen und Gespräche in diesem Buch zeichnen die Prozesse und Konflikte nach, in denen der südafrikanische Revolutionär, Freiheitskämpfer, Gefangene, Staatsmann und Nobelpreisträger eine so zentrale Rolle spielte, und machen ihn wieder zu einem Menschen. Ein Mythos zu sein, in das Reich zeitloser Gestalten aufgestiegen zu sein, mag seine Vorzüge haben, aber wir glauben, dass es von größerem Vorteil ist, ein reifer, vielschichtiger, realer Mensch zu sein.
MADIBA
Das Vermächtnis
des
NELSON MANDELA

PALLO JORDAN
Zweledinga Pallo Jordan ist langjähriges Mitglied des nationalen Exekutivausschusses des Afrikanischen Nationalkongresses und diente in den Jahren nach Ende der Apartheid sowohl in Nelson Mandelas Kabinett als auch als Minister für Kunst und Kultur in der Regierung von Thabo Mbeki.
Geboren 1942 in Kroonstad in der Provinz Freistaat als Sohn einer Lehrerin und eines Schriftstellers, verließ Jordan Südafrika mit zwanzig zum Studium an der Universität von Wisconsin in den USA. Nach mehreren Jahren in Amerika zog er nach London, um an der London School of Economics zu promovieren, und arbeitete nach seinem Abschluss 1975 für das dortige Büro des Afrikanischen Nationalkongresses. Später schickte die Organisation Jordan als Leiter von Radio Freedom nach Luanda in Angola.
1979 führte er die erste Propagandakampagne »Year of the Spear« gegen die Apartheid. Im folgenden Jahr zog er nach Lusaka in Sambia, um dort die Forschungsstelle der Abteilung für Information und Öffentlichkeitsarbeit des ANC zu leiten.
Jordan kehrte 1990 nach Südafrika zurück, nachdem Präsident de Klerk das Verbot des Afrikanischen Nationalkongresses aufgehoben hatte, kandidierte bei den 1994 abgehaltenen ersten demokratischen Wahlen für das Parlament und ist seither eine zentrale, zuweilen umstrittene politische Gestalt des Landes. 1996 war er als Post-, Telekommunikations- und Rundfunkminister das erste Kabinettsmitglied, das Mandela feuerte, nachdem er wiederholt mit dem Präsidenten über Vorhaben der Regierung aneinandergeraten war, die aus seiner Sicht die Bürgerrechte verwässerten und in die Pressefreiheit eingriffen. Er stand auch den Bestrebungen der Regierung zur Privatisierung des Telekommunikationsnetzes des Landes und den Auswirkungen der Globalisierung auf die südafrikanische Wirtschaft äußerst kritisch gegenüber. Über seine in weiten Teilen der ANC-Basis unpopuläre Entlassung wurde viel geschrieben. Bald nach seinem Rauswurf wurde Jordan wieder auf einen Kabinettsposten berufen, dieses Mal als Minister für Umwelt und Tourismus.
Jordan ist niemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt; 2013 begrüßte er den Tod der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher mit dem Ausruf: »Auf Nimmerwiedersehen!« »Sie war«, erklärte er dem Guardian seine Wortwahl, »eine eiserne Unterstützerin des Apartheidregimes.«
Sind die Begriffe der Versöhnung und der Vergebung austauschbar?
Nein. Versöhnung und Vergebung sind offensichtlich nicht dasselbe. Vergebung ist, wenn Ihnen jemand ein Unrecht getan hat und Sie zu dem Schluss kommen: Na gut, bei genauer Betrachtung war es nicht so furchtbar, ich kann dir verzeihen. Lass uns von vorn beginnen. Versöhnung ist eine aus meiner Sicht ganz, ganz anders gelagerte Situation. Bei Versöhnung hat man zwei Parteien, die im Zwist liegen. Es geht da nicht unbedingt darum, wer recht und wer unrecht hatte, sondern es dreht sich um den Konflikt. Eine Versöhnung handelt dann davon, dass zwei Parteien übereinkommen, ihre Differenzen hinter sich zu lassen und zu versuchen, miteinander auszukommen. Nun musste es in der südafrikanischen Situation offensichtlich eine Versöhnung geben, weil uns für die Zukunft nicht vorschwebte, dass die Weißen aus dem Land getrieben oder irgendwie aus dem Weg geräumt oder vielleicht zu Bürgern zweiter Klasse degradiert würden. Was bedeutete, dass man einen Weg finden musste, wie Schwarze und Weiße zusammenleben konnten. Sie mussten also miteinander versöhnt werden. Und in diesem Kontext sagen die beiden Parteien also zueinander: »Wir werden unsere früheren Differenzen vergessen und von jetzt an versuchen, miteinander auszukommen.« Wenn Sie das mit Vergebung kontrastieren, ist das ein völlig anderes Paar Schuhe.
Nehmen Sie zum Beispiel den Holocaust oder die deutsche Aggression, die zum Zweiten Weltkrieg führte: Es gab Versöhnung unter den betroffenen Parteien des Konflikts. Deutschland musste einen hohen Preis dafür bezahlen, dass es Aggressionskriege angezettelt hatte. Das Land wurde zweigeteilt, und was die Menschen betrifft, die ermordet worden waren, besonders die Juden, zahlt Deutschland bis heute Geld an Israel als Entschädigung für die sechs Millionen, die umgebracht wurden. Die Slawen und die anderen scheinen dabei irgendwie auf der Strecke geblieben zu sein, aber den Nazis wurde nicht vergeben, was sie getan haben. Es gibt keine Vergebung, aber es gab Aussöhnung.
Die beiden Dinge sind also überhaupt nicht dasselbe. Man kann sich mit jemandem versöhnen, ohne ihm zu vergeben. Man kann natürlich auch jemandem vergeben. Das wäre Teil einer Aussöhnung. Vergebung ist ein Maß der Versöhnung.
Was halten Sie von Leuten, die nicht vergeben wollen? Menschen wie Frau Biko [die Witwe des 1977 mutmaßlich in südafrikanischem Polizeigewahrsam ermordeten schwarzen Bürgerrechtlers Steve Biko]?
Letztendlich musste man sich ja auf einen Prozess einigen, eine Verfahrensweise, und das war der Prozess der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Und sobald man sich auf das Verfahren geeinigt hat, muss man es akzeptieren, weil wir eine von Recht und Gesetz beherrschte Gesellschaft sind – ob einem das behagt oder nicht. Ich habe zum Beispiel nie dem Major der südafrikanischen Polizei und Auftragsmörder, Craig Williamson, vergeben, dass er Ruth First ermordet und auch mich beinahe umgebracht hat. Er hätte mich bei der Bombenexplosion damals fast getötet. Das habe ich ihm nie verziehen. Bis heute höre ich schlecht, meine Sehfähigkeit ist beeinträchtigt. Ich habe ihm das nie vergeben, aber das Verfahren wurde in dieser Form beschlossen und ich war damit einverstanden und muss das Ergebnis hinnehmen.
Am Ende des Tages stellte ihm die Wahrheits- und Versöhnungskommission eine lupenreinen Persilschein aus: »Gut, Sie können gehen. Gegen Sie wird keine Anklage erhoben.« Damit muss ich leben, weil wir eine Gesellschaft sind, in der Recht und Gesetz herrschen. Es hat drei Versuche gegeben, mich zu ermorden. Ich weiß nicht genau, wer dafür verantwortlich war. Der Chemiewaffenexperte und Chef der bakteriologischen Kriegführung in der südafrikanischen Armee, Wouter Basson, war in irgendeiner Weise daran beteiligt, denn da ging es um Giftanschläge und alles Mögliche. Ich habe den Leuten nicht vergeben, die das versucht haben. Aber, wissen Sie, wir haben uns auf unser Verfahren geeinigt. Wouter Basson ist vor Gericht gekommen und der Richter sagte: »Nein, wir werden den Mordversuch in London nicht berücksichtigen« usw., das wurde aus dem Verfahren ausgeklammert. So, auch das musste ich hinnehmen. Ich musste damit leben.
Leider ist es das, was in einer Demokratie passiert, wenn man in einem Rechtstaat lebt. Die Menschen müssen mit bitteren Entscheidungen wie diesen zurechtkommen. Ich verstehe völlig, warum Frau Biko den Mördern ihres Ehemanns nicht verzeihen will. Ich verstehe auch voll und ganz, warum viele Menschen nicht den Folterern und Mördern ihrer Ehemänner, Ehefrauen, Kinder, Söhne, Töchter etc. vergeben wollen. Ich habe dafür größtes Verständnis. Aber am Ende des Tages, wenn man eine Gesellschaft möchte, in der Recht und Gesetz herrschen, muss man bittere Pillen dieser Art schlucken.
Wenn die Opfer aber Gerechtigkeit einfordern, was entgegnen Sie ihnen? Sagen Sie: »Es ist hart, aber Gerechtigkeit können wir Ihnen nicht verschaffen«?
Nun, man versucht, soweit es geht, den Menschen Gerechtigkeit zu verschaffen. Deshalb wurde die Wahrheits- und Versöhnungskommission ja überhaupt ins Leben gerufen. Der Zweck der Wahrheits- und Versöhnungskommission bestand darin, dass wenigstens die Wahrheit ans Licht kommen sollte, damit die Leute wissen, meine Tochter, mein Sohn starb an diesem oder jenem Ort auf diese oder jene Weise, nicht wahr? Und sie erwidern: »Mein Gott, kann ich diesem Tier vergeben, was es meinem Kind angetan hat?« Es ist nur allzu verständlich, dass da Gefühle im Spiel sind: »Ich werde diesem Menschen nie verzeihen.« Und auch dafür gab es bei der Wahrheits- und Versöhnungskommission Spielraum. Wenn Parteien das Gefühl hatten, dass ein Beschuldigter angeklagt werden sollte, konnten sie den Fall weiterverfolgen. Tatsächlich sollte das im Fall von Craig Williamson geschehen. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission hat erklärt, dass er angeklagt werden könne. Aber irgendwo auf dem Weg fiel die Entscheidung, die Sache fallen zu lassen. Schlussendlich gehört das zu den wirklich bitteren Entscheidungen, wenn Menschen damit leben müssen, dass Beschuldigte, die furchtbare Dinge begangen haben, dafür nicht bestraft werden.
Sind Sie Wouter Basson, der Ihrer Überzeugung nach an den Mordversuchen an Ihnen beteiligt war, je begegnet?
Ja, das bin ich wirklich. Ich bin Wouter Basson zufällig am Flughafen von Cape Town begegnet, dem alten Flughafen, nicht dem heutigen. Er muss in einer Maschine angekommen sein, und ich war da, um jemanden abzuholen. Und da hab ich ihn stehen sehen, auf der anderen Seite, wie er darauf wartete, abgeholt zu werden. Ich bin vorbeigefahren und hab ihn da stehen sehen. Und da ist mir der Gedanke gekommen: Was wäre, wenn ich eine Pistole hätte und ihn direkt hier abknalle? Dann dachte ich: Ach was, das ist der doch gar nicht wert. Ich hatte sowie keine Pistole und erschieße keine Leute aus dem fahrenden Auto. Aber, wissen Sie, man überlegt schon, was passieren würde, wenn man eine Pistole gehabt und sich gesagt hätte: Na also, der wollte mich doch umbringen … na, dir werd ich’s zeigen … Bumm! Tja, dann wär ich jetzt derjenige, der im Knast sitzt, stimmt’s? Es wäre also nicht sehr produktiv gewesen.
Die Leute sagen, Madiba hat 27 Jahre im Gefängnis gesessen und vergeben, dann ist es für uns alle möglich zu verzeihen. Stimmen Sie dem zu?
Ich schätze schon. Ja, man kann schon so argumentieren, vorausgesetzt natürlich, dass er nach 27 Jahren noch da war, um aus dem Gefängnis kommen zu können. Es gibt andere, die sind nicht mehr aus dem Gefängnis herausgekommen. Da gibt es Leute, die exekutiert wurden, andere, die im Gefängnis gestorben sind usw., nicht wahr? Das ist also eine etwas andere Geschichte. Wenn Sie zum Beispiel die Familie Fischer nehmen: Bram Fischer ist im Arrest gestorben. Er ist da nicht wieder herausgekommen. Wie geht man damit um? Das ist eine völlig andere Sache. Ich glaube nicht, dass Vergebung und Versöhnung so vermengt werden sollten, wie es die Leute gerne tun. Versöhnung war ein notwendiges Mittel, weil man in Zukunft in derselben Gesellschaft leben wird und man daher einen Weg des Zusammenlebens finden muss. In dieser Hinsicht gab es keine Wahl. Das Problem der Vergebung hat einen hohen Stellenwert, ob man nun vergeben möchte oder nicht. Was aber nun leider geschehen ist aufgrund der Art und Weise, wie die Geschichte der Versöhnung ausgelegt und vermittelt wurde, ist, dass viele unserer weißen Landsleute jetzt das Gefühl haben, dass eigentlich nichts Unrechtes geschehen ist. Man denke nur an de Klerk, der noch im letzten Jahr im Gespräch mit CNN-Moderatorin Christiane Amanpour gesagt oder nahegelegt hat: »Ach, die Apartheid war ja etwas, das schiefgegangen ist, sie war ein großer Irrtum. Wir hatten doch gehofft, dass sie nicht so schreckliche Konsequenzen haben würde.« Das ist ein unredliches Argument, denn wenn man sich anschaut, wie das System im Lauf der Zeit aufgebaut wurde, wenn es da irgendetwas gibt, was kein Irrtum war, dann war es das Apartheidsystem. Alles war aufeinander abgestimmt. Es gab hier eine Maßnahme, die mit einer anderen dort abgestimmt war und zu einem bestimmten Resultat führte. Es war sehr, sehr sorgfältig geplant. Jede Maßnahme war kühl durchdacht. Wir tun dies, um zu diesem oder jenem Ergebnis zu kommen. Nehmen wir zum Beispiel das Landgesetz von 1913. Sein Zweck bestand darin, eine landbesitzende Klasse unter den Afrikanern zu vernichten, die überall in Südafrika lebte, in städtischen und ländlichen Gebieten, und auf dem freien Markt mit weißen Farmern konkurrierte. Das Landgesetz war dazu konzipiert, sie zu vernichten.
Einige deutsche Autoren haben mit Blick auf die von Deutschland erwarteten Entschädigungen für die Nazi-Verbrechen gefragt, warum wir weißen Unternehmen in Südafrika keine Steuer auferlegen und sie in einen Fonds einzahlen lassen. Warum, fragen sie, habt ihr sie ungeschoren davonkommen lassen? Finden Sie, das hätte man machen sollen? Dass die Leute dafür hätten bezahlen sollen?
Der Punkt bei dem Ergebnis, das durch Verhandlungen erreicht wurde, ist: Worüber wurde denn verhandelt? Worauf man sich geeinigt hat, war ein Verfahren, die politischen Institutionen in Südafrika wiederherzustellen. Das war es, worum es bei den Verhandlungen ging: die politischen Institutionen des Landes. Natürlich nehmen die politischen Institutionen auch Einfluss auf Fragen wie die Eigentumsverhältnisse, auf wirtschaftliche Probleme usw., aber das war es, worum es bei den Verhandlungen ging. Diejenigen nun, die sagen, dass wir auch über die wirtschaftlichen Fragen hätten sprechen sollen, könnten recht haben, aber das ist ein Punkt, den sie damals hätten vorbringen müssen, nicht nach vollbrachter Tat. Damals hätten sie das fordern sollen. Die Ironie ist natürlich, dass sich viele Leute, die solche Kritik anbringen, zurückgezogen haben, als die Verhandlungen ernsthaft begannen. Sie wollten nicht daran teilnehmen. Nehmen wir zum Beispiel viele Leute aus der Black-Consciousness-Bewegung. Erst vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel gelesen, in dem sich ein Vertreter der Bewegung beklagt, dass weiße Männer noch immer die südafrikanische Wirtschaft dominieren, sie beherrschen die qualifizierten Berufe in Südafrika, sie dominieren immer noch dies, das und jenes. Sie herrschen immer noch über die anderen und, so die Klage: Mensch, die Verhandlungen hätten doch das alles lösen und das alles verändern müssen. Tatsache ist, als die Black-Consciousness-Bewegung beim Beginn der Verhandlungen gesagt hat: Wir machen da nicht mit. Sie haben sich von ihnen ferngehalten. Bei den ersten Wahlen 1994 haben sie sich wieder ferngehalten. Jetzt, beinahe zwanzig Jahre danach, sagen sie, wir hätten doch, bitte schön, über die Wirtschaft verhandeln sollen. Dass es nicht geschehen ist, war womöglich ein schrecklicher taktischer Fehler, vielleicht ein strategischer Fehler. Schön und gut. Aber die Verhandlungen wurden über die politischen Institutionen geführt. Die Frage der Besteuerung und vieles andere mehr war tatsächlich nicht Gegenstand der Debatte, die zu den Verhandlungen führte. Ich erinnere mich, dass hier jemand war, ebenfalls ein Deutscher, der über die deutsche Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen hat. Er sprach von einer Abgabe, die damals allen Vermögenden als Lastenausgleich auferlegt wurde. Das Land war zerstört, man musste es wiederaufbauen. Es gab jene, die Geld hatten, und jene, die keins hatten, und diejenigen, die über größere Mittel verfügten, mussten natürlich mehr bezahlen, weil sie es sich leisten konnten, einen größeren Beitrag zu leisten als die weniger Betuchten. Die Frage wurde in der südafrikanischen Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt. Wenn man zurückblickt, ist man schockiert angesichts der Reaktion unserer weißen Landsleute. Von den führenden Meinungsmachern bis hinunter zur Hausfrau in Vredehoek fragten alle: »Was? Wie könnt ihr euch erdreisten, so was vorzuschlagen?!« Will sagen, es war der denkbar ungeheuerlichste Vorschlag. Es sollte eine Wiederaufbausteuer sein, aber in jedem Leitartikel wurde es als Reichensteuer hingestellt, und dagegen machten sie schlicht Opposition, so dass das Thema gar nicht erst angeschnitten wurde.