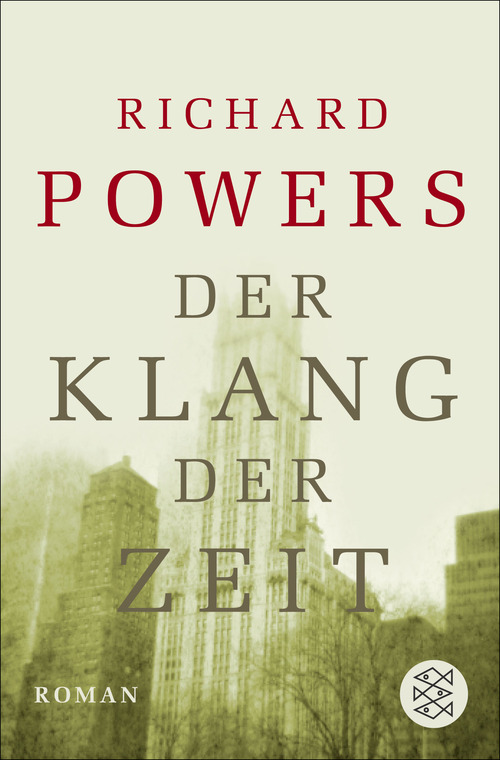
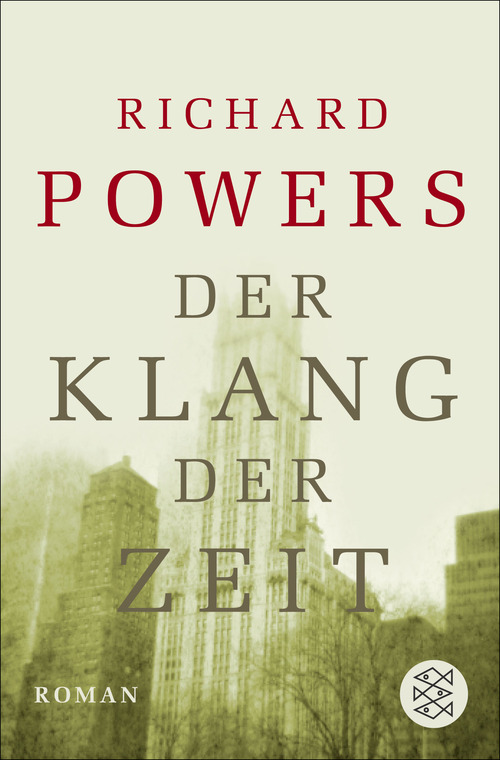
Richard Powers
Der Klang der Zeit
Roman
Aus dem Amerikanischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
FISCHER E-Books

Wie kaum ein anderer ist Richard Powers der Gegenwart auf der Spur: Das Wissen unserer Zeit will er in Geschichten erfahrbar machen, die Verwerfungen emotional erlebbar. Er wurde 1957 geboren und lebt in den USA. Auf sein Romandebüt Drei Bauern auf dem Weg zum Tanz 1985 folgten acht weitere Romane. Sie wurden Bestseller wie Der Klang der Zeit und mehrfach preisgekrönt. 2006 erhielt er den National Book Award für Das Echo der Erinnerung. In der Reportage Das Buch Ich #9 beschreibt Richard Powers den Prozess, als neunter Mensch überhaupt sein Genom vollständig entschlüsseln zu lassen.
Im Fischer Taschenbuch Verlag liegen insgesamt vor: Galatea 2.2, Der Klang der Zeit, Schattenflucht, Das Echo der Erinnerung, Das Buch Ich #9 und Das größere Glück. Bei S.Fischer erschien zuletzt Drei Bauern auf dem Weg zum Tanz.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Erschienen bei FISCHER E-Books
Frankfurt am Main, März 2014
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel
The Time of Our Singing
bei Farrar, Straus&Giroux, New York
© 2003 Richard Powers
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2005
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403167-5
Irgendwo in einem leeren Saal singt mein Bruder noch immer. Seine Stimme ist noch nicht verhallt. Nicht ganz. Wo immer er sang, ist etwas zurückgeblieben, etwas wie Vertiefungen, wie Rillen in den Wänden, die nur darauf warten, dass ein künftiger Phonograph sie wieder zum Leben erweckt.
Mein Bruder Jonah steht reglos an den Flügel gelehnt. Er ist gerade einmal zwanzig. Die sechziger Jahre haben eben erst begonnen. Noch liegt das Land im letzten Schlaf seiner trügerischen Unschuld. Niemand hat von Jonah Strom gehört, niemand außer unserer Familie. Dem, was von ihr übrig ist. Wir sind nach Durham in North Carolina gekommen, in den alten Konzertsaal der Duke-Universität. Jonah hat die Endrunde eines landesweiten Gesangwettbewerbs erreicht, von dem er später behaupten wird, er habe nie daran teilgenommen. Er ist allein auf der Bühne, ein wenig rechts von der Mitte. Zur Seite geneigt, als suche er Rückhalt in der geschwungenen Flanke des Konzertflügels, seiner einzigen Zuflucht. Er beugt sich nach vorn, schweigend, gekrümmt wie die Schnecke eines Cellos. Die linke Hand stützt sich auf die Kante des Flügels, in der rechten hält er einen Brief, den es längst nicht mehr gibt. Er grinst, kann selbst kaum glauben, dass er hier ist, dann holt er Luft – und singt.
Eben noch hockt der Erlkönig auf meines Bruders Schulter und flüstert verführerisch vom Tod. Im nächsten Augenblick tut sich eine Falltür auf, und mein Bruder ist anderswo; ausgerechnet Dowland zaubert er hervor, eine hinreißende kleine Frechheit für die Ohren dieses verblüfften Liederpublikums, das gar nicht merkt, wie es ihm ins Netz geht:
Time stands still with gazing on her face,
Stand still and gaze for minutes, hours, and years to her give place.
All other things shall change, but she remains the same,
Till heavens changed have their course and time hath lost his name.
Zeit steht still, schau ich in ihr Gesicht,
Steh still und schau, Minute, Stund und Jahr, sie schwindet nicht.
Wenn alles auch vergeht, bleibt sie doch ewiglich,
Bis der Planeten Lauf sich kehrt und Zeit heißt nicht mehr Zeit.
Zwei Strophen, und das Lied ist zu Ende. Stille liegt über dem Saal. Sie schwebt über den Reihen wie ein Ballon am Horizont. Zwei Taktschläge, in denen selbst Atmen ein Verbrechen wäre. Dann gibt es nur eins, was diesen Bann bricht: Applaus. Dankbare Hände setzen die Zeit wieder in Gang, der Pfeil nimmt seinen Flug wieder auf und bringt meinen Bruder auf den Weg zu seiner Bestimmung.
So sehe ich ihn, auch wenn er danach noch ein Dritteljahrhundert zu leben hat. Das ist der Augenblick, in dem die Welt ihn entdeckt, der Abend, an dem ich höre, wohin seine Stimme unterwegs ist. Ich selbst bin auch auf der Bühne, sitze an dem zerkratzten Steinway mit den abgegriffenen Tasten. Ich begleite ihn, versuche mit ihm Schritt zu halten und nicht der Sirenenstimme zu lauschen, die mir zuflüstert Lass die Finger ruhen, dein Boot zerschellen an der Tasten Riff, und stirb in Frieden.
Zwar mache ich keine schlimmen Patzer, aber der Abend zählt nicht zu den Höhepunkten meiner musikalischen Laufbahn. Nach dem Konzert bitte ich meinen Bruder noch einmal, er soll mich gehen lassen und sich einen ebenbürtigen Begleiter suchen. Wieder lehnt er ab. »Ich habe schon einen Begleiter, Joey.«
Ich bin mit ihm auf der Bühne. Aber ich bin auch unten im Saal, da, wo ich bei Konzerten immer sitze: In der achten Reihe, links, gleich neben dem Gang. Von meinem Platz aus kann ich mich spielen sehen, kann das Gesicht meines Bruders studieren – nah genug, um alles zu sehen, und doch weit genug ab, dass mich der Anblick nicht um den Verstand bringt.
Eigentlich müssten wir vor Lampenfieber wie gelähmt sein. Der Raum hinter der Bühne ist ein einziges blutendes Magengeschwür. Musiker, die ihre gesamte Jugend mit der Vorbereitung auf diesen Augenblick zugebracht haben, malen sich jetzt aus, wie sie den Rest ihrer Tage damit zubringen werden zu erklären, warum sie in der entscheidenden Sekunde scheiterten. Der Konzertsaal füllt sich mit Neid und Missgunst, Familien, über Hunderte von Meilen angereist, müssen mit ansehen, wie ihr ganzer Stolz auf die hinteren Ränge verwiesen wird. Nur mein Bruder hat keine Angst. Er hat seinen Preis schon gezahlt. Dieser öffentliche Wettbewerb hat nichts mit Musik zu tun. Musik, das sind die Jahre des gemeinsamen Singens im schützenden Schneckenhaus unserer Familie, bevor diese Schale zerbrach und zu Asche verbrannte. Jonah gleitet durch die Angst hinter der Bühne, durch die unterdrückte Übelkeit in den Garderoben, als sei das alles nur die Generalprobe für eine längst abgesagte Aufführung. Auf der Bühne, mitten in diesem Meer aus Panik, wirkt seine Ruhe elektrisierend. Die lässige Hand auf dem schwarzen Lack des Flügels betört die Zuhörer, nimmt den Klang seiner Stimme vorweg, noch ehe er den Mund aufmacht.
Ich sehe ihn an diesem Abend seines ersten öffentlichen Triumphs, aus vier Jahrzehnten Abstand. Das Gesicht ist noch weich um die Augen, da wo das Leben später seine Spuren eingravieren wird. Das Kinn bebt ein wenig bei Dowlands Viertelnoten, doch die Töne sind makellos rein. Er neigt den Kopf nach rechts, als er zum hohen C ansetzt, als weiche er zurück vor den verzückten Zuhörern. Ein Schauder huscht über sein Gesicht, ein Blick, den nur ich erkenne, von meinem Platz hinter dem Flügel. Die Hakennase, die vollen braunen Lippen, die markanten Wülste über den Augen – beinahe mein eigenes Gesicht, nur leidenschaftlicher, ein Jahr älter, einen Ton heller. Der verräterische Ton: der dunkle Schatten unserer Schande.
Der Gesang meines Bruders will die Guten erretten und die Bösen in den Tod treiben. Mit seinen zwanzig Jahren kennt er beide schon sehr genau. Das ist es, was seine Stimme zum Klingen bringt, was seine Zuhörer ein paar Sekunden lang den Atem anhalten lässt, bevor sie die Kraft zum Applaudieren finden. Sie hören den Abgrund, den diese schwerelose Stimme überbrückt.
Das Jahr ist ein verschwommenes Schwarzweißbild, eingefangen von den lauschenden Ohren der Zimmerantenne. Die Welt unserer Kindheit– diese rationierte Radiowelt des großen Kriegs gegen das Böse – wird zum bunten Kodakbild. Ein Mensch fliegt ins All. Astronomen empfangen pulsierende Signale von künstlichen Himmelskörpern. Weltweit spielen die Vereinigten Staaten mit dem Feuer. Berlin kann jeden Augenblick in Flammen aufgehen. Südostasien ist ein Schwelbrand, nur Rauchkringel steigen aus den Bananenblättern auf. Zu Hause staut sich eine Welle von Neugeborenen hinter den Glasscheiben der Säuglingsstationen von Bar Harbor bis San Diego. Unser hutloser, junger Präsident spielt Football auf dem Rasen des Weißen Hauses. Spione, Beatniks und technische Neuerungen aller Art überschwemmen das Land. In Montgomery, Alabama, brennt schon seit fünf Jahren eine Lunte, deren Feuer ich erst fünf Jahre darauf sehen sollte. Und in Durham, North Carolina, lassen sich siebenhundert ahnungslose Menschen in einen Berg entführen, der sich von Jonahs Stimme auftut.
Bis zu diesem Abend hat niemand außer uns meinen Bruder singen hören. Jetzt ist das Geheimnis heraus. Als der Beifall losbricht, sehe ich hinter dem hastig aufgesetzten Lächeln ein Zaudern auf dem rostbraunen Gesicht. Er blickt sich um, sucht einen Schatten jenseits des Rampenlichts, in den er abtauchen kann, doch es ist zu spät. Mit unsicherem Grinsen und einer einzigen, oft geprobten Verbeugung nimmt er sein Urteil an.
Noch zweimal holen sie uns mit ihrem Applaus zurück; beim zweiten Mal muss Jonah mich mit Gewalt auf die Bühne zerren. Dann verkünden die Preisrichter die Gewinner in den einzelnen Sparten – drei, zwei, eins –, als sei die Duke-Universität Cape Canaveral und dieser Wettbewerb der Start einer weiteren Mercury-Kapsel, als sei Amerikas neue Stimme ein weiterer Shepard oder Grissom. Wir stehen hinter der Bühne, die anderen Tenöre umringen Jonah; sie hassen ihn schon jetzt und überhäufen ihn mit Lob. Ich bezwinge den Impuls, auf diese Gruppe einzureden, ihnen zu versichern, dass mein Bruder nichts Besonderes ist, dass alle Bewerber gleich gut gesungen haben. Die anderen werfen Jonah verstohlene Blicke zu, studieren sein nicht einstudiertes Auftreten. Sie analysieren seine Strategie für die nächste Runde. Erst der effektvolle Auftakt mit Schubert. Dann der linke Haken mit Dowland, dieser schwebende, lang gehaltenen Ton über dem hohen A. Das, was sie niemals sehen können, weil sie nicht genug Abstand haben, hat meinen Bruder längst mit Haut und Haaren verschlungen.
Mein Bruder steht in seinem schwarzen Abendanzug im Gewirr der Schnüre hinter der Bühne und mustert die ansehnlicheren unter den Sopranistinnen. Steht still und schaut. Er singt für sie, private Zugaben, nur in seiner Phantasie. Alle wissen, dass er gewonnen hat, und Jonah müht sich, es herunterzuspielen. Die Preisrichter rufen seinen Namen. Unsichtbare Menschen jubeln und pfeifen. Für sie ist er der Sieg der Demokratie, wenn nicht Schlimmeres. Jonah dreht sich zu mir um, zögert den Augenblick hinaus. »Joey. Bruder. Es muss doch eine anständigere Art geben, sein Geld zu verdienen.« Er bricht ein weiteres Gesetz, als er mich mit auf die Bühne zerrt, um den Preis entgegenzunehmen. Und sein erster öffentlicher Triumph eilt mit Riesenschritten der Vergangenheit zu.
Danach schwimmen wir in einem Meer kleiner Freuden und gewaltiger Enttäuschungen. Gratulanten stehen Schlange, um die Gewinner zu beglückwünschen. Eine alte, gebeugte Frau berührt Jonahs Schulter; sie hat Tränen in den Augen. Ich staune über meinen Bruder, denn er spielt weiter seinen Part, als sei er wirklich das ätherische Wesen, das sie nach seinem Auftritt in ihm sieht. »Hören Sie niemals auf mit dem Singen«, sagt sie, dann zieht ihre Pflegerin sie hastig weiter. Ein paar Gratulanten später ein stocksteifer Oberst im Ruhestand, bebend vor Erregung. Sein Gesicht ein Schlachtfeld der Feindseligkeit, so sehr aus der Fassung, dass er es selbst nicht zu fassen vermag. Ich spüre seinen gerechten Zorn, lange bevor er uns erreicht, die Wut, die wir bei Leuten seines Schlages schon allein dadurch auslösen, dass wir uns in die Öffentlichkeit wagen. Er wartet, bis er an der Reihe ist, die Zündschnur seines Zorns wird immer kürzer, genau wie die Schlange der Gratulanten. Vorn angekommen, geht er zum Angriff über. Ich weiß schon vorher, was er sagen wird. Er mustert das Gesicht meines Bruders wie ein unschlüssiger Anthropologe. »Was seid ihr Jungs eigentlich?«
Die Frage, mit der wir groß geworden sind. Die Frage, die keiner von uns Stroms je verstanden hat, geschweige denn beantworten konnte. Ich habe sie schon so oft gehört und bin doch jedes Mal sprachlos. Jonah und ich sehen uns nicht einmal an. Wir sind daran gewöhnt, zu tun, als sei nichts geschehen. Ich will etwas sagen, die Wogen glätten. Aber der Mann wirft mir einen Blick zu, und ich spüre, dieser Blick ist das Ende meiner Jugend.
Jonah hat seine Antwort; ich habe meine. Aber er ist der, der im Rampenlicht steht. Mein Bruder holt Luft, als seien wir noch oben auf der Bühne, die kleine Nuance im Atmen, die mich in die Tasten greifen lässt. Einen winzigen Augenblick lang hat es den Anschein, als wolle er »Fremd bin ich eingezogen« anstimmen. Doch dann schmettert er seine Antwort wie ein Buffo in der komischen Oper:
»I am my mammy’s ae bairn,
Wi’ onco folk I weary, Sir …«
»Meiner Mutter Sohn bin ich,
Fremde Menschen mag ich nicht …«
Sein erster Abend in der Welt der Erwachsenen, doch er ist noch ein Kind voller Übermut, weil er gerade zu Amerikas neuer Stimme gekürt worden ist. Seine Solo-Zugabe erregt allgemeine Aufmerksamkeit. Jonah ignoriert die Köpfe, die sich nach ihm umdrehen. Es ist 1961. Wir sind in einer bedeutenden Universitätsstadt. Man wird nicht wegen Übermuts aufgehängt. Hier hat man schon seit mindestens einem halben Dutzend Jahren niemanden mehr wegen Übermuts gehängt. Mein Bruder lacht, als er den Vers von Burns zum Besten gibt, er glaubt, er könne den Oberst mit acht Takten Humor zum Schweigen bringen. Der Mann wird aschfahl. Sein Körper spannt sich und zuckt, am liebsten würde er Jonah packen und zu Boden stoßen. Aber die Schlange eifriger Bewunderer schiebt ihn weiter und zum Bühnenausgang hinaus, wo ihn, wie der prophetische Blick auf dem Gesicht meines Bruders längst verkündet, der Schlag treffen wird.
Das Ende des Defilees bilden unser Vater und unsere Schwester. So sehe ich sie, von der anderen Seite eines Lebens. Noch unsere, noch eine Familie. Pa grinst wie ein gestrandeter Einwanderer, und genau das ist er ja auch. Nach einem Vierteljahrhundert in diesem Land rechnet er offenbar immer noch damit, dass man ihn verhaftet. »Wenn man dein Deutsch hört, könnte man meinen, du wärst ein Polacke. Von wem hast du deine Aussprache gelernt? Eine Schande!«
Jonah hält unserem Vater die Hand vor den Mund. »Psst, Pa. Um Himmels willen. Erinnere mich dran, dass ich mich nie wieder mit dir in der Öffentlichkeit blicken lasse. ›Polacke‹ ist ein Schimpfwort.«
»›Polacke‹? Du spinnst. Wie sollen sie denn sonst heißen, Bub.«
»Ja, Bub.« Ruth, unsere Stimmenimitatorin, trifft den Ton täuschend echt. Sie ist erst sechzehn, aber am Telefon hat sie sich schon mehr als einmal erfolgreich für ihn ausgegeben. »Wie sollen sie denn sonst heißen, die Leute aus der Polackei?«
Wieder zuckt die Menge zusammen; dieser Blick, der so tut, als sei nichts gewesen. Wir sind ein einziger Verstoß gegen alles, was ihnen heilig ist. Aber hier, im Kreise der klassisch Gebildeten, lächeln sie tapfer in Dur. Sie drängen weiter zu den anderen Gewinnern, lassen uns noch einen letzten Augenblick lang allein, ein letztes Mal geborgen in unserer kleinen Nation. Vater und ältester Sohn tanzen zu den letzten Tönen des Schubert, die noch in dem leeren Konzertsaal widerhallen. Ihre Schultern berühren sich. »Glaub mir«, sagt der Ältere zum Jüngeren. »Ich habe im Leben schon ziemlich viele Polacken kennen gelernt. Beinahe hätte ich ein Mädchen aus der Polackei geheiratet.«
»Dann wäre ich ein Polacke geworden?«
»Ein Beinahe-Polacke. Ein contrafaktischer Polacke.«
»Ein Polacke in einem Paralleluniversum?«
Sie plappern drauflos, kleine Witze über seinen Beruf. Ein Possenspiel für die eine, deren Namen heute keiner von uns nennen wird, die Frau, der wir jede Note des gewonnenen Wettbewerbs darbringen. Ich blicke hinüber zu Ruth, wie sie im Rampenlicht steht, beinahe kastanienbraun – die Einzige, die auf dieser Welt die Züge unserer Mutter bewahrt. Meine Mutter, die Frau, die mein Vater beinahe nicht geheiratet hätte, eine Frau, die mehr und länger Amerikanerin gewesen war als alle, die an diesem Abend im Konzertsaal saßen.
»Du warst auch gut, Joey«, beteuert meine kleine Schwester. »Ehrlich. Wirklich klasse.« Ich umarme sie zum Dank für ihre Lüge, und sie strahlt, ein Juwel. Wir schlendern zurück zu Pa und Jonah. Wieder vereint, die überlebenden vier Fünftel des stromschen Familienchors.
Aber Pa und Jonah brauchen niemanden. Pa hat sich den Erlkönig vorgenommen und Jonah übernimmt die Begleitung, geht in die Tiefen seiner Dreieinhalb-Oktaven-Stimme und versucht sich an etwas, das die linke Hand auf nicht vorhandenen Klaviertasten spielt. Er summt die Begleitung, die er gern von mir gehört hätte. Wie es gespielt werden sollte, in einem himmlischen Traum-Ensemble. Ruth und ich treten hinzu, wir können nicht anders, und übernehmen die Zwischenstimmen. Leute lächeln im Vorübergehen, aus Mitleid oder Scham, nur scheinbar zwei verschiedene Dinge. Doch Jonah ist der aufgehende Stern dieses Abends, für den Augenblick über jede Kritik erhaben.
Die Konzertbesucher werden behaupten, sie hätten ihn gehört. Sie werden ihren Kindern von dem Abgrund erzählen, der sich auftat, davon, dass der alte Konzertsaal auf einmal keinen Boden mehr hatte und sie in einem luftleeren Raum hingen, von dem sie gedacht hatten, die Musik sei dazu da, ihn zu füllen. Aber die Person in ihrer Erinnerung wird nicht mein Bruder sein. Sie werden erzählen, wie sie beim ersten Ton dieser magischen Stimme die Köpfe hoben. Doch die Stimme in ihrer Erinnerung wird nicht die seine sein.
Die wachsende Gemeinde seiner Zuhörer wird zu Jonahs Konzerten pilgern, sie werden die Eintrittskarten teuer handeln und seine Karriere verfolgen, auch noch in den letzten Jahren nach unserer Trennung. Kenner werden seine Platten aufspüren und die Stimme auf der Scheibe fälschlich für die seine halten. Die Stimme meines Bruders ließ sich nicht aufzeichnen. Er hatte etwas gegen alles Dauerhafte, wollte sich nie festlegen lassen, eine Abneigung, die aus jeder Note klingt, die er je aufgenommen hat. Er war ein umgekehrter Orpheus: Blickst du voraus, wird alles, was du liebst, vergehen.
Es ist 1961. Jonah Strom, Amerikas neue Stimme, ist zwanzig. So sehe ich ihn, vierzig Jahre später, acht Jahre älter als mein älterer Bruder je werden wird. Der Saal hat sich geleert, doch mein Bruder singt noch immer. Er singt bis zum letzten Takt, bis alle Bewegung zum Stillstand kommt, bis er in die Finsternis der Fermate eintaucht, ein Junge, der für eine Mutter singt, die ihn längst nicht mehr hören kann.
Diese Stimme war so rein, sie hätte Staatsoberhäupter zur Umkehr bewegen können. Doch wenn sie sang, wusste sie sehr genau, wer da neben ihr herritt. Und wenn es je eine Stimme gab, die eine Botschaft in die Vergangenheit schicken konnte, um zukünftiges Unglück zu verhindern, noch bevor es geschah, dann war es die Stimme meines Bruders.
Aber im Grunde hat nie jemand diese Stimme wirklich gekannt, der nicht zur Familie gehörte und nicht mit ihr an jenen Winterabenden der Nachkriegszeit zusammensaß und sang, als Musik das letzte Bollwerk gegen die Welt draußen war, gegen die immer größere Kälte. Sie wohnten in der einen Hälfte eines dreistöckigen, in einem halben Jahrhundert zu Schokoladenbraun verwitterten Sandsteinhauses im nordwestlichsten Winkel von Manhattan, einem heruntergekommenen Viertel, wo Hamilton Heights in Washington Heights überging und wo die Häuserzeilen so bunt gemischt waren wie ihre Bewohner. Sie wohnten zur Miete, denn David Strom, der Flüchtling, traute der Zukunft nie so weit über den Weg, dass er sich mehr Besitz zugestand, als in einen immer bereitstehenden Koffer passte. Selbst seine Stelle an der Physikalischen Fakultät der Columbia-Universität war etwas so Wunderbares, dass sie ihm mit Sicherheit genommen würde, von den Antisemiten, den Antiintellektuellen, der sich immer weiter ausbreitenden Willkür oder der Wiederkehr der Nazis, die er tagtäglich erwartete. Dass er sich leisten konnte, ein halbes Haus zu mieten, selbst in dieser Gegend, in der gescheiterte Existenzen strandeten, schien David ein unfassbares Glück, wenn er an das Leben zurückdachte, das ihn dorthin geführt hatte.
Delia, seine aus Philadelphia stammende Frau, hatte sich nie daran gewöhnen können, dass sie zur Miete wohnten; es war ihr so fremd wie die abstrakten Theorien ihres Mannes. Sie hatte nie anderswo gewohnt als im Haus ihrer Eltern. Aber auch Delia Strom, geborene Daley, vergaß nie, dass die gnadenlosen Fanatiker dieser Welt durch jede Ritze kommen würden, um ihnen ihr Glück zu nehmen. Und so tat sie alles, womit sie ihrem Mann, dem Flüchtling, den Rücken stärken konnte, und machte aus der stromschen Hälfte des alten Steinhauses eine Festung. Und nichts gab so viel Sicherheit wie die Musik. Die erste Erinnerung aus ihrer Kindheit war bei allen drei Geschwistern die gleiche: Sie hörten ihre Eltern singen. Musik war ihr Mietvertrag, ihre Besitzurkunde, ihr unveräußerliches Recht. Eine jegliche Stimme bezwinge die Stille nach ihrer Bestimmung. Und die Stroms bezwangen die Stille, auf ihre eigene Art, jeden Abend, gemeinsam, in einer Kaskade wirbelnder Töne.
Erste Melodien wehten schon durchs Haus, bevor die Kinder wach waren. Ein paar Takte Barber aus dem Badezimmer kollidierten mit Carmen aus der Küche. Beim Frühstück summten alle durcheinander, eine vielstimmige Rangelei. Gesang bestimmte selbst die Schulstunden, denn die Eltern unterrichteten die Kinder selbst: Delia brachte ihnen Lesen und Schreiben bei, David lehrte sie Rechnen, bevor er nach Morningside zu seiner Vorlesung über die allgemeine Relativitätstheorie aufbrach. Taktangaben illustrierten die Bruchrechnung. Jedes Gedicht hatte seine Melodie.
Am Nachmittag, wenn Jonah und Joey von ihren Zwangsausflügen zum Spielplatz bei St. Luke’s zurückkehrten, fanden sie ihre Mutter am Stutzflügel, wo sie, die kleine Ruth auf dem Schoß, mit ihren Gospels aus dem engen Wohnzimmer ein Lager an den Ufern des Jordans machte. Eine halbe Stunde im Trio endete regelmäßig mit rituellen Kabbeleien zwischen den Jungen, dem eifersüchtigen Ringen darum, wer als Erster die Mutter für sich allein haben durfte. Für den Gewinner begann eine Stunde schönster Klavierduos, der Verlierer des Tages brachte die Schwester nach oben und las ihr vor, oder sie spielten Karten ohne Regeln.
Klavierstunden mit Delia waren für den mit Lob überhäuften Schüler binnen Minuten vorbei, dauerten jedoch ewig für den, der wartete, dass er an die Reihe kam. Wenn der Verlierer anfing, von oben jeden Patzer aufzuzählen, machte Delia auch aus diesen Zwischenrufen ein Spiel. Die Jungs mussten von oben Akkorde bestimmen oder Intervalle ergänzen. Sie ließ sie von den entgegengesetzten Enden des Hauses einen Kanon singen– »By the Waters of Babylon« –, und jeder Bruder spann seine eigene Melodie um die ferne Stimme des anderen. Wenn bei dem Benachteiligten die Grenzen der Geduld erreicht waren, holte sie ihn dazu, einer sang, den anderen setzte sie ans Klavier, und von oben kamen die eigenwilligen Harmonien der kleinen Ruth, die sich nach Kräften mühte, in die Geheimsprache ihrer Familie einzustimmen.
Delia war so begeistert von den Tönen, die ihre Jungen hervorbrachten, dass es den beiden manchmal Angst machte. »Ach, JoJo, ihr zwei! Was für Stimmen! Ihr müsst auf meiner Hochzeit singen!«
»Aber du bist doch schon verheiratet«, rief Joey, der Jüngere. »Mit Pa!«
»Ich weiß, mein Schatz. Kann ich mir nicht trotzdem wünschen, dass ihr auf meiner Hochzeit singt?«
Sie liebten sie zu sehr, die Musik. Wenn es um Sport ging, zuckten die Jungs nur mit den Schultern, und auch die Komiker und Radiodetektive, die schleimigen Monster aus der zehnten Dimension, die Laiendarstellungen der Gemetzel von Okinawa und Bastogne, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden, verloren jeden Reiz, wenn sie stattdessen bei ihrer Mutter am Stutzflügel sitzen konnten. Selbst am späten Nachmittag, wenn die Rückkehr des Vaters nahte und Delia sich um das Abendessen kümmerte, konnte sie die beiden nur mit Gewalt aus dem Haus drängen, wo sie sich von neuem von anderen Jungen quälen lassen mussten, die das grausame Handwerk des Jungenseins besser beherrschten als sie; Jungen, die die beiden Stroms unerbittlich die eigene Verwirrung spüren ließen.
Beide Kriegsparteien im Viertel hielten sich an diesen beiden Verirrten schadlos, mit Worten, Fäusten, Steinen – einmal sogar mit dem Hieb eines Baseballschlägers quer über den Rücken. Wenn die Jungs aus dem Viertel sie ausnahmsweise nicht als Torpfosten oder Zielscheiben beim Hufeisenwerfen benutzten, dann machten sie sich lustig über die linkischen Stroms. Sie verhöhnten Joey, weil er so sanft war, drückten Jonahs Nase, die ihnen nicht passte, in den Dreck. Die beiden Strom-Jungen wurden nicht gern Tag für Tag daran erinnert, dass sie anders waren. Oft gingen sie gar nicht zum Spielplatz, sondern versteckten sich in der Gasse einen halben Häuserblock entfernt, vertrieben einander mit dem Summen von Terzen und Quinten die Angst, bis genug Zeit vergangen war und sie wieder nach Hause stürmen konnten.
Das Abendessen war ein Chaos aus Worten, Scherzen und Streichen, die allabendliche Fortsetzung der Liebesgeschichte von Strom und Daley. Wenn Delia kochte, war ihr Mann aus der Küche verbannt. Für sie war die Art, wie er aus den Töpfen stibitzte, eine Schande für Gott und Natur. Sie sperrte ihn aus, bis auch die letzte geniale Kreation für den Auftritt bereit war – Hühnereintopf mit glasierten Möhren, Braten mit Süßkartoffeln, die kleinen Wunder, die sie in den Minuten vollbrachte, die sie von ihren anderen Vollzeitbeschäftigungen stahl. David erzählte im Gegenzug von den neuesten bizarren Entwicklungen, die es bei seiner surrealen Arbeit gab. Professor für Phantommechanik, spottete Delia immer. Pa, begeisterungsfähiger als alle seine Kinder, erzählte die unglaublichsten Sachen, von seinem Bekannten Kurt Gödel zum Beispiel, der entdeckt hatte, dass sich in Einsteins Feldgleichungen geschlossene zeitartige Kurven verbergen. Oder von der Vermutung Hoyles und Bondis und Golds, dass neue Galaxien in Lücken zwischen den anderen entstehen, wie Unkraut, das aus den Ritzen des brüchigen Universums sprießt. Für die Jungs, die ihm zuhörten, schien die ganze Welt aus deutschsprachigen Flüchtlingen zu bestehen, die, an allen Enden der Welt vor den Nazis in Sicherheit gebracht, drauf und dran waren, Raum und Zeit aus den Angeln zu heben.
Delia schüttelte den Kopf über den Unsinn, der in ihrem Haus als Tischgespräch galt. Die kleine Ruth ahmte ihr Kichern nach. Aber die Jungs, beide noch keine zehn, überboten sich gegenseitig mit Fragen. War es dem Universum egal, in welche Richtung die Zeit floss? Plätscherten die Stunden wie ein Wasserfall? Gab es nur die eine Art von Zeit? Wechselte die Zeit manchmal das Tempo? Wenn die Zeit gekrümmt war, würde die Zukunft dann irgendwann wieder bei der Vergangenheit anlangen? Ihr Vater war besser als die verrückten Wissenschaftscomics, besser als Astounding Stories und Forbidden Tales. Er kam von einem Ort, der viel weiter fort war, und die Bilder waren noch viel unglaublicher.
Nach dem Essen wurde gesungen. Rossini beim Geschirrspülen, W.C. Handy beim Abtrocknen. Am Abend krochen sie durch zeitartige Löcher, fünf Kurven, die sich im wirbelnden Raum ineinander woben, jede davon gekrümmt, sodass sie am Ende wieder bei ihrem Anfang ankam. Bach-Choräle gehörten immer dazu, und Jonah gab den Ton an, der Junge mit dem magischen Ohr. Oder sie versammelten sich um den Stutzflügel und versuchten sich an einem Madrigal, griffen ab und zu in die Tasten, um ein Intervall zu bestimmen. Einmal sangen sie mit verteilten Rollen an einem einzigen Abend eine ganze Gilbert-and-Sullivan-Operette. Nie wieder sollte es so lange Abende geben.
An solchen Abenden hätte man denken können, die Eltern hätten die Kinder zu ihrer eigenen Unterhaltung in die Welt gesetzt. Delias Sopran huschte durch die hohen Register wie ein Blitz am westlichen Himmel. Davids Bass machte mit deutscher Innigkeit wett, was ihm an Eleganz fehlte. Der Ehemann bot der Gefährtin Halt für jeden Höhenflug. Aber beide wussten, was ihre Ehe brauchte, und schamlos ließen sie von den Jungen die Zwischenstimmen übernehmen. Und immer krabbelte die kleine Ruth dazwischen, ließ sich auf den Wogen der Melodien schaukeln, reckte sich auf die Zehenspitzen, damit sie die Notenblätter sehen konnte, die die anderen studierten. Und so lernte auch das dritte Kind der Familie Noten lesen, ohne dass jemand es ihm beibrachte.
Wenn Delia sang, dann sang sie mit ihrem gesamten Körper. So hatte sie es, auch in Philadelphia noch, von Generationen von Müttern gelernt, die es nicht anders aus den Kirchen Carolinas kannten. Wenn sie die Stimme erhob, schwoll ihr die Brust wie der Blasebalg einer Orgel, in die der Heilige Geist gefahren war. Ein Tauber hätte ihr die Hände auf die Schultern legen können und hätte jeden Ton gespürt, seine Finger hätten vibriert wie eine Stimmgabel. David Strom hatte diese Freiheit seit 1940, seit sie geheiratet hatten, von seiner amerikanischen Frau gelernt. Der ungläubige deutsche Jude hüpfte nach inneren Rhythmen, sang seine Gebete so frei, wie seine Urgroßväter, die Kantoren, es getan hatten.
Der Gesang schlug die Kinder in den Bann, sie waren süchtig nach diesen musikalischen Abenden wie die Nachbarn nach ihren Radios. Singen war ihr Baseball, ihr Flohhüpfen, ihr Mensch-ärgere-dich-nicht. Und wenn ihre Eltern dann auch noch tanzten – getrieben von verborgenen Mächten wie die Gestalten in einer Ballade –, dann war das das erste große Geheimnis ihrer Kindheit. Die Strom-Kinder machten mit, drehten sich im Takt von Mozarts »Ave verum corpus« genauso wie zu »Zip-a-Dee-Doo-Dah«.
Die Eltern müssen gehört haben, welche Veränderungen damals mit der Musik vorgingen. Sie müssen das manische Pulsieren gespürt haben – als hätte die halbe Welt plötzlich ihren Rhythmus gefunden, die Erkennungsmelodie zum Leben. Der Swing hatte schon vor langem die Carnegie Hall erobert, der Ungestüm war längst salonfähig. Downtown in den knisternden Bebop-Clubs loteten Parker und Gillespie Abend für Abend die Krümmung des Raum-Zeit-Kontinuums aus. Ein weißer Arbeiterjunge aus einem schwarzen Viertel im moskitoverseuchten Mississippi sollte binnen kurzem den geheimen Puls der schwarzen Musik für alle Welt zum Swingen bringen und für alle Zeiten die blutleeren Foxtrott tanzenden Spießer hinwegfegen. Niemand, der damals dabei war, kann diese Veränderungen nicht bemerkt haben, nicht einmal zwei Leute, die so fernab von allem lebten wie der Physiker, der Flüchtling aus Europa, und seine Frau, die Sängerin, die Arzttochter aus Philadelphia. Nicht dass sie nicht auch die Gegenwart geplündert hätten. Er hatte seine rhythmische Ella, sie ihren volltönenden Ellington. Niemals verpassten sie am Samstag die Übertragung aus der Metropolitan Opera. Aber am Sonntagmorgen wurde im Äther nach Jazz gefischt, während David wagenradgroße Omelettes mit Champignon und Tomate buk. In der stromschen Singschule standen die jungen Wilden gleichberechtigt neben der tausendjährigen Parade von Harmonie und Invention. Fingerschnippen sorgte bei Palestrina erst für den richtigen Schwung. Und Palestrina war ja schließlich auch einmal ein Revolutionär gewesen, einer, der die Welt über den Haufen warf.
Jedes Mal, wenn die Stroms ihre Lungen füllten, führten sie dies musikalische Gespräch fort, über die Zeiten hinweg. In der Musik hatten alle ihre Laute Sinn. Wenn sie sangen, waren sie niemandes Ausgestoßene mehr. Jeden Abend, an dem sie die Stimmen erschallen ließen – der Klang, der David Strom und Delia Daley in diesem Leben zusammengebracht hatte –, betraten sie eine heilere, hellere Welt.
Kein Monat verging, ohne dass Delia und David sich ihrem liebsten öffentlichen Flirt hingaben, einem verrückten Spiel mit musikalischen Zitaten. Die Kandidatin setzte sich auf den Klavierhocker, und rechts und links drückte sich ein Kind an sie. Sie saß da, verriet nicht das Geringste, das wellige schwarze Haar war die perfekte Tarnkappe. Mit langen rostbraunen Fingern drückte sie die Tasten und lockte eine einfache Melodie hervor – etwa das langsame, von den Holzbläsern gespielte Spiritual der Symphonie »Aus der Neuen Welt«. Der Herausforderer hatte dann zwei Wiederholungen lang Zeit für seine musikalische Antwort. Die Kinder sahen gespannt zu, wenn Delias Melodie sich entfaltete, warteten, ob Pa gegen die Uhr eine passende zweite hineinflechten konnte, bevor ihre Mutter den Schlussstrich erreichte. Wenn nicht, machten die Kinder sich in falschem Deutsch über ihn lustig, und seine Frau durfte sich eine Strafe ausdenken.
Er versagte selten. Ehe sich der Kreis von Dvoráks gestohlenem Volkslied geschlossen hatte, hatte er schon eine Möglichkeit gefunden, wie er Schuberts Forelle bachaufwärts dagegen anschwimmen ließ. Damit war nun wieder Delia am Zug. Eine Strophe Zeit blieb ihr, ihrerseits ein Zitat zu finden, das in den neuen Rahmen passte. Eine kurze Überleitung, schon tummelte sich die Forelle im Swanee River.
Die Regeln wurden großzügig gehandhabt. Themen konnten verlangsamt werden bis fast zum Stillstand, und erst wenn die Zeit reif war, wechselte die Tonart. Oder Melodien rasten so schnell vorbei, dass sie zu einzelnen Tönen verschmolzen. Die Melodielinien fächerten sich auf zu langen Choralvorspielen, voll gestopft mit wechselnden Vorzeichen, oder die Phrase endete auf einer anderen Kadenz – alles war erlaubt, solange noch eine Spur der Melodie blieb. Die Worte konnten die originalen sein, aber auch die Fa-la-las der Madrigale oder Blödsinn aus Reklamespots, solange irgendwann im Lauf eines Abends jeder Sänger ihre traditionelle Nonsensfrage unterbrachte: »Doch wo, aber wo, bauen sie ihr Nest?«
Das Spiel stiftete die wildesten Mischehen, verkuppelte Liebespaare, die selbst der Halbblut-Himmel misstrauisch beäugte. Ihre Altrhapsodie zankte sich mit seinem geknurrten Dixieland. Cherubini schmetterte mitten hinein in einen Cole Porter. Eine unheilige Ménage à trois aus Debussy, Tallis und Mendelssohn. Nach ein paar Runden waren die Knoten aus Akkorden so dick, dass sie von ihrem eigenen Gewicht zu Boden gingen. Wechselgesang endete in übermütigem Grölen, und wer dabei vom Karussell geschleudert wurde, warf dem anderen vor, er hätte ihn mit unfairen Harmonien hinuntergeschubst.
Bei einem solchen Spiel, beim Melodienwettstreit an einem kalten Dezemberabend des Jahres 1950, bekamen David und Delia Strom zum ersten Mal eine Ahnung davon, was sie in die Welt gesetzt hatten. Der Sopran begann mit einer langsamen, üppigen Melodie, Haydns Deutschem Tanz Nr. 1 in D-Dur. Darüber legte der Bass ein wackliges »La donna è mobile«. Das Ganze war so albern und so absurd, dass ein erwidertes Grinsen genügte, und die Ungeheuerlichkeit ging in eine zweite Runde. Doch bei dieser Reprise löste sich etwas aus dem Durcheinander, eine Melodie, die von keinem der beiden Eltern stammte. Der erste Ton kam so klar und rein, dass die zwei Erwachsenen einen Moment lang brauchten, bis sie begriffen, dass das keine aus den beiden Echos entstandene Geisterstimme war. Sie sahen erschrocken zuerst einander, dann ihren älteren Sohn Jonah an, der ohne eine einzige falsche Note Josquins Absalon, fili mi sang.
Die Stroms hatten das Stück einige Monate zuvor vom Blatt gesungen und dann als zu schwer für die Kinder beiseite gelegt. Dass der Junge es komplett behalten hatte, war für sich schon ein Wunder. Und als es Jonah gelang, die Melodie in die beiden einzupassen, die schon im Umlauf waren, da spürte David Strom wieder die Erregung, die er zum ersten Mal empfunden hatte, als sich die Stimme seines Jungen über den doppelten Eingangschor von Bachs Matthäuspassion erhoben hatte. Beide Eltern hielten abrupt inne und starrten den Jungen an. Das Kind starrte verlegen zurück.
»Was habt ihr? Habe ich was falsch gemacht?« Das Kind war noch nicht einmal zehn. Das war der Tag, an dem David und Delia Strom begriffen, dass ihr Erstgeborener ihnen bald genommen würde.
Jonah brachte den Trick seinem kleinen Bruder bei. Joseph steuerte vom folgenden Monat an seine eigenen verrückten Zitate bei. Von da an improvisierte die Familie ihre hybriden Schöpfungen im Quartett. Die kleine Ruth weinte; sie wollte mitspielen. »Ach, Kleine!«, sagte ihre Mutter. »Nicht traurig sein. Du wirst schneller in der Luft sein als alle anderen. Nicht mehr lange, und du kannst fliegen.« Sie gab Ruth Kleinigkeiten zum Üben – die Melodie aus der Texaco-Reklame oder »You Are My Sunshine« –, während die anderen dafür sorgten, dass Joplin-Rags und Fetzen aus Puccini-Arien sie in friedlicher Eintracht umtanzten.
Sie sangen fast jeden Abend miteinander, übertönten das ferne Dröhnen des Verkehrs auf der Amsterdam Avenue. Für beide Eltern war es das Einzige, was sie an das Zuhause erinnerte, das sie verloren hatten. Niemand hörte sie außer ihrer Vermieterin Verna Washington, einer rüstigen kinderlosen Witwe, die in der anderen Hälfte des Brownstone wohnte und die gern an der Mittelwand lauschte, damit sie ein wenig von der überschäumenden Fröhlichkeit abbekam.
Die Sicherheit, mit der die Stroms sangen, war etwas Körperliches, etwas Angeborenes, es war die Augenfarbe der Seele. Beide Eltern brachten musikalische Gene mit: er den Mathematikerverstand für Rhythmus und Spannungsbögen, sie die Tonsicherheit der Sängerin, zielstrebig wie eine Brieftaube, und die Farbigkeit, so fein wie die Flügel eines Kolibris. Keiner der beiden Jungen wäre auf die Idee gekommen, dass es etwas Besonderes war, wenn ein Neunjähriger mit der Selbstverständlichkeit, mit der er atmete, vom Blatt singen konnte. Sie brachten eine Melodie so mühelos auf die Welt wie ihre vergessenen Vettern auf die Bäume kletterten. Man musste ja nur den Mund öffnen und die Stimme herauslassen; man machte mit den Tönen einen Ausflug hinunter zum Riverside Park, dahin, wo ihr Vater an einem sonnigen Sonntagnachmittag manchmal mit ihnen spazieren ging: hinauf, hinunter, Kreuz, b, lang, kurz, East Side, West Side, quer durch die Stadt. Jonah und Joseph mussten nur einen Blick aufs Notenblatt werfen, die Notenköpfe der Akkorde gestapelt zu winzigen Totempfählen, und schon hörten sie die gesamte Melodie.
Manchmal kamen Besucher ins Haus, stets zum gemeinsamen Musizieren. Alle zwei Monate wurde das Quintett zum Kammerchor, verstärkt durch Delias Gesangschüler oder Soprankolleginnen aus dem Kirchenchor. Physiker von Columbia und aus dem City College kamen nach Feierabend mit ihren Instrumenten und machten aus dem Heim der Stroms ein kleines Wien. Einmal an einem turbulenten Abend hörte ein alter Geigenspieler aus New Jersey mit weißer Mähne und mottenzerfressenem Pullover, der sich mit David auf Deutsch unterhielt und Ruth mit unverständlichen Scherzen ängstigte, Jonah singen. Anschließend schimpfte er Delia Strom dermaßen aus, dass sie am Ende in Tränen aufgelöst war. »Das Kind ist begabt. Sie hören gar nicht, wie begabt es ist. Sie sind zu nahe daran. Es ist unverzeihlich, dass Sie nichts für ihn tun.« Der alte Physiker bestand darauf, dass der Junge die beste Ausbildung bekommen müsse, die zu haben sei. Nicht einfach nur einen guten Privatlehrer. Er müsse eintauchen in die Welt der Musik, damit das geradezu beängstigende Talent, das in ihm stecke, zur vollen Größe geweckt werde. Er werde Geld für ihn sammeln, drohte der große Mann, falls es daran scheitere.
Aber es lag nicht am Geld. David hatte Einwände: Keine Musikschule könne ihm so viel bieten wie seine Mutter. Delia weigerte sich, den Jungen einem Lehrer zu überlassen, der vielleicht seine Eigenart nicht verstand. Der Strom-Familienchor hatte seine eigenen Gründe, warum er seine Engelsstimme nicht hergeben wollte. Aber sie wagten nicht, sich dem Mann zu widersetzen, der das bizarre Geheimnis der Zeit enträtselt hatte, das Geheimnis, das sie gehütet hatte, seit es überhaupt Zeit gab. Einstein war Einstein, auch wenn er Geige spielte wie ein Zigeuner. Er redete so lange, bis die Stroms sich in das Unvermeidliche fügten. Als das neue Jahrzehnt begann und die so lange versprochene Zukunft Wirklichkeit werden sollte, machten Jonahs Eltern sich auf die Suche nach einer Musikschule, die das Talent, vor dem sie sich fürchteten, ans Licht bringen konnte.
Einstweilen ging der Unterricht zu Hause weiter. Nie konnten die Kinder genug bekommen, und die Schulstunden des Tages gingen nahtlos in den Chorgesang und die musikalischen Spiele des Abends über. Delia kaufte für das Zimmer der Jungen einen Phonographen, so groß wie ein Nähmaschinenschrank. Abend für Abend schliefen die Jungen zum Klang der neuartigen Langspielplatten ein, Platten mit Aufnahmen von Caruso, Gigli und Gobbi. Kleine, blecherne, kreideweiße Stimmen stahlen sich durch diese elektrische Pforte ins Zimmer, schmeichelten Klarer, voller, dynamischer als je zuvor.
Und einmal, während der Gespensterchor ihn in den Schlaf sang, sagte Jonah seinem Bruder voraus, wie es kommen würde. Er wusste, was ihre Eltern vorhatten. Er prophezeite genau was geschehen würde. Sie würden ihn fortschicken, gerade, weil er genau das getan hatte, was die Familie sich am meisten von ihm wünschte. Sie würden ihn für alle Zeiten verstoßen, nur weil er gesungen hatte.
Das Gesicht meines Bruders war ein Schwarm Fische. Sein Lächeln ein Gewimmel von hundert verschiedenen Dingen. Ich habe ein Foto aus meiner Kindheit – eins der wenigen, die der Einäscherung entgangen sind. Darauf sitzen wir beide auf dem alten geblümten Sofa in unserem Wohnzimmer und packen Weihnachtsgeschenke aus. Seine Augen sind überall zugleich, wollen alles erfassen: Sein eigenes Geschenk, ein dreifach ausziehbares Teleskop; mein Geschenk, ein Metronom; Ruthie, die neugierig sein Knie umklammert; unseren fotografierenden Vater, ganz vertieft in den Versuch, die Zeit festzuhalten; Mama, gerade jenseits des Bildrands; den zukünftigen Betrachter, der hundert Jahre später einen Blick auf diese Weihnachtsidylle wirft, wenn wir alle längst tot sind.
Mein Bruder hat Angst, er könne etwas verpassen. Angst, dass der Weihnachtsmann die Geschenke vertauscht hat. Angst, mein Geschenk könne schöner sein als das seine. Mit der einen Hand hält er Ruth, damit sie nicht fällt und sich den Kopf an der Tischkante stößt. Mit der anderen greift er hastig nach oben und streicht sich die Stirnlocke glatt – die Haare, die unsere Mutter ihm so gerne gebürstet hat –, damit sie auf dem Foto nicht bis in alle Ewigkeit hoch steht wie ein selbst gebastelter Angelköder. Er tut alles, dass es ein gutes Bild wird, das gibt er unserem Vater durch sein Lächeln zu verstehen. Sein Blick huscht voller Mitleid zu unserer Mutter, die für immer ausgeblendet bleibt.
Das Foto ist eine der ersten Polaroid-Aufnahmen. Unser Vater liebte geniale Erfindungen, und unsere Mutter liebte alles, was Erinnerungen festhielt. Das Schwarzweißbild ist ausgebleicht – so sehen die späten vierziger Jahre jetzt überall aus. Ich kann dem Hautton meines Bruders auf der Fotografie nicht trauen, kann nicht ermessen, wie er damals auf andere gewirkt hat. Meine Mutter war die hellste unter ihren Geschwistern, und mein Vater ein blasser europäischer Jude. Jonah lag genau dazwischen. Die Haare schon eher wellig als gelockt, und ein winziges bisschen dunkler als rot. Die Augen braun; zumindest das hat sich nie verändert. Die Nase ist schmal, die Wangen hoch und schlank. Woran mein Bruder am ehesten erinnert, ist ein bleicher, asketischer Araber.
Sein Gesicht, das ist die Tonart E, die Tonart für schön; es ist das Gesicht, das ich auf der ganzen Welt am besten kenne. Es sieht aus wie Vaters wissenschaftliche Zeichnungen, ein offenes Oval mit vertrauensvoll blickenden halben Mandeln als Augen: Ein Gesicht, das für mich immer der Inbegriff eines Gesichts bleiben wird, mit diesem Ausdruck von ansteckender Freude, ein bisschen überrascht, die Haut straff über den runden Knochen gespannt. Ich habe dieses Gesicht geliebt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich so aussehen könnte, wäre ich frei.
Schon damals hatte er das aufmerksame Misstrauen, die unschuldige Wachsamkeit. Seine Züge werden schärfer, von Monat zu Monat. Die Lippen werden schmaler, die Augenbrauen ziehen sich zusammen. Die Nase wirkt strenger, die Wangen werden hohl. Doch selbst viel später noch hatte er manchmal diesen offenen Blick, die Mundwinkel hochgezogen, bereit zum Scherzen, sogar mit seinen Mördern. Ich habe ein ausziehbares Teleskop zu Weihnachten bekommen. Und du?
Eines Abends nach dem Beten, fragte er unsere Mutter: »Woher kommen wir eigentlich?« Er kann damals nicht älter als zehn gewesen sein; er war beunruhigt, weil Ruth so anders aussah als wir beide. Sogar mich betrachtete er mit Besorgnis. Vielleicht konnte man den Schwestern in der Klinik ebenso wenig trauen wie dem Weihnachtsmann. Er war in einem Alter, in dem er den Farbunterschied zwischen Mama und Pa nicht mehr für Zufall halten konnte. Er sammelte Beweise, und die Last war erdrückend. Ich lag in meinem Bett, direkt neben dem seinen, und wollte ganz schnell noch ein paar Seiten in meinem Cosmic-Carson-Comic lesen, bevor das Licht ausgeschaltet wurde. Doch ich hielt inne, um Mamas Antwort auf die Frage zu hören, die mir selbst nie in den Sinn gekommen war.
»Wo ihr hergekommen seid? Ihr Kinder?« Wenn eine Frage sie unerwartet traf, wiederholte Mama sie erst einmal. Damit gewann sie zehn Sekunden. Wann immer etwas Ernst wurde, wurde ihre Stimme leise, piano, und nahm den butterweichen Mezzoton an. Sie rutschte ein wenig auf der Matratzenkante hin und her, wo sie saß und ihn streichelte. »Ich bin froh, dass ihr das fragt. Ihr seid alle drei ein Geschenk der Glückseligkeit. Bruder Wunder hat euch gebracht.«
Jonahs Gesicht zuckte misstrauisch. »Wer soll das sein?«
»Wer das sein soll? Wieso seid ihr so neugierig? Habt ihr das von mir oder von eurem Vater? Bruder Wunder heißt Glück-selig-keit. Selig ist sein mittlerer Name.«
»Und Wunders Bruder? Hat der auch einen Namen?«
»Schmuel«, antwortete mein Vater, a tempo, von der Tür her.
»Schmuel Wunder?«
»Sicher. Warum denn nicht? Die heißen ja nicht umsonst Wunder.«
»Jetzt aber ehrlich, Pa. Woher kommen wir?«
»Eure Mutter und ich haben euch in der Tiefkühltruhe vom A & P gefunden. Wer weiß, wie lange ihr da gelegen habt. Dieser Mr. Wunder behauptete, ihr gehörtet ihm, aber er konnte keine Quittung vorweisen.«
»Bitte, Pa. Die Wahrheit.«
Wahrheit war ein Wort, mit dem unser Vater niemals Scherze trieb. »Ihr kommt aus dem Bauch eurer Mutter.«
Darauf konnten wir zwei nur hilflos lachen. Unsere Mutter warf die Arme in die Luft. Ich sehe es noch vor mir, wie sich ihre Muskeln spannten, selbst heute noch, wo ich doppelt so alt bin wie sie damals. Mit erhobenen Armen sagte sie: »Jetzt haben wir den Salat.«
Vater setzte sich. »Früher oder später muss es sein.«
Aber von Salat war dann nicht mehr die Rede. Jonah hatte das Interesse verloren. Sein Lachen klang angestrengt, dann starrte er vor sich hin und schnitt Grimassen. Er glaubte ihnen – was immer es Verrücktes war, was sie ihm erzählen wollten. Er legte Mama die Hand auf den Arm. »Ist ja egal. Ich will gar nicht wissen, wo wir herkommen. Solange wir nur alle von derselben Stelle kommen.«
Alle waren begeistert von meinem Bruder, als er in seiner ersten Musikschule vorsang. Genau wie ich es vorausgesagt hatte, ganz gleich, was mein Vater von Prophezeiungen halten mochte. Die Schule – unter denen, die aufs Konservatorium vorbereiteten, eine der zwei angesehensten der Stadt – lag in Midtown, an der East Side. Ich weiß noch, dass Jonah, als er schon in dem viel zu großen burgunderroten Blazer steckte, Mama fragte: »Wieso willst du denn nicht mit?«
»Ach, Jo! Natürlich würde ich gern mitkommen. Aber wer soll denn hier bleiben und auf die kleine Ruth aufpassen?«
»Die kann doch auch mitkommen«, protestierte Jonah, obwohl er damals schon wusste, wohin wir gehen konnten und wohin nicht.
Mama antwortete nicht. Sie umarmte uns im Flur. »Bye-bye, JoJo.« Der Name, bei dem sie uns beide zusammen rief. »Blamiert mich nicht.«