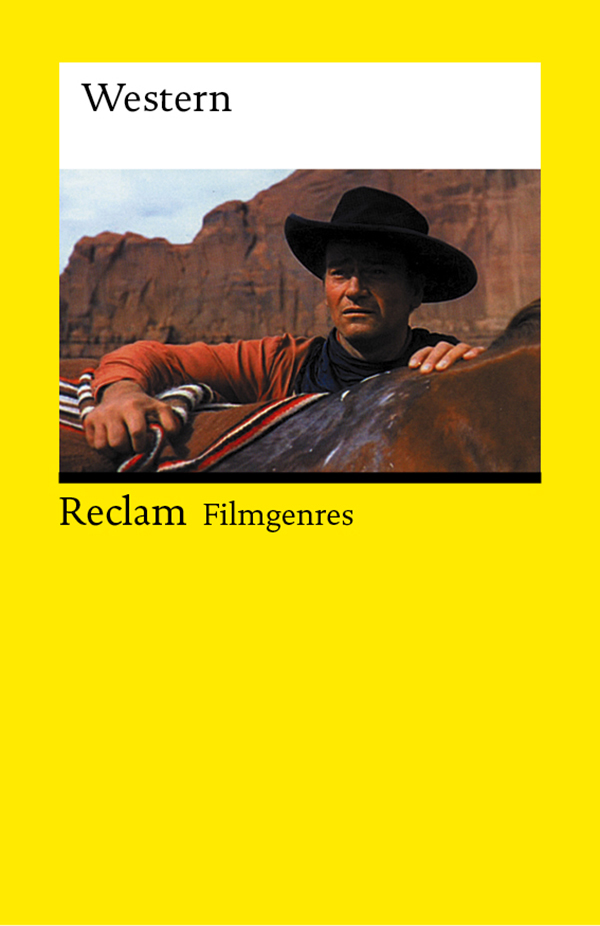
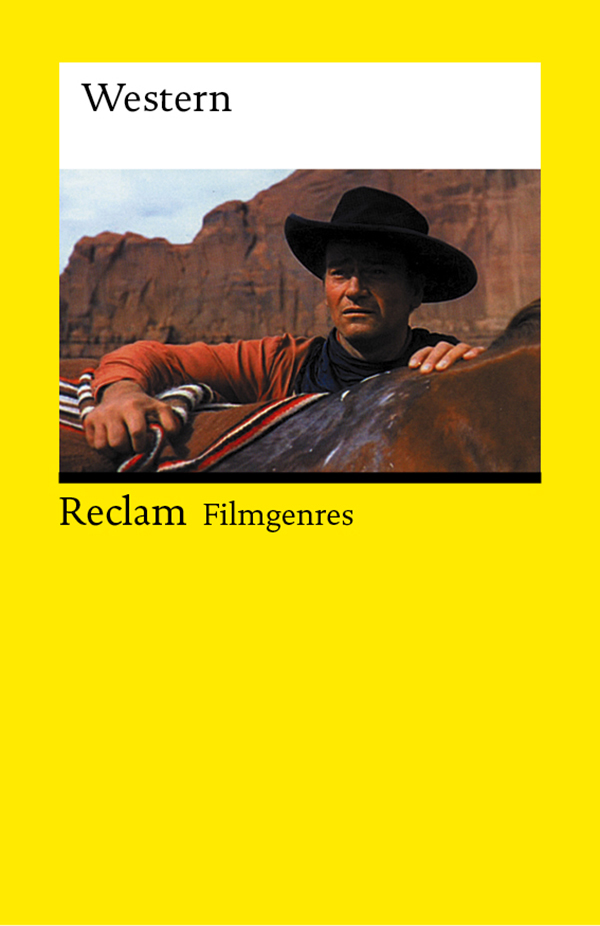
Filmgenres
Western
Herausgegeben von
Bernd Kiefer und Norbert Grob
unter Mitarbeit von
Marcus Stiglegger
Reclam
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Umschlaggestaltung: John Wayne, Szenenfoto aus Der schwarze Falke / The Searchers (Mit Genehmigung des Film Museums Berlin / Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin)
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2014
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN: 978-3-15-960126-7
ISBN der Buchausgabe: 978-3-15-018402-8
www.reclam.de
Inhalt
Vorbemerkung
Einleitung
Der große Eisenbahn-Überfall
Der Planwagen
Das eiserne Pferd
Galgenvögel
Der Virginier
Die große Fahrt
Texas Rangers
Der Held der Prärie
Jesse James – Mann ohne Gesetz
Ringo / Höllenfahrt nach Santa Fé
Herr des wilden Westens
Die Frau gehört mir
In die Falle gelockt
Feuer am Horizont
Faustrecht der Prärie / Tombstone
Duell in der Sonne
Red River / Panik am roten Fluss
Der Teufelshauptmann
Westlich St. Louis
Der Scharfschütze / Scharfschütze Jimmy Ringo
Winchester ’73
Der gebrochene Pfeil
Colorado
Zwölf Uhr mittags
Arena der Cowboys
Mein großer Freund Shane
Wenn Frauen hassen
Vera Cruz
Fluss ohne Wiederkehr
Über den Todespass
Die gebrochene Lanze / Arizona
Mit stahlharter Faust
Drei Rivalen
Der schwarze Falke
Die letzte Jagd / Satan im Sattel
Der Siebente ist dran
Zwei rechnen ab
Vierzig Gewehre
Weites Land
Auf der Kugel stand kein Name
Rio Bravo
Der Besessene
Alamo
Zwei ritten zusammen
Der Mann, der Liberty Valance erschoss
Einsam sind die Tapferen
Der Schatz im Silbersee
Die blaue Eskadron
Für eine Handvoll Dollar
Django
El Dorado
Die gefürchteten Vier
Das Schießen
Leichen pflastern seinen Weg
The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz
Spiel mir das Lied vom Tod
Butch Cassidy und Sundance Kid / Zwei Banditen
Das Wiegenlied vom Totschlag
McCabe und Mrs. Miller
Keine Gnade für Ulzana
Jeremiah Johnson
Ein Fremder ohne Namen
Pat Garrett jagt Billy the Kid
Der Texaner
Heaven’s Gate – Das Tor zum Himmel
Silverado
Der mit dem Wolf tanzt
Erbarmungslos
Geronimo
Dead Man
Open Range – Weites Land
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Register der Filmtitel
Hinweise zur E-Book-Ausgabe
Für Frieda Grafe
und Brigitte Desalm
Vorbemerkung
Rund 70 Western – ausgewählt aus einer unüberschaubaren Anzahl, die in den letzten hundert Jahren (zwischen 1903 und 2003) gedreht wurde. Darin liegt unausweichlich eine enorme Beschränkung. Joe Hembus listet in seinem Western-Lexikon bei Hanser über 1200 Filme auf, sein Sohn Benjamin in der Taschenbuchausgabe bei Heyne über 1500, Georg Seeßlen in seinem Standardwerk »Western-Kino« zunächst 128, später 178.
Von Anfang an war deshalb eher an eine Hommage an den Western gedacht, an eine würdigende Erinnerung eines scheinbar kaum mehr zeitgemäßen Genres. Wir haben viele Kollegen gefragt – Journalisten, Regisseure, Historiker, Wissenschaftler. Die Reaktion war überwiegend positiv, manchmal sogar enthusiastisch. Und jeder hatte seine Vorlieben: für eine spezielle Epoche, einen einzelnen Regisseur, ein besonderes Subgenre.
Selbstverständlich waren unbestreitbare Klassiker neu zu sehen: Victor Flemings The Virginian, John Fords Stagecoach, Fred Zinnemanns High Noon und Georges Stevens’ Shane – aber auch Michael Ciminos Heaven’s Gate, Kevin Costners Dances With Wolves, Clint Eastwoods Unforgiven. Daneben sollten aber auch entlegene Filme gewürdigt werden, die spezielle Facetten des Genres entfaltet haben: William Wylers Hell’s Heroes, Jacques Tourneurs Canyon Passage, Jack Arnolds No Name on the Bullet, John Waynes The Alamo, Monte Hellmans The Shooting.
Letztlich wird eine solche Auswahl immer auch ein Spiel sein – mit persönlichen Vorlieben, wohl auch spontanen Einfällen. Jacques Rivette würde wohl The Naked Spur vermissen, François Truffaut Buchanan Rides Alone, Jean-Luc Godard True Story of Jesse James. Und Philip French suchte vergeblich einen Burt Kennedy-Western. Doch kein Kanon, auch nicht der umfangreichste, kann je erschöpfend, gar definitiv sein.
Am Anfang stand eine Liste mit rund 100 Western, und die Autorinnen und Autoren, die wir um Mitarbeit baten, sahen erneut mehrere Filme und entschieden sich dann für diesen oder jenen – und manchmal für einen ganz anderen Film. So kam es, dass etwa von den frühen King Vidors jetzt The Texas Rangers enthalten ist – und nicht Billy the Kid; von den Klassikern Anthony Manns Winchester ’73 und The Far Country – und nicht Man of the West; und von den späten John Fords Two Rode Together – und nicht Cheyenne Autumn.
Zu danken haben wir: dem Fotoarchiv des Filmmuseums in Berlin, der Bibliothek des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt a. M., der WDR-Filmredaktion (insbesondere Helmut Merker) sowie Frank Arnold und Karlheinz Oplustil, die uns ihre Videoarchive bereitwillig öffneten.
Last but not least sind wir unseren Autorinnen und Autoren zu Dank verpflichtet: Frieda Grafe und Enno Patalas, Rudolf Thome und Wim Wenders, weil sie uns ihre schönen Texte überließen. Aber auch all den anderen, weil sie es hinnahmen, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden konnte.
So ist das Buch in erster Linie eine labour of love, kein Lexikon der »besten Western aller Zeiten«, sondern ein Angebot, die Lust am Sehen von Western wieder zu erwecken bzw. neu zu entfachen.
Folgende Abkürzungen wurden verwendet: R = Regie, B = Buch, K = Kamera, M = Musik, D = Darsteller; s/w = schwarzweiß, f = farbig, min = Minuten; UA = Uraufführung.
USA = Vereinigte Staaten von Amerika, D = Deutschland, E = Spanien, F = Frankreich, I = Italien, YU = Jugoslawien.
***
Leider haben Frieda Grafe und Brigitte Desalm das Erscheinen dieser »Western-Klassiker« nicht mehr erlebt. Brigitte konnte den schon zugesagten Text nicht mehr schreiben. Friedas Kurz-Essay über Samuel Fullers Forty Guns, dessen Nachdruck sie uns noch gestattete, zählt zu den schönsten Texten, die je über einen Western geschrieben wurden. Ihrem beider Andenken sei dieses Buch gewidmet.
|
Frühjahr 2003 |
Norbert Grob |
Einleitung
Western sind eher naive Filme: über Menschen an der Grenze zur Wildnis, in den USA, Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre1 des 19. Jahrhunderts.
Auf drei Epochen der realen Geschichte Amerikas rekurrieren die klassischen Western. Da ist zunächst die Eroberung des Landes im Westen und der grausame Kampf gegen die Indianer; dann die Zeit nach der Inbesitznahme des Landes, als die Städte aufgebaut und organisiert wurden; schließlich die Epoche nach der Eroberung und Zivilisierung, die Jahre der Rivalität zwischen Viehzüchtern und Farmern, zwischen den Pionieren, die schon da waren, und denen, die noch neu hinzukamen, auch zwischen Zivilisierten und Outlaws. Für Jean Mitry spiegelte sich diese historische Entwicklung in der ästhetischen Reifung des Genres wider, in der – nach der Epoche der naiven Western – die Filme stetig komplexer wurden: vom epischen über den dramatischen zum psychologischen Western.2
Der Typus des Westernhelden bildete sich allerdings unabhängig von dieser epochalen Differenzierung. Die Männer des Western bewegen sich da – mit Revolver im Gürtel – auf Pferden durch weite, oft raue und kantige Landschaften, suchen an Flüssen nach einer Furt oder in den Bergen nach einem Pass oder ruhen am Lagerfeuer in der Prärie. Dann, auf Ranches oder Farmen oder in kleinen Städten, geraten sie in einen Konflikt und werden zum Handeln gezwungen – und gewinnen durch dieses Handeln zugleich ihre Identität und zeigen, wer und was sie im Innersten sind. Diese Westerner mögen dabei sterben oder schwer verwundet werden oder einfach weiterziehen, immer setzen ihre Taten ein Signal, das von Mut und Entschlossenheit kündet; und von individueller Würde, die sie dem Wirrwarr aus Gier, Intrige und Gewalt, aus Geschäfts- und Machtinteressen entgegensetzen.
Westerner sind positive Helden, die in einem Spannungsfeld agieren zwischen ihrem Sinn für die Gemeinschaft und ihrem Hang zu einsamen Entscheidungen und Alleingängen. Häufig befinden sie sich anfangs an einem Wendepunkt: suchen nach neuen Trails (wie in The Covered Wagon, 1923, und The Iron Horse, 1924) oder kommen in eine fremde Stadt (wie in My Darling Clementine, 1946, The Man from Laramie, 1955, und Johnny Guitar, 1956) oder bemühen sich um eine friedfertigere Ordnung auf einer Ranch (wie in The Virginian, 1929, und Red River, 1948) oder sind auf Rache aus (wie in Stagecoach, 1939, und The Naked Spur, 1952, The Searchers, 1956, und Ride Lonesome, 1959) oder suchen ein ruhigeres Leben zu führen (wie in Shane, 1952, und The Big Country, 1958) oder wollen sich gerade verändern, beruflich und räumlich (wie in High Noon, 1952, und Dances with Wolves, 1991). Dann aber gelingen ihnen die geplanten Veränderungen nicht, weil andere sie herausfordern oder angreifen oder in etwas hineinziehen, das ihnen überhaupt nicht passt. So werden sie zum Handeln gezwungen, because there is something a man can’t run away from.
Als Genre ist der Western »ein Tanzfest auf der Grabplatte der Helden: Ballade und Ballett. […] Wie der Tanz hat der Western seine strenge Form und Choreographie. Die Figuren und ihre Bewegungen sind vorgegeben. Man erkennt sie sofort und sieht ihre nächsten Schritte voraus. Der Reiz besteht in der leichten Variation des festen Schemas, in der Ausfüllung der choreographischen Form durch ein Minimum an Psychologie, Plausibilität und Realismus, in der Haftung des Mythos an einer geschichtlichen Epoche, im Rhythmus von Bewegung und Ruhe, von Tragik und Komik. Im Kern ist der Western Musik, Projektion eines Westernsongs auf die Kinoleinwand.«3
In John Fords The Searchers weisen The Sons of the Pioneers in ihrem Lied aufs Zentrum dieser Western-Geschichten: »What makes a man do wander? / What makes a man do roam? / […] / A man will search his heart and soul, / go searching way out there / Yes, peace of mind he knows he’ll find. / But where, oh Lord, oh where? / Ride away, ride away, ride away.«
Wegen dieser naiven, doch gleichzeitig auch mythischen Kraft des Genres, die im Grunde (von wenigen Ausnahmen abgesehen) nachwirkte bis Mitte der 40er-Jahre, nannte André Bazin den Western auch »das amerikanische Kino par excellence«.4 Galoppierende Pferde, Menschen in Spannung zur Natur um sie herum, Schlägereien, all diese »auf die äußerste Spitze getriebenen ständigen Bewegungen« sind schon visuelle Attraktionen der besonderen Art, für Bazin letztlich aber »nur die Zeichen oder Symbole seiner eigentlichen Realität, nämlich des Mythos. Der Western wurde geboren aus dem Zusammentreffen einer Mythologie und einer Ausdrucksform«,5 der Mythologie, die gründete in der schon in Liedern, Märchen, Legenden und Romanen verklärten amerikanischen Geschichte zwischen 1776 und 1900, und der Ausdrucksform des Kinos, der fotografischen Objektivität in der Zeit. Unter dem Titel Gunfighter Nation hat der Kulturhistoriker Richard Slotkin 1992 die Evolution des Genres mit der Geschichte Amerikas im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert des Kinos, derart parallelisiert, dass sich die Einsicht ergibt: »Der Western ist amerikanische Geschichte.«6 Geschichte, die zum Mythos wurde.
Tanzfest auf der Grabplatte der Helden
Die historische Situation in den USA Mitte bis Ende des vorletzten Jahrhunderts bildet, wie oben bereits angedeutet, den Ausgangspunkt, von dem aus vom Entstehen der Zivilisation und von der Geburt einer Nation erzählt wurde. Wobei dieses Erzählen als »rewriting and reinterpreting« zu verstehen ist7. Was den Western strukturiert, sind die beiden Archetypen der Mythologie Amerikas: der Mythos der frontier, der Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation im Gefolge der Eroberung des Kontinents, also der Ära des Wild West, und der Mythos der regeneration through violence, der permanenten Erneuerung und Wiedergeburt Amerikas aus und durch die Gewalt im Kampf von Gut gegen Böse.
Der Begriff des Mythos zielt auf eine besondere Form der Welterfahrung. Mythos meint den Komplex traditioneller, amerikanischer Erzählungen, die zunächst mündlich tradiert und dann schriftlich fixiert worden sind. Erzählungen, in denen die Erfahrungen einer neuen, unbekannten Welt symbolisch gedeutet und zu Geschichten verarbeitet wurden, die später dem Verständnis amerikanischer Geschichte/Historie dienten. Mythos umfasst Berichte, Erzählungen, Legenden, in denen die amerikanische Kultur sich über sich selbst verständigt und die strukturiert werden durch oppositionelle Spannungsverhältnisse zwischen Wildnis und Zivilisation, Indianern und Weißen, Natur und Stadt, Naturrecht und Gesetz, Freiheit und Bindung, Mann und Frau.
Historisch situiert sind die Geschichten der Western in der Zeit zwischen der Gründung der USA 1776 und dem sich durchsetzenden Industriezeitalter, in der Ära, in der die Natur des unermesslich weiten Landes erobert, kultiviert und besiedelt wurde. Aus Siedlungen wurden Dörfer, aus den Dörfern Städte. Die meisten Western spielen in der für diesen Prozess entscheidenden Phase zwischen 1865 und 1890.
Besonders bei John Ford gibt es historische Bezüge, die sich in mythische Zusammenhänge einbinden, so lässt er seine Geschichten changieren in narrativen Übergangsstadien zwischen Realität und Legende. Frieda Grafe schreibt: »In Fort Apache und Liberty Valance überwuchert die erzählende Erinnerung die historische Begebenheit. Ford zeigt beides: die Realität und die Legende, die sich von ihr unabhängig macht, den Widerspruch zwischen Wunsch und Notwendigem. […] Er zeigt, wie Mythen entstehen.«8
Der Westerner ist eine in der historischen Ära des Wild West entwickelte, amerikanische Form der Männlichkeit. Als Hunter (Trapper und Jäger) oder als einsamer Waldläufer und Indianerkämpfer (Scout), als herumziehender Revolvermann (Gunfighter) oder später als Ordnungshüter (Sheriff oder Marshal) oder als Kopfgeldjäger (Bounty Hunter). Männer ziehen los, auf der Suche nach Abenteuern, nach Gelegenheiten, sich zu bewähren: Go west, young man, and grow up with your country. Sie agieren im Rahmen der mythisierten historischen Landnahme: Der Zug von Osten nach Westen; der Krieg gegen die Ureinwohner des Landes, die Indianer (ein Krieg, den der Western bis in die 50er-Jahre als den gegen das naturhaft Böse nachträglich noch ideologisch legitimierte; erst in der Zeit des Vietnamkrieges wurden im Western die Züge des Genozids an den Indianern – und dann als politische Allegorien – drastisch inszeniert, etwa in Ralph Nelsons Soldier Blue, 1969, in Arthur Penns Little Big Man, 1969, oder in Robert Aldrichs Ulzana’s Raid, 1972); die langsame Zivilisierung in den Siedlungen, die Befriedung der noch rauen und wilden Städte; der Kampf zwischen Bürgern und Gesetzlosen.
In den Filmen, spätestens nach Aufkommen des Tons, sind diese Abenteuer meistens gebrochen. In Victor Flemings The Virginian, dem ersten Tonfilm-epic, ist die Entschlossenheit, draußen zu handeln, gebunden an die Bereitschaft, drinnen sich zu befrieden. Ringo Kid führt in Stagecoach die kleine Reisegruppe sicher durchs Indianergebiet, aber er war im Gefängnis, hat Vater und Bruder verloren und lässt nicht ab von seiner Rache. Er akzeptiert kein ihm fremdes, fernes Gesetz, aber er stiftet, indem er die Gruppe durch die Wildnis bringt, eine neue Zivilisation. Wyatt Earp befriedet in My Darling Clementine die Stadt Tombstone, aber erst, nachdem sein Bruder James erschossen und ihm die gesamte Rinderherde gestohlen wurde. Er nutzt das ihm ferne Gesetz, um das ihm fremde Gemeinwesen neu zu beleben. Tom Dunson will in Red River mit 10 000 Rindern von Texas nach Missouri, eine Pioniertat, dafür aber drängt und droht er, nötigt und tyrannisiert: unterwegs gebe es keine Kündigung. Dieses Prinzip setzt er mit der Waffe durch. Selbst in The Covered Wagon von James Cruze, dem allerersten epic, ist der weite Weg nach Oregon nicht nur entdeckendes Handeln draußen, sondern immer auch bewährendes Verhalten im Inneren – gegenüber den Mitreisenden auf dem Treck, gegenüber der geliebten Frau wie gegenüber dem Rivalen um diese Frau. Auch der gewagteste Aufbruch ins Unbekannte wird begleitet von Befriedung (durch die Frau) und von bewaffneter Auseinandersetzung (mit dem Kontrahenten).
Den »letzten Gentleman« nannte Robert Warshow den Westerner. »Er kann tadellos reiten, angesichts des Todes die Fassung bewahren und seine Pistole um den Bruchteil einer Sekunde schneller ziehen und besser damit treffen als irgendwer, dem er begegnen könnte. […] Er kämpft nicht für den eigenen Vorteil und auch nicht für die Gerechtigkeit, sondern um darzutun, was er ist; und er muss in einer Welt leben, die solche Manifestationen gestattet.«9 Der Westerner ist eine »klassische Figur, fest umrissen und in sich abgeschlossen, nicht bestrebt, seine Herrschaft auszudehnen, sondern nur, seine Persönlichkeit zur Geltung zu bringen«.10
Eine typische Situation in einem kleinen Western aus den 50er-Jahren, in Jack Arnolds Red Sundown (1955). Da will ein Mann, der sich lange herumgetrieben hat, endlich sesshaft werden. Dafür muss er kämpfen – und der leichten Verführung widerstehen. Er wird Hilfssheriff, lehnt die Angebote des tyrannischen Rinderbarons ab und kämpft mit Fäusten und dem Revolver für den Frieden seiner kleinen Stadt. Am Ende erklärt er der Frau, die er liebt, warum er noch einmal weggehen müsse: Er habe noch etwas aus sich zu machen, damit er ihr auch etwas bieten könne. Der letzte Gentleman und seine Geschichten: Überbleibsel in einer Kunstform, »in welcher der Begriff der Ehre noch seine volle Kraft bewahrt hat«.11
Der klassische Westerner ist häufig einsam, ein Loner, er ist introvertiert und wortkarg, physisch höchst agil und gewandt, klug, aber kaum reflektierend. Er ist häufig ein Mann ohne Frau, was sich aber ändern kann, wenn er einer begegnet, die ihn fasziniert oder überrascht, sei es in einer Postkutsche oder in einer Schule oder auf einer Ranch. Sein Handeln folgt einem ganz eigenen Ethos – dem des American Dream, der den Neuen Adam zur Schaffung des Paradieses in der Wildnis bestimmt, in das ihm die Gemeinschaft nachfolgen wird.
Doch dieser Neue Adam ist, zumindest in den großen Western, die heute den Kanon des Genres bestimmen, selten nur ein strahlender Sieger. Selbst John Ford, angeblich »der konservative Chronist des amerikanischen Traums«, zeigt Helden, die »Angriffen und Zerstörungen ausgesetzt« sind. »Was eben noch als Idylle erschien, verliert das Fundament, Häuser, Forts, Siedlungen brennen bis auf die Grundmauern ab. Übrig bleiben: Ruinen, Gräber, Heimatlose. […] Spätestens seit den vierziger Jahren dominieren Brüchigkeit, Melancholie und Zynismus. Harmonisches Miteinander endet immer wieder in schmerzvoller Einsamkeit. Davon sind vor allem die Männer betroffen: engstirnige, brutale, wahnsinnig werdende Helden, die am Ende ihren Weg als Loner fortsetzen. Sie kommen selten in einem Zuhause an.«12
Immer gibt es eine Sehnsucht nach großen Zielen bei Ford, nach einem Stück Land oder einer neuen Familie. Aber dann steht etwas im Wege. So entsteht ein unentwegter Konflikt zwischen Eroberung und Verlust, zwischen Aufbau und Zerstörung. Bei Ford, schreibt Hartmut Bitomsky, ist die Welt »immerfort und überall gespalten, um zu leben, muss man sich dazwischen bewegen, im Gleichgewicht auf den Trennungslinien«.13
Helden im Western sind stets Suchende, Jagende oder Gejagte. Die Bewegung durch die Landschaft zu Pferd akzentuiert dabei nicht erst seit Farbfilm und CinemaScope das Elementare der Natur.
Schon in The Covered Wagon und The Iron Horse ist der Western das große amerikanische Outdoor-Adventure. Erde und Himmel, Wasser und Land bedingen das Leben, und nur der überlebt, der ihre Zeichen zu deuten vermag. James Cruze und John Ford öffneten Mitte der 20er-Jahre den Blick für die endlose Weite des Horizonts; die Landschaft offenbarte dramatische Formen.
In Howard Hawks’ Red River ist die Spannung zwischen innerer Enge und äußerer Weite, zwischen den Menschen, die die Landschaft prägen, und der Landschaft, die den Menschen ihren Stempel aufdrückt, geradezu paradigmatisch umgesetzt. Je tiefer die Männer mit ihrer riesigen Rinderherde in ihnen fremde Gegenden vordringen, desto mehr verlieren sie sich in der Weite, die kaum Spuren kennt und keine Grenzen. Die Landschaften treiben die Erzählung voran: Je zerklüfteter und bizarrer die Formen draußen, desto zerrissener und brüchiger die Verfassung drinnen.
Die Helden im Western werden in der Fremde häufig hineingezogen in für sie undurchsichtige Machenschaften, behalten aber dennoch ihre eigene Würde oder nutzen ihre ganz eigenen Fähigkeiten, sich listig gegen alle Anfeindungen zu wehren. Oder sie werden durch die Ablehnung und den Hass, auf den sie stoßen, so tief verletzt, dass ihnen nur ihr heiliger Zorn noch bleibt, der sie anspornt, dem wilden, oft auch gesetzlosen Tun die eigene Moral, eine Art zivilisatorischer Integrität entgegenzusetzen. Immer weiter und weiter: durch die Tat zur Identität – und gerade, wenn eine Niederlage droht, noch einen Tick wilder und entschlossener, um jeden Zweifel auszuschließen. André Bazin nahm dies zur Grundlage seiner Reflexion über das Verhältnis von Recht und Moral, das im Western durchgespielt werde im Verhalten Einzelner. In keinem anderen Genre, so André Bazin, sei »die Notwendigkeit des Gesetzes […] so eng mit der Notwendigkeit einer Moral verbunden«, und in keinem anderen Genre sei »auch deren Antagonismus konkreter und offensichtlicher«.14
In Fords The Searchers bricht der geschlagene Bürgerkriegsveteran Ethan Edwards auf, um die von Indianern ermordete Familie seines Bruders zu rächen und seine entführte Nichte heimzuholen. Aus dem Suchenden wird auf der jahrelangen Odyssee ein immer erbarmungsloserer Killer, der seinen Krieg sogar gegen die Natur führt. Kampferprobt und fintenreich ist er, so rüde und wild wie die Indianer, die er verabscheut.
Dieser Ethan lebt von Anfang an nur nach seinen eigenen Regeln: am liebsten auf »eigene Faust« gehen; nichts halten »von Waffen strecken«; so viele Büffel töten wie nur möglich, um den Indianern ihre Lebensmittel zu nehmen, und toten Komantschen die Augen herausschießen, damit sie nicht »in die ewigen Jagdgründe« kommen, sondern »ewig zwischen den Winden wandern«. Ein fanatischer, hasserfüllter Jäger, der entschieden hat, immer noch bösartiger zu sein als seine Gegner.
Wie ein Berserker wirkt er dann, als es ihm endlich gelungen ist, den Indianerhäuptling zu skalpieren, den er seit Jahren verfolgte. A guy you hate to love. Er hält noch den Skalp in der Hand, als er in der Ferne seine Nichte entdeckt, die voller Angst vor ihm flieht. Hinter einer leichten Anhöhe holt er schließlich das Mädchen ein, das stolpert, vor ihm erschrickt, vor Abscheu schreit. Ethan packt sie hart, zögert ein wenig, hebt sie hoch und nimmt sie dann auf seinen Arm, dabei zärtlich murmelnd: »Let’s go home, Debbie!« Ein Triumph der reinen Emotion. Ein Übergang »von der stilisierten Geste zum Gefühl«, so Jean-Luc Godard, »von John Wayne, der plötzlich wie zu Stein erstarrt, zu Odysseus, der Telemach wieder gefunden hat«.15
Beim Ritt nach Hause bleibt das Mädchen ganz eng an ihren Onkel gelehnt, so, als wolle sie ihn nie wieder loslassen. Doch das Zuhause ist für ihn kein Ort. Er erträgt keine Mauern, die ihn einengen, er zieht offene Türen vor, die ins Freie führen. Er kann das Haus der Gemeinschaft nicht mehr betreten. Ford schließt ihn mit einer Blende für immer aus. Edwards ist nur einer der Charaktere im Western der 50er-Jahre, an deren Körper und in deren Psyche die Wunden sichtbar werden, die die Geschichte des Wild West schlug.
Rückzug und Flucht des Westerner vor der mit Macht voranschreitenden Zivilisation und das Motiv der sich auf der Basis des Gesetzes gründenden Gemeinschaft schaffen neben dem Hunter, dem Scout und dem Cowboy zwei weitere archetypische Formen männlicher Existenz im Western: die des Outlaw, des Gesetzlosen, und die des Man of the Law, des Sheriffs oder Marshals, der dem Gesetz selbstlos zur Durchsetzung zu verhelfen hat, auch wenn er, wie in Fred Zinnemanns High Noon, die Gemeinschaft, der er dient, verachtet.
Die neun zentralen Erzählungen des Genres16
1. Entdeckung neuer Grenzen
Menschen brechen auf, um unbekanntes Land zu entdecken und eine neue Heimat zu finden (von James Cruzes The Covered Wagon über Henry Hathaways Brigham Young, Frontiersman, 1940, bis zu Fords Wagonmaster, 1950, und Andrew McLaglens The Way West, 1966). Oder sie sorgen mit Eisenbahnschienen, Postkutschenlinien oder Telegraphenmasten für Kommunikation oder zivilisatorische Verbindung (von Fords The Iron Horse und James Cruzes Pony Express, 1925, bis zu Frank Lloyds Wells Fargo, 1937, Cecil B. DeMilles Union Pacific, 1939, und Fritz Langs Western Union, 1941). Oder sie finden mit ihren Rinderherden neue Wege, um für die Lebensmittel in den großen Städten des Ostens zu sorgen (von Raoul Walshs The Big Trail, 1930, bis zu Howard Hawks’ Red River). Oder sie suchen im fernen Kalifornien nach Gold (von Clarence Browns Trail of ’98, 1928, über James Cruzes Sutter’s Gold, 1936, bis zu William A. Wellmans Robin Hood of El Dorado, 1936).
2. Krieg gegen die Indianer
Farmer oder Rancher am Rande der Wildnis, die zum Teil noch den Indianern gehört, legen ihren Garten an, setzen ihre eigene Zivilisation durch: mit modernen Waffen, gegen die Pfeil und Bogen chancenlos bleiben (von Fords Stagecoach über Cecil B. DeMilles The Plainsman, 1937, und Otto Premingers River of No Return, 1954, bis zu Sydney Pollacks Jeremiah Johnson, 1972). Oder die Kavallerie sichert am Rande der Wildnis für Farmen und Siedlungen die Ordnung (von Raoul Walshs They Died With Their Boots On, 1941, und Fords Kavallerie-Western: Fort Apache, 1948, She Wore a Yellow Ribbon, 1949, Rio Grande, 1950, bis zu Robert Aldrichs Ulzana’s Raid, 1972, in dem wie in keinem anderen Hollywoodfilm das Verhältnis zwischen »eingeborener« und »weißer« Gewalt reflektiert wurde).
3. Prozess der Zivilisierung
Die alten, wilden Zeiten sind noch nicht ganz vorbei. Es gilt zwar, die Konflikte friedlicher zu lösen, aber noch sind die Häuser aus Holz (nicht aus Stein), und die Siedlungen haben noch keine Gerichte, also müssen tatkräftige Kerle her, die mit ihrer Gesinnung und ihrem Tun eintreten für Moral und Recht: von Victor Flemings The Virginian, in dem die Viehdiebe noch gehängt werden von einer Bürgerwehr (Lynchjustiz oder schnelle Sühne), weil für Recht gesorgt werden muss, wo es noch keine rechtliche Ordnung gibt, über William A. Wellmans Ox-Bow Incident (1943), wo die Falschen gelyncht werden, Walshs Along the Great Divide (1951), wo ein Marshal einen Lynchmord verhindert, den Angeschuldigten in die nächste Stadt bringt, um ihn vor Gericht zu stellen, wo sich schließlich seine Unschuld herausstellt, bis zu Samuel Fullers Forty Guns (1958), wo drei fremde Marshals die gewalttätige Herrschaft einer Großrancherin brechen. (An diesem Punkt der Zivilisierung vor der Zivilisation wird häufig die Frage nach der Glorifizierung von Selbstjustiz gestellt. Ohne dies hier abschließend zu diskutieren, sei auf den Gedanken von André Bazin verwiesen, der auf die Notwendigkeit von Stärke und Kühnheit verwiesen hat, die der Gewissen- und Bedenkenlosigkeit der »Gesetzlosen« gleich sein müsse. Deshalb habe auch die »Rechtsprechung […], wenn sie wirksam sein will, schnell und drastisch [zu] sein […] – ohne dabei zur Lynchjustiz zu werden.«)17
4. Strafverfolgung und Rache
Nach der Konsolidierung der Städte beginnt der Krieg zwischen Gesetzestreuen und Gesetzlosen. Eine Ansiedlung wird überfallen, eine Bank, ein Zug, eine Ranch, eine Geschäftsstelle, die Räuber fliehen und eine Posse / eine Bürgerwehr verfolgt und stellt sie (von Edwin S. Porters The Great Train Robbery, 1903, bis zu Walter Hills Long Riders, 1979). Oder ein Privathaus wird von einer Bande überfallen, die Familie getötet oder misshandelt, doch es gibt einen Überlebenden, der gerade mal außer Haus war und dann loszieht, um sich zu rächen (von John Sturges’ Last Train from Gun Hill, 1958, Budd Boettichers Ride Lonesome und Henry Hathaways Nevada Smith, 1965, bis zu Clint Eastwoods Outlaw Josey Wales, 1976). Oder Indianer überfallen eine Stadt, einen Treck, eine Farm, ein Fort, morden und brandschatzen und eine Posse verfolgt sie und übt Rache (von Fords Rio Grande und The Searchers bis zu Sydney Pollacks Jeremiah Johnson). Oder ein Kopfgeld ist ausgesetzt auf einen Banditen, und ein Kopfgeldjäger verfolgt statt dem Betroffenen oder dem zuständigen Sheriff die Flüchtenden (von Antony Manns Naked Spur, 1957, bis zu Richard Brooks’ The Professionals, 1966).
5. Zweite Beruhigung der Städte (town tamer stories)
Fremde kommen in eine Stadt, die beherrscht oder bedroht wird von einem mächtigen Viehbaron oder einem geldgierigen Banker oder einem verrückten Richter oder einem gewalttätigen Gangster, und entschließen sich, die Stadt zu befrieden (von Michael Curtiz’ Dodge City, George Marshalls Destry Rides Again, William Wylers The Westerner und Fords My Darling Clementine bis zu Fred Zinnemanns High Noon, George Stevens’ Shane, Fords The Man Who Shot Liberty Valance und Howard Hawks’ Rio Bravo).
6. Aufbruch in die Wildnis
Die Städte sind gebaut und beruhigt, die Zivilisation ist gebildet. Aber Ruhe und Ordnung sind nicht jedermanns Sache. Je weiter die Ordnung einer zivilisierten Gesellschaft sich durchsetzt, desto begrenzter wird für den Westerner die Freiheit in Bewegung und Handeln. Die Tugenden der Männer, die das Land eroberten, taugen nicht immer dazu, dieses Land auch zu kultivieren. Es ist der tragische Konflikt dieser Westerner: Je mehr Reiter und Planwagen-Karawanen ihnen in die Freiheit folgen, je mehr Viehherden sie in die Städte treiben, je mehr sie den Eisenbahnen den Weg ebnen, je mehr Siedlungen und Städte sie ermöglichen, desto enger wird auch ihr Lebensraum, desto problematischer ihre Lebensweise. Damit aber haben sie fertig zu werden, wenn sie auch geplagt sind von Zweifeln gegenüber der Gegenwart, die sie kaum noch begreifen, und von dem Hass darauf, was aus ihrem weiten Land geworden ist (von King Vidors Man Without a Star, 1955, über Delmer Daves’ Cowboys, 1957, und John Sturges The Last Train from Gun Hill bis zu Sam Peckinpahs The Ballad of Cable Hogue, 1969).
So verlassen viele ihre Zivilisation und entdecken das eher natürliche, wilde Leben der Indianer (von Delmer Daves’ Broken Arrow, 1950, und Howard Hawks’ The Big Sky, 1952, über William A. Wellmans Across the Wide Missouri und Sam Fullers Run of the Arrow, 1956, bis zu Kevin Costners Dances With Wolves).
7. Indianerabenteuer
Filme über das Leben und Überleben der Indianer, über ihre Kultur wie über ihre Kämpfe gegen die Weißen, aus der Perspektive der Indianer selbst gesehen: von Delmer Daves’ Broken Arrow, Anthony Manns Devil’s Doorway (1950) und Robert Aldrichs Apache (1954), Douglas Sirks Taza, Son of Cochise (1954), Robert Webbs White Feather (1954) und George Shermans Chief Crazy Horse (1955) über Carol Reeds The Last Warrior (1969) und Michael Winners Chato’s Land (1971) bis zu Keith Merrills Three Warriors (1977) und Windwalker (1980), Bruce Beresfords Black Robe (1991), Richard Bugajskis Clearcut (1991) und Michael Apteds Thunderheart (1992).
8. Verfall einer Gründerdynastie
Nach dem Aufbau: der Niedergang. Den Pionieren, die das Land nahmen und für sich nutzten, folgen oft nichtsnutzige Kinder, junge Herumtreiber ohne Verstand und Moral, die ihr Erbe nicht halten können, es verspielen oder verschleudern (von King Vidors Duel in the Sun, 1946, und Edward Dmytryks Broken Lance, 1954, bis zu Anthony Manns The Man from Laramie, 1955 und William Wylers The Big Country, 1958). Georg Seeßlen: »Die Auseinandersetzung zwischen den Grundbesitzern und ihren Söhnen ist wie ein Argument gegen das dynastische Prinzip, dem der Western nie das Wort gesprochen hat: Wer sich ein Reich aufgebaut hat, der muss es auch wieder verlieren, damit die anderen nicht aufhören müssen, von ihren Möglichkeiten zu träumen.«18
9. Legendenbildung
Schließlich sind zu nennen all die Filme über legendäre Westerngestalten, über James Butler (»Wild Bill«) Hickok, Buffalo Bill und Wyatt Earp, über Jesse James und Billy the Kid, über General Custer und Doc Holliday, über Anne Oakley und Calamity Jane, über Sitting Bull und Geronimo (u. a. von Robert Altman, Michael Curtiz, Cecil B. DeMille, John Ford, Walter Hill, Lawrence Kasdan, Henry King, Fritz Lang, George Sherman, George Sidney, Robert Siodmak, J. Lee Thompson).
Gesetze, Werte, Action
Unabhängig von diesen zentralen Erzählungen gibt es feste Motive und Standards, die wieder und wieder vorkommen, oft nur leicht variiert, und so das Fundament des Genres bilden: der Alltag an der Grenze zur Wildnis (Natur als Herausforderung für den rauen Mann); die Verfolgungsjagd zu Pferde, deshalb die Nähe zum und die Sorge um das Pferd; das große Versprechen von Freiheit und Unabhängigkeit, das sich am Ende häufig (und seit Mitte der 50er-Jahre immer häufiger) als Alptraum entpuppt; die Frau als Objekt des Begehrens (mal als Hure, mal als Kumpel, mal als Ganz-Andere aus dem Osten mit anderem kulturellen Hintergrund); die Freundschaft zwischen Männern; das shoot out im Showdown.
Ein zentraler Standard ist, wie erwähnt, der selbstverständliche Umgang mit der Waffe, die meistens offen am Gurt hängt.19 Action ist im Western stets Gewalt, und die Geschichte des Genres ist (vom Banditen in The Great Train Robbery, der auf den Zuschauer schießt, bis zu Sam Peckinpahs Dehnung des gewaltsamen Todes in slow motion) immer auch die Geschichte einer spezifisch amerikanischen Ästhetik und Mythologie der Gewalt.
Henry Hathaways Western z. B. münden immer wieder »in Ausbrüche von Grausamkeit, die oft durch selbstzerstörerische Neigungen herbeigeführt werden«.20 In Garden of Evil (1954) wird einer der gunfighter von einem Indianer-Pfeil durchbohrt, fällt durch das Laub der Bäume auf die Frau zu, bleibt aber mit dem Fuß an einem Ast hängen und baumelt schließlich vor ihren Augen hin und her. In Richard Brooks The Last Hunt (1955) erklärt einer der Helden einmal: Wenn man töte, beweise man zugleich, dass man lebe und dass man stark sei. In Delmer Daves’ The Hanging Tree (1959) verbirgt der Held seine Gefühle vor der Frau, die er liebt, weil er zuvor schlechte Erfahrungen gemacht hat, und schickt sie weg. Um sie später zurückzugewinnen, muss er der Gewalt mit Gewalt trotzen. Der Augenblick der Liebe ist zugleich ein Augenblick des Tötens. Er rettet sie vor einer Vergewaltigung, indem er einen befreundeten Mann tötet, dessen Angriff auf die Frau auch nur der Ausdruck seiner Gefühle ist, die sich nicht anders zeigen können. In Fords The Man Who Shot Liberty Valance (1962) wird der des Schießens unkundige Rechtsanwalt zum legendären Helden (und zum auserwählten Politiker), nachdem er mit der Waffe in der Hand dem äußeren Anschein nach den das ganze Kaff terrorisierenden Schurken beseitigt hat.
Schließlich der Kodex des Westerner, wozu zählen: die ungeschriebenen Gesetze und Werte von Freundschaft und Ehre. In Victor Flemings The Virginian gesteht Gary Cooper seinem alten Freund aus wilden Tagen einmal noch den Viehdiebstahl zu, aus Freundschaft (»Wir haben früher eine Menge Blödsinn angestellt. Doch es gibt Dinge, die sind nicht nur blödsinnig, sondern falsch!«). Zugleich stellt er aber klar, dass das so nicht weitergehen kann. Die Zeit für Viehdiebstähle sei vorbei, die Rancher in Wyoming ließen sich das nicht länger gefallen. Als er ihn dann das nächste Mal erwischt, hat er einen Suchtrupp dabei. Da verhindert er nicht – auch das ein Gefühl der Ehre –, dass sein alter Freund von seinen Kumpanen aufgehängt wird.
Zum Ehrenkodex des Westerner gehört auch, vor allem in den 50er- und 60er-Jahren, dass der Held gegen die eigene Überzeugung ankämpfen muss, da ihm klar ist, dass er nur so sich selbst treu bleiben kann. Sehr ausgeprägt in King Vidors Man Without a Star, wo Kirk Douglas trotz seiner Abscheu vor Stacheldrähten am Ende dem kleinen Rancher gegen den tyrannischen Großrancher hilft, einen Zaun zu bauen, damit der in Frieden leben kann.
Wichtig ist auch die Autonomie des Helden. Einer muss es schaffen, für die Gemeinschaft; und indem er es schafft, für Recht und Ordnung zu sorgen, sorgt er für erste Momente der Zivilisation. In Victor Flemings The Virginian zieht der Held am Ende los, um sich seinem Gegner zu stellen; seine Freundin, die Lehrerin aus dem Osten, die dabei ist, ihn zu einem zivilisierten Menschen zu machen, droht ihm deshalb: »Wenn du das tust, gibt es kein Morgen mehr für dich und mich!« Seine Antwort: Wenn die anderen ihn für einen Feigling hielten, könne er niemandem mehr in die Augen sehen, auch ihr nicht, auch sich selber nicht. Tief im Inneren gebe es ein Gefühl, das einem Mann sage, was er tun müsse.
In Raoul Walshs The Big Trail (1930) muss der Held am Ende aufbrechen, um die Mörder seines Freundes zu richten. Auch da bittet seine Frau ihn darum, es zu lassen. Er sei doch ihr Ein und Alles, deshalb dürfe er nicht gehen. Seine Antwort »Gesetz der Grenze, ich muss die Sache zu Ende bringen – ich muss tun, was ich zu tun habe!«
Zur Geschichte des Western
Fünf Phasen sind in der Geschichte des Western-Genre zu unterscheiden, die historisch nach und nach sich entwickelten, deren spezifische Eigenheiten aber in jeder folgenden Periode auch parallel existierten. So kann man etwa in den 50er-Jahren, die ohne jeden Zweifel den Höhepunkt des Genres bildeten, sowohl naive als auch epische, sowohl dramatische und psychologische als auch kritische und skeptische Western finden.
1. Die naiven Western
In diesen frühen Western ging es im Grunde bloß um »gunplays and horses« (H. Hawks): ein Held und ein Bösewicht and dazwischen eine Frau. Der Konflikt der Wildnis wird draußen gelöst, der Konflikt der Familie drinnen, nachdem der draußen erledigt ist. Western in der einfachen, reinen Form. Der Konflikt ist bloß Anlass für Spannung und Spiel. Und die Ideologie bloß Ursache für Bewegung, äußerlich wie innerlich. Nichts Metaphorisches, keine Lebensanschauungen, keine Psychologie, nur alltägliche Charaktere in einem historischen Ambiente. Der Regisseur Joseph Kane meinte, für Western brauche man nur wenig, »zwei Männer und dazwischen eine Frau; Pferde, um sich fortzubewegen, und Waffen, um die Konflikte auszufechten, ohne viel Worte machen zu müssen«.
Prototyp dieses naiven Western ist der erste Broncho Billy-Film: Broncho Billy and the Baby (1908 / R: Gilbert M. Andersen), dem angeblich mehr als 370 weitere folgten. Die Broncho Billy-Filme waren noch ohne Kontinuität in der Zeichnung der Figuren und der Geschichte. In der Regel kam ein Film pro Woche in die Nickelodeons.
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts folgten dann die Filme um William S. Hart (bis in die 20er-Jahre), die schon ein authentischeres Umfeld hatten, auch gradlinigere Geschichten und klarere Konturen des Helden. Kurze Zeit später dann die Filme um Tom Mix (ebenfalls bis in die 20er-Jahre), den »tricky Westerner«, der allen Situationen trotzt, oft mit akrobatischen Einlagen, dabei gerne Fantasie-Kostüme tragend, die ihn schon äußerlich als »Guten« kennzeichneten und von den »Bösen« trennten. »War Hart das große, tragische, sentimentale Überbleibsel einer gewaltigen Zeit, die so überwältigend gewesen sein musste, dass vieles von ihr im Dunkeln, im Schweigen zu bleiben hatte, so zeigte Tom Mix, wie man auf eine einfache, trickreiche, amerikanische Art die Ideale und das Lebensgefühl des Westens in die Gegenwart fortsetzen konnte, indem man sie einer radikalen Veräußerlichung unterzog.«21
Noch in den 20er-Jahren sind die Western weitgehend standardisiert, in Handlung und Attraktion. Es gibt inzwischen schon dramatische und romantische und auch komische Momente, aber Reit- und Kampfkunststücke, Verfolgungen im Galopp und Prügeleien bleiben an der Tagesordnung. Die Konflikte werden stets scharf konturiert, auf der einen Seite die Gauner, die auf unlautere Weise ans fremde Gut und Geld wollen, auf der anderen Seite die tapferen Helden, die für Recht und Ordnung eintreten. Gut und Böse sind klar getrennt, wie schon bei Tom Mix oft durch Kleidung überdeutlich ausgestellt. »Die billigen Western waren Serien-Produkte, die ihre geringen Kosten in kleinen Kinos einspielten. […] Die Elemente der Story waren austauschbar, ein paar minimale Schauwerte mussten platziert werden, um den Ansprüchen der Produzenten zu genügen. Hauptsache, ausreichend action war darin und nichts, was sie unnötig verlangsamte.«22
In William Wylers The Two Fister (1927) steht ein betrügerischer Grundbesitzer im Zentrum, der Überfälle fingiert, um ans Eigentum seiner Nachbarn zu kommen. Nach außen hin scheint er ein Saubermann, der sogar der schönen Tochter des reichen Händlers nachstellt. In Wahrheit aber ist er ein Halunke, der vor nichts zurückschreckt. Dieser Kontrast gibt viel Raum für Handeln im Zickzack, hin und her, kreuz und quer. Der Held des Films, ein Ranger, kämpft gegen die Ganoven, ohne zu ahnen, dass er ihren Anführer oft direkt an seiner Seite hat. So muss er am Ende alles zeigen, was er kann, um den Wirrwarr zu ordnen: reiten, denken, prügeln.
In den frühen Filmen habe es, so Jean Mitry, viel Heroisches gegeben. Aber es sei noch »sehr schematisch« gewesen, und »die Personen vorgeformt«. Allein »der Dynamismus der Handlung, die action, machte alles aus. Eine Postkutsche wird angegriffen, der Held kommt zu Hilfe, er verfolgt die Banditen, greift sie an und peng, peng, peng. Er findet seine Braut wieder, er hat den anderen besiegt – das ist alles. […] Keine Psychologie.«23
The Great Train Robbery von Edwin S. Porter (aus dem Jahr 1903) hatte selbstverständlich auch sehr naive Züge, wies aber gleichzeitig wegen seiner klassischen Dramaturgie bereits auf die epics der 20er-Jahre.
2. Die Epics
Episch meint zunächst einmal das »Heldengedicht« auf die Entwicklung zur amerikanischen Zivilisation. (Jean Mitry: »Das Epos ist die Dichtung dieser Entwicklung, wie die ›Ilias‹ für die Griechen, das ›Chanson de geste‹ für die Franzosen, das ›Nibelungenlied‹ für die Deutschen [ist] das Heldengedicht der Amerikaner […] der Western.«24) Episch meint auch die Durchhalte-Struktur der Filme, die Freude am »Verweilen […] bei jedem Schritte« des Erzählens.25 Es meint zudem den Aufwand an Menschen, Geld und Zeit, der nötig ist für die Realisierung, meint die Verbindung einer historischen Situation, in der Menschen neues Land erobern und durch ihr Handeln zivilisieren, mit der Geschichte Einzelner, das Allgemeine im Konkreten hervorhebend, das große Ganze im Kleinen exemplifizierend.
In Graham Greenes Anmerkungen zu Cecil B. DeMilles The Plainsman sind, ohne es direkt zu thematisieren, einige der zentralen Charakteristika der epics formuliert: »die fabelhafte Massenregie in den gewaltigen Dekorationen, die brillante Detailarbeit, Tiefe und Solidität der Szenen im Hafen von St. Louis, die Attacke der Indianerkavallerie. Einige der großen spektakulären Momente in der Geschichte des Films sind eine permanente Bestätigung für alle die, die glauben, dass aus einer populären Unterhaltungsindustrie Kunst werden kann.«26
Andererseits, so André Bazin, sei der Western auch episch »wegen der übermenschlichen Fähigkeiten seiner Helden und der legendären Größe ihrer Taten. Billy the Kid ist unverwundbar wie Achilles, und sein Revolver unfehlbar. Der Cowboy ist ein Ritter. Dem Charakter des Helden entspricht der Inszenierungsstil, bei dem die epische Umsetzung schön in der Bildkomposition sichtbar wird; die Vorliebe für weite Horizonte, die großen Totalen erinnern immer an die Konfrontation des Menschen mit der Natur.«27
Frühe Prototypen des epischen Western sind The Covered Wagon (R: James Cruze) und The Iron Horse (R: John Ford), aber auch The Winning of Barbara Worth (1925 / R: Henry King), der erste große romantische Western, der einen Konflikt einer Frau zwischen zwei Männern thematisiert. Weitere Paradigmen dieser Western: The Virginian (R: Victor Fleming), The Big Trail (R: Raoul Walsh), Billy the Kid (1930 / R: King Vidor), The Texas Rangers (1936 / R: King Vidor) und The Plainsman (R: Cecil B. DeMille).
3. Dramatische und psychologische Western
Ende der 30er-, Mitte der 40er-Jahre wurden die Western immer sublimer, es gab plötzlich Filme, die weder naiv noch episch wirkten, sondern – jenseits jeder Thesenhaftigkeit – sich auf einen überschaubaren Konflikt konzentrierten und ihn aufrichtig und spannungsreich durchspielten.
Die Figuren interessieren dabei in erster Linie wegen der Ereignisse, in die sie verwickelt sind, wobei ihnen nichts geschieht, was nicht zu Thema und Ästhetik des Western gehört. Spezifisch dafür: der offene, entspannte Umgang mit dem Genre, Bilder, die Menschen und Natur miteinander verklammern, die ein Gefühl von Weite und Freiheit vermitteln, auch eine unangestrengte Aufrichtigkeit in dem Bestreben, die Figuren interessant und lebendig zu zeigen und spannende Situationen zu gestalten.
Die wichtigsten Prototypen dieser Phase waren: Stagecoach (R: John Ford), Union Pacific (R: Cecil B. DeMille), Jesse James (R: Henry King), Dodge City (R: Michael Curtiz), alle 1939 entstanden. Arizona (R: Wesley Ruggles) und The Westerner (R: William Wyler) von 1940, My Darling Clementine (1946 / R: John Ford) und Red River (1948 / R: Howard Hawks).
Für viele Filmhistoriker erlebte dieser Western-Typus eine Renaissance in den 50er-Jahren: in den großen Filmen von Anthony Mann – Winchester ’73 (1950), Bend of the River (1951), The Naked Spur (1952), The Far Country (1954), The Man from Laramie (1955).
4. Kritische und skeptische Western
Als Adult-Western wurden Filme bezeichnet, die das Genre und seine naiven Regeln nutzten, um wichtige Themen der Moral, Philosophie und Politik zu diskutieren – Filme mit eigener Sprache, Logik und Mythologie, durch die soziale und kulturelle, ethische und andere ›essentielle‹ Probleme darstellbar wurden. Der Western als Spielwiese für Fragen der Macht, Moral und Politik.
»Offensichtlich rührt der tiefere Ernst« dieser Western, so Robert Warshow, »aus einem Realismus sowohl im Landschaftlichen als auch im Seelischen her«. Seine »Konturen« sind »weniger glatt, sein Hintergrund düsterer. […] Immer noch brütet die Sonne über der Stadt, aber die Kamera wird sich nun dieses Lichtes bedienen, um die Schäbigkeit der Häuser und der Möbel, die nachlässige und vertragene Kleidung, Falten und Schmutzspuren der Gesichter schärfer hervorzuheben. […] Wir sehen den Westerner jetzt gegen die Hindernisse seiner Umwelt ankämpfen (wie in den schönen Wüsten- und Gebirgsszenen von The Last Posse), statt sie sorglos zu überwinden. Sogar die Pferde, die nicht mehr Freunde des Menschen, nicht mehr die feurigen Streitrosse des fahrenden Ritters sind, haben viel von der moralischen Bedeutung verloren, die einst zu ihnen zu gehören schien, als sie über die Leinwand jagten. Mir scheint, auch die Pferde sind müde geworden, sie stolpern leichter einmal als früher, und wir sehen sie seltener galoppieren.«28
André Bazin führte deshalb den Begriff des Super-Western ein, der »ein Western« sei, dem es nicht genüge, »nur er selbst zu sein«, sondern der versuche, »seine Existenz durch ein zusätzliches Interesse zu rechtfertigen: ein ästhetisches, soziologisches, moralisches, psychologisches, politisches, erotisches Interesse – kurz gesagt, durch irgendeine äußere Qualität, die eine Bereicherung des Genres bedeuten« soll.29
Wichtigste Filme dieser Phase: Broken Arrow (R: Delmer Daves) und The Gunfighter (R: Henry King) von 1950, Shane (R: George Stevens) und High Noon (R: Fred Zinnemann) aus dem Jahr 1952, Johnny Guitar (1953 / R: Nicholas Ray), Man Without a Star (R: King Vidor) und The Last Hunt (R: Richard Brooks) von 1955.
5. Spätwestern
Ausgehend von der Frage nach dem Schicksal des Westerner, wenn sich die Zeiten ändern, lässt sich die Geschichte des Western als die eines doppelten Alterungsprozesses beschreiben. Seit den 60er-Jahren altert der Western – als Spätwestern – mit dem zunehmenden Verfall des American Dream vom Land der Tapferen und Freien, und paradigmatisch dafür altern seine Helden. Schon in Anthony Manns Man of the West (1958) wird der Blick immer pessimistischer, es deutet sich an, dass die Auseinandersetzung des Westerner mit seiner Vergangenheit, mit seinen nicht bewältigten Missetaten, mit alter Schuld und neuen ›Dämonen‹ ein ewiger, unüberwundener Alptraum ist. Mit Fords The Man Who Shot Liberty Valance (1962) und Sam Peckinpahs Ride the High Country (1962) und The Wild Bunch (1969) wird Amerika in seinen letzten Helden und mit ihnen alt. Der Wild West ist längst Legende. Nostalgisch wie bei Ford, trotzig gegen die Zeit wie bei Howard Hawks oder wild in den Tod rennend wie bei Sam Peckinpah treten die Westerner ab.
In den 90er-Jahren werden auch die letzten Indianerkriege melancholisch und pessimistisch gesehen, wie z. B. in Walter Hills Geronimo