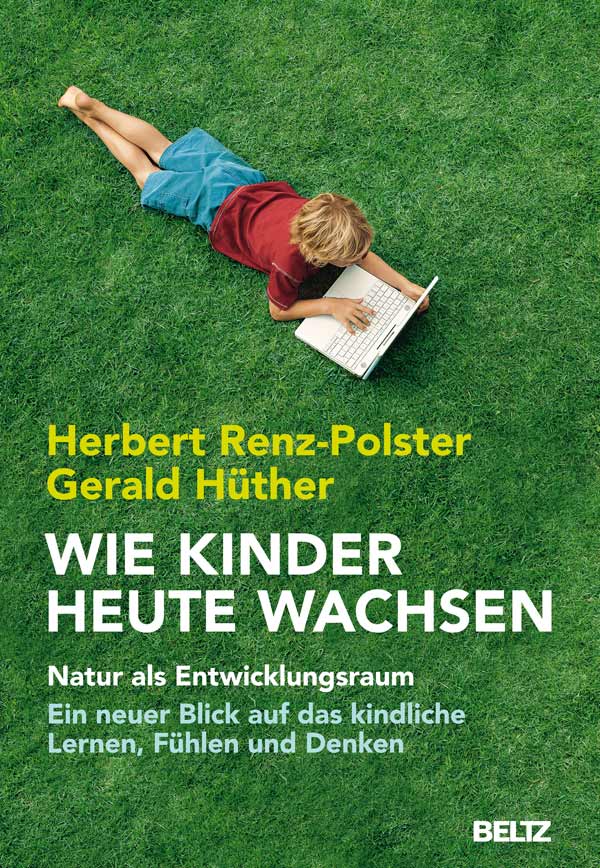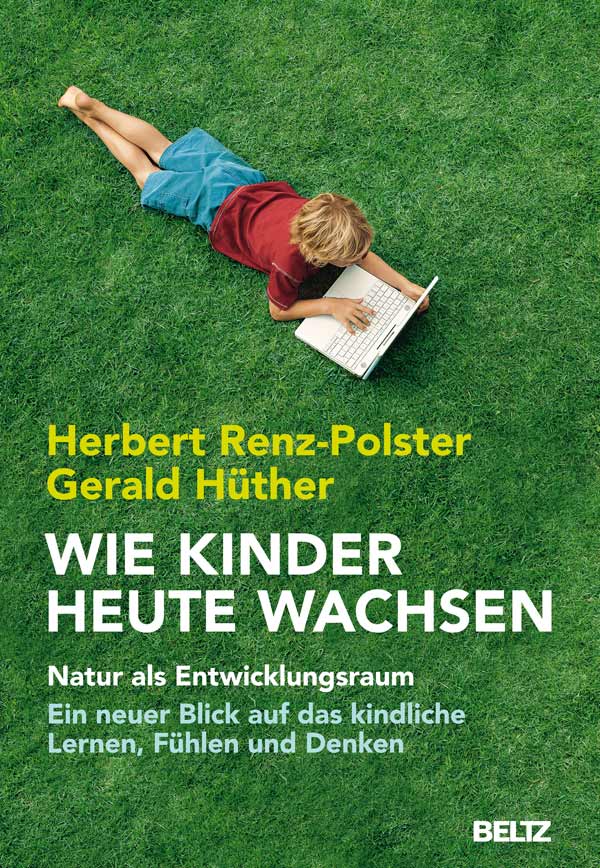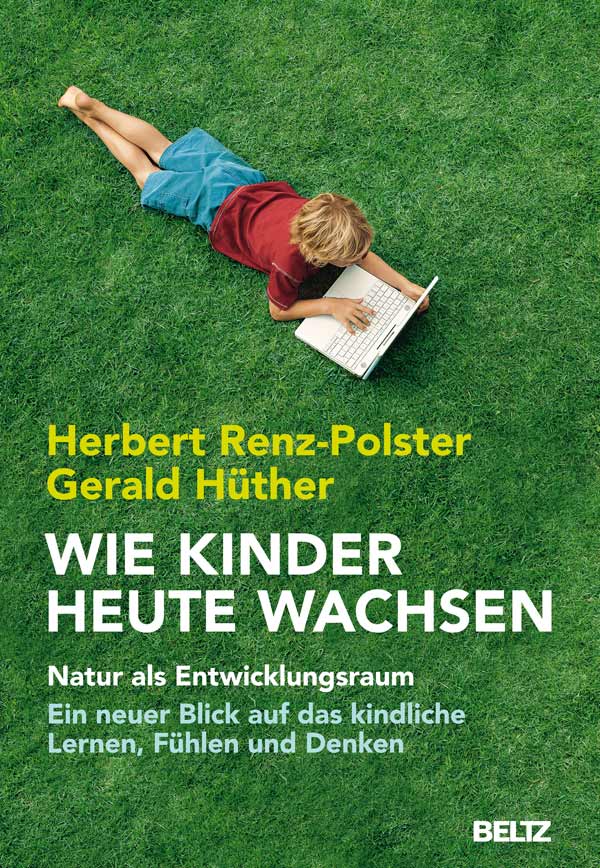
Über die Autoren
Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt und Wissenschaftler am Mannheimer Institut für Public Health der Universität Heidelberg. Seit Jahren forscht er über die Entwicklung von Kindern.
Gerald Hüther ist Professor für Neurobiologie in Göttingen und hat sich als Hirnforscher in zahlreichen Büchern mit der gesunden Entwicklung unserer Kinder beschäftigt.
Impressum
Dieses E-Book ist auch als Printausgabe erhältlich
(ISBN 978-3-407-85953-2)
Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen von den Autoren erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann jedoch weder vom Verlag noch von den Verfassern übernommen werden. Die Haftung der Autoren bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
www.beltz.de
© 2013 Beltz Verlag, Weinheim und Basel
Umschlaggestaltung: www.anjagrimmgestaltung.de (Gestaltung),
www.stephanengelke.de (Beratung)
Umschlagabbildung: ©Allstair Berg/Getty Images
Lektorat: Claus Koch
E-Book: Beltz GmbH Bad Langensalza, Bad Langensalza
ISBN 978-3-407-22353-1
»Indem ihm die Welt geheimnisvoll wurde,
öffnete sie sich und konnte zurückerobert
werden.« PETER HANDKE
S006
INHALT
NATUR – UND DANN?
EINSENTWICKLUNG, VON OBEN BETRACHTET
Verbundenheit
ZWEIDER SCHATZ DORT DRAUSSEN
Hingabe
DREINATUR UND GESUNDHEIT
Langsamkeit
VIERWARUM SCHLAGEN WIR DAS ANGEBOT AUS?
Mitgefühl
FÜNFDAS GROSSE DRINNEN. VON COMPUTERN UND KINDERSPIELEN
Geduld
SECHSIST DIE NATUR DENN GEFÄHRLICH?
Vertrauen
SIEBENWEGE IN DIE NATUR
Achtsamkeit
ACHTNATURERFAHRUNGEN IN EINER BEDROHTEN WELT
Beharrlichkeit
Danksagung
Literaturnach- und -hinweise
Anmerkungen
Bild- und Quellennachweis
Die Autoren
S008
NATUR – UND DANN?
Da setzen sich also zwei Männer hin und schreiben ein Buch über die Natur*. Und wie toll sie für die Kinder ist.
* … und die haben das so gemacht: Der eine (HRP) hat sozusagen den roten Faden ausgelegt, also den Haupttext geschrieben. Der andere (GH) hat dann jeweils an den Kapitelenden ein Fenster geöffnet, durch das der Leser weiter in die Tiefe – auch unseres Gehirns – blicken kann.
Aber dass Natur wunderbar ist, wem muss man das sagen? Wir alle wissen das. Kaum einer, der es nicht genießen würde, an einem Bach entlangzuwandern. Kaum einer, der es darauf anlegt, seinen Urlaub drinnen zu verbringen. Nein, da zieht es uns ans Meer, ins Grüne, auf die Berge. Natur bringt Erholung und sie macht Spaß!
Und so hätte dieses Buch dann auch aussehen können: schöne Bilder, nette und inspirierende Geschichten. Was Kinder dort draußen alles erleben. Wie sie aufblühen dabei.
Wir haben ein anderes Buch geschrieben. Es geht los mit einem Kapitel »Entwicklung, von oben betrachtet«. Die kindliche Entwicklung – was Kinder dabei antreibt, was sie dabei leitet – bleibt dann auch in den weiteren Kapiteln der rote Faden. Eindeutig, in diesem Buch denken wir Natur und Entwicklung zusammen.
Weil Natur für Kinder eben nicht einfach eine nette Ergänzung zum Alltag ist. Weil sie mehr ist als ein Erholungsraum, mehr als ein Ort, um seine Batterien aufzuladen oder sich auszutoben.
Natur ist für Kinder so essenziell wie gute Ernährung. Sie ist ihr angestammter Entwicklungsraum. Hier stoßen die Kinder auf vier für ihre Entwicklung unverhandelbare Quellen: Freiheit, Unmittelbarkeit, Widerständigkeit, Bezogenheit. Aus diesen Erfahrungen bauen sie das Fundament, das ihr Leben trägt.
In diesem Buch beschreiben wir Wege zu diesen Quellen – für hier und heute, für die modernste aller Welten.
S010
EINSENTWICKLUNG, VON OBEN BETRACHTET
Von den Engeln aus gesehen, sind die Wipfel
der Bäume Wurzeln vielleicht, die den Himmel
trinken. RAINER MARIA RILKE
Was wäre passender, als unsere Kinder einmal aus der rilkeschen Perspektive zu betrachten. Aus einer Art Vogelperspektive, die gleichzeitig der Blick von ganz unten ist, von den Wurzeln her?
Kindheit im Zeitraffer
Menschenkinder gehen einen seltsamen Weg. Sie werden unreif und schwach geboren – echte Pflegefälle, könnte man sagen! Nehmen wir nur ein Fohlen zum Vergleich. Schon kurz nach der Geburt läuft es seiner Mutter hinterher, staksig zwar, aber auf eigenen Beinen. Ein Menschenbaby dagegen kann noch nicht einmal den Kopf halten (und den Mund auch nicht). Ein ganzes Jahr lang muss es getragen, geschoben und gebettet werden – mindestens! Eine Enttäuschung, könnte man sagen. Auf jeden Fall aber eine echte Aufgabe für die Eltern. Und was für eine Aufgabe! Denn bis ein Kind einmal für sich selbst sorgen kann, verbraucht es 13 Milliarden Kalorien – die müssen tagtäglich vorgestreckt werden. Und verlässlich.
Dann aber, wenn sie erst einmal ausgewachsen sind, heben Menschenkinder regelrecht ab und stemmen ein Pensum, das gewaltig und märchenhaft zugleich ist. Während das groß gewordene Fohlen seine immer gleichen Runden auf der Weide dreht, erfindet das groß gewordene Menschenkind neue, schärfere Faustkeile. Das Rad. Neue Tänze, neue Lieder. Neue Aktienderivate. Züchtet Rosen. Oder schreibt Gedichte über »Rosen und Lider«. Da ist ein ständiges Gewusel an neuen Ideen. Erfindungen. Guten Kopien und schlechten Kopien. Ambition und Spekulation. Betrug. Da werden in einem fort die Kulissen verschoben, und das, während auf der Bühne das Theaterstück noch läuft.
Kurz: Ein Mensch wird nicht einfach Mensch – er wird zu einem kulturellen Wesen mit einer jeweils ganz eigenen Lebenskunst. Zusammen mit den anderen Menschen treibt es ihn weiter, ins Ungewisse. Wir wissen beim Pferd, wohin die Reise geht. Beim Menschen wissen wir nicht einmal, wie er in 50 Jahren leben wird, geschweige denn, wie die Bühne aussieht, die er sich bis dahin gestaltet hat.
Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter so viel Lidern.
Rainer Maria Rilke
Wie schaffen die Menschenkinder das bloß? So abgeschlagen geboren, in der immer gleichen Notlage – und dann machen sie sich auf und gehen noch nie gegangene Wege. Jedes auf seine Art. Wo nehmen Kinder die Kraft her, woher die Ausrüstung? Und woher, insbesondere, den Kompass?
Wie bereiten sich Kinder auf das Leben vor?
Es hat erstaunlich viele Anläufe gebraucht, um diese Frage überhaupt zu stellen. Denn immer lag da ein riesengroßes Hindernis im Weg. Die Annahme nämlich, dass die Entwicklung der Kinder wie am Schnürchen abläuft.
Freud etwa, der Erfinder der Psychoanalyse, nahm an, dass Kinder eine Art stadienhafte Reifung durchlaufen, bei der sie vor allem ihren sexuellen Trieben folgen – die bekannten freudschen »psychosexuellen« Entwicklungsphasen.
In der Mitte des letzten Jahrhunderts glaubte man dann an die formende Kraft der Dressur. Entwicklung sei das Produkt von Belohnung und Bestrafung. »Gebt mir ein Dutzend gesunder Säuglinge … und ich garantiere, dass ich jeden von ihnen zu jeder Art von Spezialisten ausbilden kann – Arzt, Rechtsanwalt, Künstler … ja, sogar Bettler und Dieb …«, meinte der wohl prominenteste Vertreter der »behavioristischen« Schule, John B. Watson. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts schlug schließlich die Stunde der pädagogischen Rundumversorgung. Was aus Kindern einmal werde, entscheide sich am guten Beispiel und am Einsatz der Erwachsenen. Eltern setzten jetzt ihre ganze Energie daran, eine möglichst gute Leitfigur abzugeben. Ja, sie bauten sich zu Lehrern, Trainern und Anspornern auf – und bekamen es postwendend mit der Angst zu tun: Was, wenn ich nicht genug Einsatz bringe? Was, wenn ich einmal selbst einen Durchhänger habe? Was, wenn ich nach der falschen Methode vorgehe?
Das Rätsel der Kreativität
So gut gemeint und ausgefeilt diese Theorien auch waren – sie gingen am schlagenden Herzen der kindlichen Entwicklung glatt vorbei. Keine der Theorien nämlich konnte diesen eigenartigen Lebensweg der Kinder erklären – dass sie aus sich heraus, jedes Kind auf seine Art, Neuland betreten. Dass ihre Entwicklung sie dorthin führt, wo noch nie jemand war – keine Eltern, keine Förderer, keine Vorbilder.
Nehmen wir nur einmal die letzten 50 Jahre und schalten den Zeitraffer an. Gleich zu Beginn kommt uns da ein Sound ins Ohr, den noch kein Mensch zuvor gehört hat – die schmachtenden und gleichzeitig jubelnden Akkorde der Beatles. Wenige Jahre später treten die Blumenkinder auf die Bühne. Und mit ihnen ganz neue Ideen über das Leben, die Welt und was wir Menschen darin tun und lassen sollten. Neue Werte, neue Lebensmuster. 1967: Flower Power. – 1969: Woodstock. Was als jugendliche, fast kindliche Exzentriker-Revolte begann, wird später allmählich in die breitere Gesellschaft eingeflochten – Alternativbewegung, Ökobewegung, Friedensbewegung. Auch im Bereich der Technik geht es in unserer Zeitraffer-Reise drunter und drüber. 1950: die ersten Satelliten, 1970: die ersten PCs. Wenig später das Internet, schließlich Facebook und das iPhone.
All diese Innovationen führen uns nicht etwa zu Menschen mit grauen Haaren, Experten oder irgendwelchen Würdenträgern. Sondern, ja, – zu den Kindern. Zumindest im juristischen Sinne waren die meisten dieser Erfinder, Beweger und Erneuerer tatsächlich noch Kinder! Als sich die Beatles zusammentaten, musste sich noch keiner von ihnen wirklich rasieren. Auch bei den Blumenkindern war noch viel Flaum auf der Haut – sie hießen ja nicht umsonst Blumenkinder. Und die technologischen Neuerer? Bill Gates betrieb seine bahnbrechenden Programmierereien schon neben der Schule her – in Kinderarbeit sozusagen. Und Mark Zuckerberg, der Erfinder und Gründer von Facebook, hatte zwar schon seine eigene Firma, durfte aber nach Feierabend noch nicht einmal ein Bier trinken!
Und da ist es wieder, dieses Rätsel: Wo kommen sie bloß her, die neuen Ideen?
Vorbild, neu betrachtet
Da fällt einem prompt das Naheliegende ein – zumal wenn wir Eltern sind: Das Vorbild der Großen! Die gute Erziehung! Die pädagogischen Maßstäbe, die wir an Kinder anlegen!
Aber kann das denn stimmen? Von den Eltern der Beatles etwa ist bekannt, dass die meisten von ihnen ganz gut Radio spielen konnten. Aber das war es dann auch. Und die »Erfinder« der neuen Lebensstile? Auch die haben ihre Ideen gewiss nicht von ihren Eltern abgekupfert, im Gegenteil – diese standen ja fassungslos kopfschüttelnd daneben.
Und auch die technologischen Neuerer mussten ihren Weg letzten Endes alleine gehen. Ja, sie hatten Vorbilder und bestimmt auch Rückenwind von den Eltern. Aber die waren nun einmal Rechtsanwälte, Lehrerinnen oder Mediziner. Die Endstrecke dieser digitalen Alchimie blieb Kindersache.
Auch die Pädagogik ist beim Thema Vorbild heute vorsichtig geworden. Denn zahllose Beobachtungen und auch Experimente mit neuartigen Verfahren, wie etwa der automatischen Auswertung von Blickkontakten, zeigen, dass beim Vorbild immer auch die Kinder selbst mitwirken. Sie akzeptieren ein Vorbild nämlich nur dann, wenn es unter ganz spezifischen Bedingungen angeboten wird. Dann nämlich, wenn dahinter a) eine funktionierende Beziehung steht, und b) wenn das Beispiel »emotional positiv konnotiert« ist. Will heißen – wenn die Vorbildgeber von dem, was sie da machen, auch wirklich überzeugt und begeistert sind. Nur dann bleibt das Verhalten bei Kindern haften. Nur dann wird aus dem Bild ein Vor-Bild. Überhaupt: Warum sollten Kinder auch mürrischen Großen folgen, die ganz offensichtlich unter dem Lebensweg, den sie eingeschlagen haben, leiden?
Aus Experimenten mit leckerem Gemüse auf dem Tisch ist beispielsweise bekannt, dass die Kleinen nicht einfach zugreifen, wenn die Mama das Grünzeug anpreist, dabei aber selbst sorgenvoll die Stirn runzelt. »Wenn die so dreinschauen muss«, sagen sich die Kleinen da vermutlich, »ist an dem Zeug auf dem Teller bestimmt was nicht in Ordnung …« Da folgen sie eher schon einem älteren Geschwisterkind – wenn das mit Begeisterung zugreift, probieren sie auch. Kinder machen einem beim Essen nichts vor.
Sagen wir es kurz und schmerzlos: Wir Eltern sind nicht Vorbild qua Amt, sondern nur wenn wir authentisch das tun, was wir gerne tun.
S015
Keine blinde Imitation
Kinder treten also keineswegs blind in die Fußstapfen der Großen. Sie beobachten und machen sich ihren eigenen Reim. Dann ziehen sie los – gerne auch ihrer eigenen Nase nach. Die mag in die gleiche Richtung weisen wie die der Großen, muss es aber nicht.
Und das führt uns in das vielleicht spannendste Kapitel der Entwicklungspsychologie überhaupt: Woher kommt die Freiheit, eigene Wege zu gehen?
Einer, der intensiv über die Rolle des Beispiels in der Erziehung nachgedacht hat, war Heinrich von Kleist: »Wie misslich würde es mit der Sittlichkeit aussehen«, schreibt er in seinen Aufsätzen und kleinen Schriften, »wenn sie kein tieferes Fundament hätte als das sogenannte gute Beispiel eines Vaters oder einer Mutter und die platten Ermahnungen eines Hofmeisters oder einer französischen Mamsell. – Aber das Kind ist kein Wachs, das sich in eines Menschen Händen zu einer beliebigen Gestalt kneten lässt: es lebt, es ist frei; es trägt ein unabhängiges und eigentümliches Vermögen der Entwickelung und das Muster aller innerlichen Gestaltung in sich.«
Das erste Segel: Selbstwirksamkeit
Wir wissen heute, dass Kinder für ihre Fahrt ins Neuland zwei Segel brauchen. Das erste Segel, nennen wir es das Vordersegel, wird schon in den ersten Tagen gesetzt. Bindet man einem Säugling wenige Tage nach der Geburt eine Schnur ans Füßchen und verbindet diese mit einem Mobile über seinem Bettchen, so bekommt er schnell heraus, wie er das Mobile in Bewegung setzen kann. Und die Messungen seiner körperlichen Reaktionen zeigen, dass ihn das so richtig begeistert. Es gefällt ihm, wirksam zu sein, sich in die Abläufe der Welt um ihn herum einzubringen. Diese Erkenntnis ist erstaunlicherweise ziemlich neu: Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden Säuglinge eher als eine Art lebendes Gemüse verstanden, das angeblich dann zufrieden ist, wenn es nur ausreichend versorgt wird. Heute dagegen sehen wir Säuglinge mehr als aktive Gestalter. Sie wollen in die Welt eingreifen. Und das von Anfang an.
Und das gilt auch für ihre Beziehungen. Auch hier wollen die Kleinen selbst wirksam sein und dieses wichtigste Gut ihrer Entwicklung mitgestalten. Nehmen wir einmal einen so simplen Prozess wie das Hochnehmen eines Babys. Der kleine Mensch landet dabei nicht etwa wahllos in den Armen des Hochnehmenden, sondern in der Regel auf der linken Seite, seine Augen etwa 25 cm von denen des Haltenden entfernt. (Dass die linke Seite bevorzugt wird, hat übrigens nicht etwa mit der Händigkeit oder dem Herzschlag des Tragenden zu tun, sondern mit dessen Gehirn.)1
Wer sitzt bei diesem simplen Hochnehmen am Ruder? Wir wissen heute, dass es sich eigentlich um einen gemeinsam gesteuerten Prozess handelt – ja, im Grunde könnte man von einem Tanz an unsichtbaren Schnüren sprechen. Das Baby bringt sich auf dem Weg in die Arme nämlich deutlich ein – durch seine Körperspannung, durch die Bewegung seiner Beinchen und auch durch Lautäußerungen (die bis zum Weinen gehen können, sollte sich das Baby in einer misslichen Lage fühlen).
Babys suchen diese aktive Rolle nicht zum Zeitvertreib. Ihr Trieb, aus sich heraus wirksam zu sein, ist schlichtweg die Grundlage ihrer Entwicklung. Sie müssen ja effektiv kommunizieren können, damit sie mit ihren Bedürfnissen auch »ankommen«! Und sie müssen ihre Umwelt erforschen, in sie eindringen, jedes Steinchen umdrehen! Über diese Erfahrungen bauen sie ihre Kompetenzen auf, üben ihre Sinne, bespielen die ganze Klaviatur ihres Körpers. Über diesen Drang zur Selbsttätigkeit lernen sie.
Nicht jedes Baby aber kann diesen Drang ausleben. Der Erforschungstrieb ist nämlich nur dann aktiv, wenn sich Kinder sicher und geborgen fühlen. Das heißt – wenn sie in verlässlichen, authentischen, feinfühligen Beziehungen leben können. Gestresste, in ihren Beziehungen ungewisse oder verunsicherte Babys gehen eben nicht auf Entdeckungsreise – das vielleicht ist der interessanteste Befund der Bindungsforschung aus den letzten Jahrzehnten.2
Kinder jedoch, die der Welt vertrauen können, machen sich auf, und wie! Anders, als von manchen Eltern befürchtet, nutzen sie ihren sicheren Hafen also nicht, um dort ihr Schiffchen festzutäuen und sich nur bei Mama oder Papa in Sicherheit zu wiegen. Immer wieder nutzen sie den Hafen, um hinauszufahren. Und dabei der Welt zu begegnen.
Das zweite Segel: Selbstorganisation
Das zweite Segel wird spätestens dann aufgezogen, wenn sich die Kinder unter ihresgleichen mischen. Jetzt geht es darum, soziale Zusammenhänge zu begreifen. Darum, dass Kinder die Welt gemeinsam auseinandernehmen und neu zusammensetzen!
Kinder unter sich? Kann das gut gehen? Natürlich. Betrachten wir einmal die Kindheit in historischer oder kulturvergleichender Perspektive. Da fällt eines auf: Die mittlere Kindheit – also etwa die Zeit ab dem dritten Lebensjahr – war bis in die allerjüngste Zeit eine Entwicklungsstrecke, die Kinder unter Kindern verbrachten. Natürlich sorgten die Erwachsenen auch hier für einen schützenden und nährenden Rahmen. Aber darin organisierten sich Kinder zu einem großen Teil selbst. Beim Spielen, beim Erkunden der Umwelt – bei allem, was ihnen wichtig war. Und was sie da alles erleben konnten! Es ist interessant, dass die Entwicklungspsychologie gerade heute, wo es die von Kindern selbst gestalteten Kindergruppen fast nicht mehr gibt, immer mehr wissenschaftliche Hinweise liefert, wie dringend Kinder eigentlich andere Kinder für ihre Entwicklung brauchen.
Etwa, dass Kinder im Umgang mit älteren Kindern sehr effektiv lernen, sich körperlich, geistig, sprachlich und emotional zu »strecken«. Dass es ihnen aber auch guttut, wenn sie sich zu jüngeren Kindern »beugen« können – dass sie dadurch mehr Einfühlungsvermögen entwickeln, mehr soziale Kompetenz und Selbstbewusstsein.
Dass das Prinzip der Selbstorganisation unter Kindern als Grundlage für effektives Lernen auch in modernen, von komplexer Technologie geprägten Zusammenhängen noch gilt, hat niemand besser zeigen können als der bekannte Kommunikationsforscher Sugata Mitra – in seinem klassischen Experiment »Das Loch in der Wand«.
Der indische Wissenschaftler riss in der Tat ein Loch in eine Wand. Und zwar in die Begrenzungswand eines Slums in Kalkaji, Delhi, im Jahr 1999. In das Loch baute er eine Art Kiosk mit einem leistungsfähigen Computer – Tastatur, Maus und Breitbandinternet inklusive. Darüber installierte er eine Kamera, um zu dokumentieren, was an seinem Slum-Kiosk so alles passierte – wohl wissend, dass die potenziellen Besucher weder die eingestellte Betriebssprache des Computers (Englisch) wirklich verstanden noch überhaupt jemals mit einem Computer zu tun gehabt hatten.
Dass sich vor der neuen Maschine nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder sammelten, war ja noch ganz gut zu verstehen. Dass die Kinder aber schon nach 4 Monaten bar jeder Vorkenntnis die Anwendungen auf dem Rechner verstehen und benutzen konnten (von Text- über Mal- bis hin zu E-Mail-Programmen) war dann doch eine gewaltige Überraschung. Die Experimente wurden seither an vielen Orten der Welt wiederholt und auch mit neuen Applikationen versehen (etwa Spracherkennungsprogrammen, die nur auf »gutes« Englisch reagierten – wodurch die Kinder deutlich schnellere Fortschritte in dieser Sprache machten als etwa im Schulunterricht!).
Die Spur, auf die Sugata Mitra mit seinen Experimenten zur »minimalinvasiven Bildung« (wie er es nannte) gestoßen ist, führt weit über die Annahmen der klassischen Pädagogik hinaus. Sie führt zu dem neuen Bild eines koevolutiven Lernens – eines von Kindern gemeinsam gestalteten Lernens.
Tatsächlich war die wohl interessanteste Beobachtung, dass sich die Kinder beim Lernen gegenseitig unterstützen, ja, geradezu aufstacheln. Da stellt sich also nicht etwa ein »Lehrer« oder der »Klassenbeste« vorn hin und gibt sein Wissen weiter. Nein, vorn stehen immer mehrere Kinder. Sie probieren aus, und sie reden über das, was sie tun und wie sie sich das alles erklären. Dahinter steht eine Traube weiterer Kinder – diese beobachten, kommentieren, machen Vorschläge (meist die falschen, wie Sugata Mitra feststellte). Spannend dabei ist: Die Besetzung der Kinder an der vorderen Front wechselt. Da sind je nach zu bewältigender Aufgabe einmal kleinere und einmal größere Kinder aktiv – bei jeder Herausforderung mit diesem wundersamen Ding hat eine andere Altersgruppe die Nase vorn. Manche Anwendungen verstehen Siebenjährige sogar rascher als Zehnjährige! Insgesamt aber kommen die Teilnehmer an dem Projekt »Computer verstehen« vor allem durch die altersübergreifende Kooperation weiter. Auf diese Art scheinen die Kinder sich gegenseitig am effektivsten Lernbrücken aufzubauen, die jeweils genau den Graben überspannen, der gerade im Weg steht.
Das passt zu dem, was über das gemischtaltrige Lernen aus anderen Experimenten bekannt ist: Indem sich Kinder auf verschiedenen Entwicklungsniveaus austauschen, entstehen vielfältige Lernanreize, von denen sowohl die jüngeren als auch die älteren profitieren. So ist beispielsweise gut untersucht, dass ein Ballspiel unter 4-Jährigen nicht sehr erfreulich abläuft – das eine Kind kann den Ball nicht richtig werfen, das andere ihn nicht richtig fangen. Spielen zwei 4- und 8-Jährige zusammen, läuft das schon besser: Der Ältere bekommt durch die krummen Bälle eine Herausforderung (er ist dann der Torwart) und kann seinerseits dem Kleineren die Bälle passgerecht zuwerfen … Auch in der Sprachentwicklung scheinen die beim gemischtaltrigen Spielen angelegten Gerüste höher zu reichen. Die Kleinen sind ja oft die Ideengeber (»Wir reisen jetzt auf den Mond«) – die Größeren dagegen setzen die Ideen um und nehmen mit ihren Kommentaren die Kleinen mit auf Sprachreisen, auf denen sie dann die vielen neuen Begriffe (Mondkapsel, Astronaut etc. …) aus dem Kontext heraus verstehen lernen. Ähnliches gilt für das soziale Lernen – Kinder wechseln in altersgemischten Gruppen allein aufgrund ihres Entwicklungsfortschritts ja beständig die Rollen in der Gruppe und machen damit sehr vielfältige soziale Erfahrungen – sie gehören nun einmal die Hälfte der Zeit zu den Älteren und die andere Hälfte zu den Jüngeren. Von diesem gemischten Angebot an Vorbildern, Lernpartnern und Spielerfahrungen profitieren auch diejenigen, die in ihrer Entwicklung eher hinterherhinken oder voranstürmen – sie finden dann bei den Größeren oder Kleineren zusätzliche Anlaufstationen (manche Pädagogen nehmen sogar an, dass sowohl die Begabtenförderung als auch die Inklusion – also das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern – nur in gemischtaltrigen Gruppen wirklich funktionieren kann). Aber zurück zu Sugata Mitras Experiment. Da war noch etwas Zweites interessant: Das Lernen war für die Kinder ein Spiel. Ja, sie tauchten in die Tiefenstruktur des Computers ein, als handle es sich um einen Abenteuerparcours, der ihnen jeden Tag eine neue Entdeckung bescherte.
Sugata Mitras Loch in der Wand legt jedenfalls eines nahe: Bei dem Blick auf die Wipfel der Bäume, nein, die Köpfe der Kinder, haben wir zu lange gefragt, was die Großen denn für die Kleinen tun können. Jetzt aber ist es an der Zeit, dass wir eine weitere Frage stellen: Was tragen die Kinder denn selbst zu ihrer Entwicklung bei?
S021
\ Das Prinzip der Selbstorganisation scheint in allen natürlichen Entwicklungsprozessen eine entscheidende Rolle zu spielen. Kein Wunder, dass einem dieses Prinzip nicht nur bei der menschlichen Entwicklung begegnet. Nehmen wir einen Ast, wie er aus einem Stamm wächst – ein Prozess, der neuerdings in dem Forschungszweig der Bionik untersucht wird. Die Bionik will verstehen, nach welchen Konstruktionsprinzipien die Natur vorgeht, um die unvergleichliche Stabilität und Belastbarkeit zu erreichen, wie sie etwa in Baumkronen, Wurzelwerken, Pflanzenstängeln oder auch in Spinnennetzen, Tierknochen oder Vogelfedern gemessen werden kann. Tatsächlich ist in einer Baumkrone jeder Ast an die im Laufe der Lebenszeit zu erwartenden Belastungen angepasst. Das geht nur, indem während des Wachstums des dünnen Zweiges hin zu einem starken Ast beständig Informationen aus der Umwelt aufgegriffen werden und in die laufende Konstruktion mit einfließen – indem das Wachstum des Astes sich also innerhalb der vorgefundenen Randbedingungen selbst organisiert. Im Falle des Astes etwa werden die Holzfasern je nach Sonneneinstrahlung und Krafteinwirkung durch Schwerkraft, Wind oder Schneelast unterschiedlich angelegt und verdichtet, auch unterschiedlich verankert und verstärkt. Deshalb wächst jeder Ast in einem unterschiedlichen Winkel, hat eine andere Dicke, einen anderen Querschnitt und einen anderen Verlauf – eine zu Struktur gewordene Dynamik, auf die Ingenieure neidvoll blicken. Bei diesem Blick auf die Selbstorganisation lebender Systeme zeigt sich eines: Nur sich selbst organisierende Systeme sind stabile, nachhaltige Systeme, denn nur durch die Selbstorganisation ist das Wachstum auf die Umweltbedingungen abgestimmt.
Manövrierfähig
Fassen wir zusammen. Wenn es für Kinder gut läuft – wenn sie sich sicher fühlen und wenn sie sich auf Augenhöhe austauschen dürfen –, setzen sie auf ihrem Entwicklungsweg zwei entscheidende Segel:
… das erste Segel lässt sie aus sich heraus wirksam werden. Es weckt ihre Neugier, die ja nichts anderes ist als eine »Neu-Lust«, eine beständige Lust auf Neues. Und die ist noch immer die wichtigste Eintrittskarte zum Lernen.
… das zweite Segel erlaubt ihnen, ihre Entwicklung selbst mit zu organisieren. Dieses Segel richten sie mit anderen Kindern auf und nutzen dabei die von der Gruppe ausgehenden Entwicklungsreize.
Die Fahrt, die die Kinder mit diesen beiden Segeln aufnehmen, macht ihr Schiff manövrierfähig und wendig. Mit diesem Schiff können sie Neuland erreichen.
Das Fundament der Entwicklung
Aber Kinder nutzen diesen Rückenwind nicht nur, um Neues zu finden und zu entwickeln. Sie nutzen ihn, um überhaupt im Leben zu bestehen. Sie nutzen ihn, um sich ihr Lebensfundament zu bauen. Die menschliche Entwicklung ist ja in gewisser Weise durchaus mit dem Bau eines Hauses zu vergleichen. Die Erkerchen, die Fassade, die gemütliche Dachstube, alles nett und schön. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, entsteht dennoch keine rechte Freude.
So auch in der menschlichen Entwicklung. Da stehen alle Menschen zunächst einmal vor den gleichen Herausforderungen – egal, ob sie als Piraten leben oder als Pastorinnen, egal ob in Hamburg oder in Honolulu. Sie müssen Neues entwickeln können, zum einen. Aber sie müssen auch mit sich und ihren Emotionen klarkommen. Sie müssen sich Ziele setzen und diese mit Kraft verfolgen können. Sie müssen selbstständig werden. Und nicht nur das. Sie müssen auch mit anderen klarkommen, deren Gefühle und Absichten verstehen und sich in Gruppen einbringen können. Und sie müssen mit Widrigkeiten umgehen lernen, ohne dabei gleich aus dem Gleis zu geraten – im Leben scheint nun einmal nicht immer die Sonne.
Dieses Bündel fundamentaler Lebenskompetenzen – in der Fachsprache auch mit Begriffen wie »Kreativität«, »exekutive Kontrolle«, »soziale Kompetenz« und »Resilienz« belegt – bildete schon immer das Fundament der menschlichen Entwicklung. Das gilt auch heute. Nett, wenn die Kinder gut beim PISA-Test abschneiden – aber wenn sie die genannten Grundkompetenzen nicht ausbilden können, hilft ihnen das nicht wirklich weiter.
Nicht vermittelbar
Von diesen fundamentalen Grundkompetenzen wissen wir heute vor allem: Sie können nicht vermittelt werden, auch nicht durch eine noch so gute Pädagogik. Man kann Kindern soziale Kompetenz nicht beibringen. Man kann ihnen innere Stärke nicht anerziehen. Man kann ihnen Mitgefühl nicht vermitteln, auch wenn man noch so liebevoll mit ihnen redet. Oder ihnen lehrreiche Bücher vorliest, in denen der Bär dem Pinguin hilft und der Pinguin dem Igel (obwohl der doch Stacheln hat!). Nein, solche Kompetenzen müssen erfahren werden. Dieser fundamentale Schatz ist nur von den Kindern selbst zu heben, im alltäglichen Miteinander mit anderen Menschen – und sowohl jüngere als auch ältere Kinder, spielen dabei eine ganz besonders wichtige Rolle. Da lernen Kinder Stück für Stück ein Rückgrat auszubilden, da lernen sie, wie man mit sich und anderen klarkommt. Erwachsene spielen da auch eine Rolle, natürlich. Aber sie sind nicht die Leiter, nicht die Antreiber, nicht die Ideengeber.
Kurz: Kinder treibt es förmlich dazu, ihre fundamentalen Lebenskompetenzen aufzubauen. Sie wollen ihre »Entwicklungssegel« setzen. Das gelingt ihnen dann, wenn sie sich in funktionierenden Beziehungen in der Familie geborgen fühlen. Und wenn sie sich auf Augenhöhe mit anderen Kindern bewähren dürfen, in spielerischem Ernst.
»Die Welt, die ganze Masse von Objekten, die auf die Sinne wirken, hält und regiert, an tausend und wieder tausend Fäden, das junge, die Erde begrüßende, Kind. Von diesen Fäden, ihm um die Seele gelegt, ist allerdings die Erziehung einer, und sogar der wichtigste und stärkste; verglichen aber mit der ganzen Totalität, mit der ganzen Zusammenfassung der übrigen, verhält er sich wie ein Zwirnsfaden zu einem Ankertau.« HEINRICH VON KLEIST
Das neue Bild vom Lernen
Damit wären wir bei einer anderen Sicht auf die kindliche Entwicklung angelangt. Kinder entwickeln sich weder einfach so aus sich heraus, durch eine Art mirakulöse Reifung oder durch das Werk irgendwelcher Triebe. Sie sind keine Pflanzen, die sich einfach entfalten. Noch brauchen sie jemanden, der sie nach oben zieht, der sie huckepack nimmt oder ihre Potenziale aus ihnen herauskitzelt. Entwicklung braucht überhaupt kein Gefälle, weder von unten nach oben noch von oben nach unten. Entwicklung verläuft in einer dritten Dimension – in einem sich selbst organisierenden System. Da spielen die Großen eine Rolle und da spielen die Kleinen eine Rolle, aber da gibt es keinen, der den Teig rührt und knetet. Da gibt es nur eines: Beziehungen von Mensch zu Mensch. Wo diese funktionieren, funktioniert auch die Entwicklung.
Das heißt nicht, dass es da keine Lehrer gibt, keine Klügeren oder Erfahreneren. Keine Schützenden und Behütenden. Keine Stärkeren und Wissenderen. Die gibt es, und das ist gut so. Aber diese Impulsgeber sind nicht immer die Erwachsenen. Kinder lernen vieles von Erwachsenen. Aber manches können sie eben nur von anderen Kindern lernen.
Das heißt auch nicht, dass es da keine Grenzen gibt, kein Nein und keine Widerworte. Die gibt es, und auch das geht in Ordnung. Aber die Grenzen entstehen in gemeinsam gestalteten Beziehungen, nicht durch ein Machtgefälle oder weil irgendwelche Erziehungsexperten sie ständig im Mund führen. Neben den Grenzen besteht immer auch Freiheit.
S025
\ Liebe Abiturienten und Abiturientinnen,
Ihr seid jetzt in einer ganz wunderbaren Situation: Eure Eltern haben so langsam kapiert, dass ihr es seid, die später einmal das Altersheim für sie aussuchen werden. Und ihr habt ein Diplom, das euch Türen öffnen kann und neue Wege gehen lässt, ob an der Uni oder sonst wo. Ihr lebt jetzt sozusagen das, was die Evolutionsbiologen immer als Theorie behauptet haben: Bei einer so intelligenten, erfinderischen Art wie Homo sapiens muss der Nachwuchs über seine Eltern hinauswachsen können. Anders als ein Katzenkind können wir erfinderische, kluge Menschen unsere Lebensstrategie nicht bei Mama und Papa abkupfern. Dafür schaffen wir viel zu oft neue Tatsachen.
Das ist lästig, aber birgt auch eine große Hoffnung. Denn realistisch gesehen sind wir Erwachsenen derzeit nicht sonderlich erfolgreich. Wenn nicht alle Zeichen trügen, haben wir den Planeten in eine üble Schieflage gebracht und bisher keinen Weg gefunden, mit den begrenzten Bordmitteln zu leben, die uns auf der Erde zur Verfügung stehen. Und gerade die, die wir manchmal als unsere »Elite« bezeichnen, kann man in weiten Teilen mit Fug und Recht als sozial verwahrlost bezeichnen: Sie sind raffgierig, ichbesessen und ohne Weitblick.
Damit läge also der Schluss nahe, dass ihr euch neue Vorbilder sucht. Dass ihr also das macht, was der Nachwuchs von Homo sapiens schon immer machen musste: neue Wege gehen. Also eben nicht in die Fußstapfen der Alten treten. Wir Menschen hätten anders nicht einmal das Feuer gezähmt.
Für euren Weg ins Neuland – auf dem übrigens auch unsere Hoffnung beruht – viel Glück!
VERBUNDENHEIT
Bäume brauchen Wurzeln, das weiß jedes Kind. Und ein kleiner Baum kann umso besser wachsen und gedeihen, je kräftiger seine Wurzeln sind, mit denen er sich im Erdreich verankert und seine Nährstoffe aufnimmt. Nur wenn es einem kleinen Baum gelingt, tief reichende und weitverzweigte Wurzeln auszubilden, wird er später auch Wind und Wetter, ja sogar Stürme aushalten können.
Auch Kinder brauchen feste Wurzeln. Offenbar wissen das nicht alle Eltern, auch nicht alle Erzieher oder gar alle Bildungspolitiker. Sie halten das, was man an jedem Baum sehen, messen und zählen kann, also die Äste oder die Blätter oder auch nur die Früchte, für wichtiger als die verborgenen Wurzeln. Deshalb richten sie ihre ganze Aufmerksamkeit darauf, ihre oder die ihnen anvertrauten Kinder so zu erziehen, dass sie möglichst große und zahlreiche Äste, bunte Blätter und nützliche Früchte entwickeln. Und dabei vergessen sie, dass Kinder Wurzeln brauchen. Die Wurzeln, mit denen sich Kinder fest im Erdreich verankern und ihre Nährstoffe aufnehmen, sind sichere emotionale Beziehungen zu den Menschen, bei denen sie aufwachsen. Wenn sie diese sicheren Bindungen nicht entwickeln können, bleiben auch ihre Äste, Blätter und Früchte nur eine Kümmerversion dessen, was daraus hätte werden können. Und wenn der erste Sturm kommt, wenn diese Kinder also erwachsen werden und sich in der Welt zurechtfinden müssen, fallen sie um.
Ist erst einmal ein ganzer Wald aus lauter derartig wurzelkranken Bäumen entstanden, was geschieht dann? Solange kein Sturm kommt, gar nichts. Doch irgendwann beginnen die ersten Bäume an den schlechteren Standorten ihre Blätter zu verlieren und zu verdorren. Bemerkt wird das nur von Menschen, denen der Wald am Herzen liegt und die ihn sehr genau kennen. Aber ihre Alarmrufe verhallen so lange ungehört, bis das Ausmaß der Schäden auch von denen bemerkt wird, die nur selten in den Wald kommen. Dann wird gemessen und gezählt und ein Waldschadensbericht erstellt. Es wird nach Abhilfe gesucht, Dünger gestreut, gekalkt und der Eindruck erweckt, als hätte man alles fest im Griff. Und immer wieder melden sich Experten zu Wort, um ihrer Verwunderung über all die Aufregung wegen ein paar dahinsiechender Bäume Ausdruck zu verleihen: »Wer Baumarten dort angepflanzt hat, wo sie nicht hingehören, und dann auch noch in Monokulturen, der braucht sich nicht zu wundern, wenn sie irgendwann verkümmern. Wir brauchen ohnehin einen anderen Wald!«, sagen die die einen. »Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen auch ohne Wald überleben können. Wir brauchen also gar keinen Wald!«, behaupten die anderen.
Aber Kinder brauchen wir schon. Und wenn die keine tiefen und weitreichenden Wurzeln mehr ausbilden können, verlieren nicht nur sie, sondern verlieren wir alle den Halt. Dann läuft unsere ganze Gesellschaft Gefahr, irgendwann umzukippen. Die wachsende Aggressivität und der sich ausbreitende Rechtsradikalismus sind ebenso alarmierende Zeichen früher Bindungsstörungen wie die in Schulen zu beobachtende Zunahme von Lern- und Verhaltensstörungen oder der weit verbreitete Drogenkonsum. Längst sind davon nicht mehr nur Kinder und Jugendliche betroffen, die unter besonders ungünstigen Bedingungen aufwachsen müssen.
Das soziale Beziehungsgefüge, in das Kinder heutzutage hineinwachsen, ist immer brüchiger geworden. Kinder finden in dieser Welt nur noch wenig Verständnis für ihre elementaren Bedürfnisse. Oft mangelt es an den für die Ausbildung sicherer Bindungen erforderlichen Rahmenbedingungen, an emotionaler Zuwendung und Feinfühligkeit, an vielfältigen Anregungen und einer angemessenen Grenzziehung. So sind immer mehr Kinder gezwungen, den daraus resultierenden Mangel an emotionaler Sicherheit durch verstärkte Selbstbezogenheit zu kompensieren.
Sie schaffen sich eine eigene, von ihnen selbst bestimmte Lebenswelt und schirmen sich gegenüber fremden Einflüssen und Anregungen ab, die nicht mit ihren Vorstellungen übereinstimmen. Verstärkt wird diese Haltung dadurch, dass in allen Schichten der Gesellschaft sich die Lebensbedingungen in den letzten Jahren deutlich in Richtung einer zunehmenden Individualisierung verschoben haben.
In dieser Welt gibt es keine wirklichen Herausforderungen mehr. Es können keine vielfältigen neuen Erfahrungen gemacht und im sich entwickelnden Gehirn verankert werden. Wichtige Entwicklungsprozesse im kindlichen Gehirn finden nicht mehr oder nur eingeschränkt statt. Für das Lernverhalten der Kinder bedeutet dies einen Rückgang an Motivation, Verstehen, Behalten, Erinnern, Erkennen von Zusammenhängen und eine eingeschränkte Fähigkeit beim Erkennen und Lösen von Konflikten. Ihr Sozialverhalten wird bestimmt von einem zunehmenden Rückzug in selbst geschaffene Welten, Ablehnung fremder Vorstellungen, aggressiver Verteidigung einmal eingeschlagener Bewältigungsstrategien, mangelndem Einfühlungsvermögen, Rigidität und Problemen bei der Aneignung psychosozialer Kompetenzen.
Um die genetisch angelegten Möglichkeiten zur Ausbildung hochkomplexer und zeitlebens veränderbarer Verschaltungen in vollem Umfang nutzen zu können, braucht ein menschliches Gehirn optimale Entwicklungsbedingungen.
Gegen Ende der Schwangerschaft sind verschiedene Sinnesorgane und die dazugehörigen Verschaltungen im Gehirn des Fötus bereits so weit ausgereift, dass er damit seine ersten sinnlichen Wahrnehmungen macht. Er spürt das Schaukeln, schmeckt das Fruchtwasser, hört die Herztöne der Mutter und andere Geräusche, auch Stimmen und Musik von außen. Alles, was in seine Welt vordringt und was es wahrzunehmen imstande ist, verbindet das ungeborene Kind mit der Sicherheit und Geborgenheit, die in dieser seiner Welt normalerweise herrschen. Plötzlich und während der Schwangerschaft möglicherweise wiederholt auftretende Störungen, etwa laute Geräusche, aber auch Angst und Stress der Mutter, die der Fötus als Veränderungen ihres Herzschlages wahrnimmt und die mit Veränderungen der mütterlichen Blutversorgung und der Ausschüttung verschiedener Hormone einhergehen, können dazu führen, dass dieses Geborgenheitsgefühl bei manchen Kindern bereits zum Zeitpunkt der Geburt nur schwach ausgeprägt ist. Sie kommen dann bereits unsicherer und ängstlicher zur Welt und sind weitaus schwerer durch mütterliche Zuwendung zu beruhigen als andere Kinder, denen solche intrauterinen Erfahrungen erspart geblieben sind.
Die erste tief greifende Angst und Stressreaktion erlebt jeder Mensch bei seiner Geburt. Verzweifelt muss er nach dieser dramatischen Veränderung seiner bisherigen Lebenswelt nach einem Weg suchen, um sein verloren gegangenes inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Die wichtigste Erfahrung, die jedes Neugeborene während der ersten Tage und Wochen in dieser neuen Welt machen kann und machen muss und die seinen weiteren Entwicklungsweg entscheidend prägt, wird als Gefühl in seinem Gehirn verankert. Es ist das Gefühl, dass es in der Lage ist, seine Angst zu bewältigen. Damit dieses Gefühl entstehen kann, muss das Neugeborene seine Angst zum Ausdruck bringen können, und es ist darauf angewiesen, dass sein Schreien gehört wird, dass sich jemand (normalerweise die Mutter) ihm zuwendet, es wiegt, es an die Brust nimmt, zu ihm spricht, es wärmt und es beruhigt. Nur wenn das Baby jemanden findet, der es ihm ermöglicht, wieder möglichst viel von dem zu spüren und wahrzunehmen, was es bereits aus seinem bisherigen Leben im Mutterleib kennt und was es mit der dort vorgefundenen Sicherheit und Geborgenheit verbindet, kann es seine Angst überwinden und sein inneres emotionales Gleichgewicht wiederfinden.
Je häufiger ihm das gelingt, desto tiefer wird die Erfahrung in seinem Gehirn verankert, dass es durch eine eigene Leistung in der Lage ist, seine Angst mithilfe eines anderen Menschen (der Mutter) zu bewältigen. Sein Selbstvertrauen wächst dabei ebenso wie sein Vertrauen in die Fähigkeiten der Mutter, ihm Sicherheit und Geborgenheit bieten zu können. Das Kind entwickelt eine enge emotionale Bindung an die Mutter (oder an eine andere primäre Bezugsperson) und übernimmt im weiteren Verlauf seiner Entwicklung nicht nur alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, Vorstellungen und Haltungen von ihr, die ihm zur eigenen Lebensbewältigung wichtig erscheinen. Es weitet auch seine emotionale Bindung auf sämtliche Personen aus, die dieser Mutter wichtig sind, mit denen sie emotional verbunden ist und in deren Gegenwart es sich ebenfalls sicher und geborgen fühlt. Das ist normalerweise zunächst der Vater, später kommen Großeltern, Verwandte und andere den Eltern nahestehende Personen hinzu. Auch deren Fähigkeiten, Haltungen und Vorstellungen eignet sich das Kind umso leichter und besser an, je enger es sich mit diesen Menschen verbunden fühlt.
Während dieser Phase geht es ihm nicht viel anders als einem auskeimenden Samenkorn, das zunächst mit einer sich immer stärker verzweigenden Wurzel in das Erdreich vordringt, sich dort fest verankert und die für die Ausbildung von Spross und Blättern erforderlichen Nährstoffe sammelt. Kindern gelingt es nur dann, solche Wurzeln auszubilden, wenn ihnen während ihrer ersten Lebensjahre Gelegenheit gegeben wird, enge, sichere und feste Bindungen zu möglichst vielen anderen Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorstellungen und Begabungen zu entwickeln. Bei einem Samenkorn entscheiden die genetischen Anlagen darüber, ob der Keim entweder eine Pfahlwurzel oder eine Flachwurzel ausbildet. Bei Kindern entstehen sehr tief reichende, aber wenig verzweigte Wurzeln immer dann, wenn der Boden, auf dem sie aufwachsen, nur von einem oder sehr wenigen und sehr gleichartigen Menschen gestaltet wird. Flache Wurzeln bilden sie immer dann aus, wenn sie zwar mit sehr vielen und sehr unterschiedlichen Menschen Beziehungen eingehen, diese Menschen ihnen aber nur wenig Sicherheit und Geborgenheit bieten.
Damit die Bäume nicht beim kleinsten Sturm umfallen, brauchen sie auf sumpfigem Grund möglichst tief reichende, auf felsigem Grund möglichst flach ausgebreitete Wurzeln. Kinder brauchen also Wurzeln, mit denen sie sich überall und bei jedem Wetter festhalten können. Aus der Wiege der Menschheit, aus Afrika, stammt eine uralte Weisheit, die in einem Satz zusammenfasst, welche Entwicklungsbedingungen Kinder vorfinden müssen, um die genetischen Anlagen zur Ausbildung eines zeitlebens lernfähigen, komplex verschalteten Gehirns in vollem Umfang nutzen zu können. »Um ein Kind richtig aufzuziehen«, sagt ein afrikanisches Sprichwort, »braucht man ein ganzes Dorf.« In einer solchen dörflichen Gemeinschaft finden Kinder hinreichend viele und hinreichend unterschiedliche Anregungen und Herausforderungen, um sich ein möglichst breites Spektrum verschiedenster Kompetenzen anzueignen und die dabei in ihrem Gehirn aktivierten Verschaltungen zu bahnen und zu festigen. Und in einem Dorf können sie einen wachsenden Kreis fester, sicherer Bindungen zu sehr unterschiedlichen Menschen entwickeln und die Erfahrung machen, dass sie innerhalb dieser Gemeinschaft Schutz und Geborgenheit finden.
Dörfer, in denen das funktioniert, sind selten geworden, auch in Afrika. Und wenn es solche Dörfer noch irgendwo gibt, reicht das, was sie bieten, heutzutage kaum noch aus, um ihren Kindern Gelegenheit zu geben, auch das so gut zu entwickeln, was sie ebenso dringend brauchen wie Wurzeln: Flügel, mit denen sie über die Grenzen und Beschränktheiten der Gemeinschaft, in der sie nun einmal zufälligerweise aufgewachsen sind, hinwegfliegen können. Auch diese Flügel wachsen nicht von allein. Kinder, die sich in der Welt, in der sie aufgewachsen sind, nicht sicher fühlen, haben Angst vorm Fliegen. Die Pfahlwurzler sind so fest in ihren wenigen Bindungen verhaftet, dass sie sich nicht in die Luft erheben können, und die Flachwurzler laufen allzu leicht Gefahr, schon abzuheben und davonzuschweben, bevor ihre Flügel so weit entwickelt sind, dass sie damit auch die Richtung ihres Fluges bestimmen können.
Glücklicherweise gibt es aber immer wieder einzelne Kinder, denen es gelingt, sowohl breite als auch tiefe Wurzeln auszubilden, und die deshalb das Gefühl haben, fest und sicher in ihrer jeweiligen Lebenswelt verankert zu sein. Sie hängen nicht wie Klammeraffen an den Rockzipfeln ihrer jeweiligen Bezugspersonen, und sie versuchen auch nicht zwanghaft, ständig unter Beweis zu stellen, was sie alles schon können und dass sie niemanden mehr brauchen, der ihnen zeigt, wie etwas geht.
Solche Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie in sich ruhen, sie sind mit sich selbst, mit ihren Eltern und allem, was sie umgibt, fest verbunden. Sie bleiben sehr lange offen für alles, was es in ihrer jeweiligen Lebenswelt zu entdecken und zu gestalten gibt. Sie brauchen nicht ständig irgendwelche neuen Anregungen von außen und können sich noch für so ziemlich alles begeistern, was sie selbst finden und herausfinden.
Pippi Langstrumpf, wie Astrid Lindgren sie beschrieben hat, war so ein Kind, ebenso wie Mark Twains Tom Sawyer und Huckleberry Finn und viele andere, die man auch heute noch in Kindergärten und Schulen finden und schon von Weitem an ihrer unbändigen Lust am Leben erkennen kann. Sie wirken nicht nur kompetenter als andere Kinder, sie sind auch umsichtiger und verantwortungsbewusster. Weil sie besser verwurzelt sind, können sie die in ihnen angelegten Begabungen und Talente besser entfalten.
Nun kommt aber kein Kind entweder schon als Flachwurzler oder als Tiefwurzler zur Welt. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen und herauszufinden, was für Erfahrungen es sind, die ein Kind braucht, um sich hinreichend fest in der Welt zu verwurzeln, um dieses tiefe Gefühl von Verbundenheit entwickeln und in seinem Gehirn fest verankern zu können. Auch hier ist die Antwort sehr einfach: Um sich mit dem, was das Leben bietet, verbunden fühlen zu können, muss ein Kind die Gelegenheit bekommen, diese Verbundenheit selbst, also am eigenen Leib und mit allen Sinnen, zu erfahren. Am Anfang des Lebens, schon vor der Geburt, hat ja fast jedes Kind diese Grunderfahrung bereits gemacht.
Sie bildet die Grundlage des unerschütterlichen Vertrauens, mit dem sich das Kind auf den Weg macht. Den meisten Kindern gehen allerdings, manchmal schon im Elternhaus, oft auch im Kindergarten, in der Beziehung zu anderen Kindern und vielen Erwachsenen und besonders auch in der Schule dieses ursprünglich mitgebrachte Gefühl von Verbundenheit und das daraus erwachsende Vertrauen verloren. Mit technischen Spielgeräten und anderen Ersatzmitteln lässt sich dieser Verlust nicht kompensieren. Verbunden kann man sich nur mit etwas fühlen, was lebendig ist. Und manche Kinder haben das Glück, etwas zu finden, was lebt und nichts von ihnen will und nichts von ihnen erwartet: nicht zu Hause, nicht im Kindergarten und nicht in der Schule, aber draußen in der lebendigen Natur.

S034
ZWEIDER SCHATZ DORT DRAUSSEN
Nach diesen zehn Tagen war es, als hätte ein himmlischer Klavierstimmer ihre Seelen neu gestimmt. MALTE ROEPER
Fundament der Entwicklung? Kindheit als ein sich selbst organisierender Systemprozess? Die Sicht der Engel gar? Was hat das alles mit der Natur zu tun und ihrer Bedeutung für die Kinder?
Um es in einem Satz zu sagen: Natur stellt für Kinder einen maßgeschneiderten Entwicklungsraum dar. Eine Erfahrungswelt, die genau auf die Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist. Hier können sie ihre Segel setzen. Hier bläst der Wind, den sie für ihr Gedeihen brauchen. In der Natur können sie wirksam sein. Hier können sie sich auf Augenhöhe selbst organisieren. Hier können sie an ihrem Fundament bauen. Zeit in der Natur ist Entwicklungszeit.
Das klingt fantastisch. Und auch ein bisschen revolutionär – schließlich geht der Trend heute nicht gerade raus ins große Freie. Machen wir uns also auf einen Rundgang. Was ist da los in der Natur, und wie profitieren die Kinder davon?
In der Natur?
Einige Leser werden sich vielleicht zunächst fragen, von welcher Natur hier eigentlich die Rede ist? Ist sie alles, wo ein Himmel drüber ist? Oder gar echte Wildnis, mit umgefallenen Baumstämmen und so? Und wenn ja, wo leben die Autoren denn? Die meisten Kinder wachsen heute doch in der Stadt auf. Wenn da Bäume sind, stehen sie in einem Park. Bäche zum Aufstauen: Fehlanzeige. Dafür gibt es immerhin einen Öko-Spielzeugladen – ist nicht auch Holzspielzeug so etwas wie Natur?
Angestammter Entwicklungsraum