

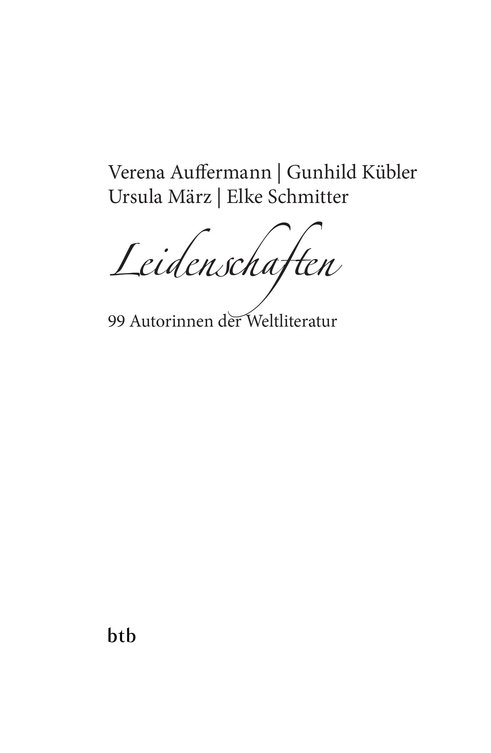
»Auf nichts war Verlass. Nur auf Wunder.«
Mascha Kaléko,
Am Anfang dieses Buches stand die Leidenschaft - die der Autorinnen und unsere. Die Autorinnen: das sind beinahe hundert, aus allen Erdteilen, aus allen Zeiten, mit dem Schwerpunkt der deutschen Sprache im Original. Wir: das sind vier Kritikerinnen, die viele Vorlieben teilen, viele Überzeugungen auch. Und die sich doch in ihren Temperamenten und ihren Lese-Leidenschaften gerade so unterscheiden, dass es immer anregend ist, über diese Unterschiede zu sprechen. Wir haben gemeinsam ein Lesebuch verfasst, das aus Porträts besteht. Sie erheben nicht den Anspruch auf lexikalische Vollständigkeit; sie ermöglichen einen Zugang, geben ein Bild oder auch eine Skizze und wollen eine Lesart plausibel machen. Wir stellen 99 Autorinnen vor, die uns viel bedeuten und deren Beitrag zur Kultur- und Literaturgeschichte von eminenter Wirksamkeit ist, weil sie wichtige oder gute Bücher geschrieben haben.
Wie viele gute Bücher gibt es im Laufe eines Leselebens, die nicht vergessen werden sollen? Und was heißt eigentlich »gut«? Die Antwort darauf ist so einfach wie schwer, wenn man dem Rechnung trägt, dass immer ein Einzelner liest - ein Mensch, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, auf der Suche nach einer Lektüre, die zu einer Erfahrung wird. Wie man von Erfahrungen weiß, kann man sie nicht bestellen: Eine Rundreise zu den Palästen Südindiens kann vor allem als Darminfektion in Erinnerung bleiben, und die Entdeckung einer kleinen romanischen Kirche in einem nordenglischen Industriegebiet als unerwartetes Glück. Dasselbe Buch, das eine Siebzehnjährige mit geröteten Ohren liest, kann sie als Pensionärin kaltlassen, aber womöglich liest sie jetzt eine Geschichte, die sie damals nicht las. Und mit dieser Differenz, sofern sie ihr bewusst wird, liest sie auch ihr eigenes Leben mit. »Gut« kann alles Mögliche heißen: ergreifend, beglückend, erheiternd, verzweifelnd, zum Staunen, zum Schämen, zum Nachdenken zwingend. Es gibt Bücher, in denen man wohnt und in die man sich einrollen kann wie in die Decke auf der Couch, und solche, deren Fremdartigkeit man schätzt. Ob das auch »objektiv« gute Bücher sind? Die Literaturwissenschaft hat, wie jede akademische Lehre, dafür ein Bündel von Kriterien, die vielgestaltig sind, Traditionen und Moden folgen. Ihr jeweiliger Kanon kann sich mit der persönlichen Erfahrung decken, muss aber nicht; vor allem, was die Geschlechter betrifft, sind die Klüfte enorm. Helden des männlichen Selbstwertgefühls wie Jünger, Benn und Hemingway bestücken mit ihrer leicht ranzigen Erhabenheit oder testosterongeschwängerten Angriffslust selten weibliche Bibliotheken, während umgekehrt Austen und Barnes, Levin Varnhagen und Morgner in männlichen Bibliotheken wohl eher aus Versehen zu finden sind. Die Suche nach Übereinstimmung mit einem Kanon ergibt auch biografisch nur wenig Sinn, weil die eigene Lesezeit endlich ist. Und weil es im Reich des Ästhetischen nur Bereicherung, aber kein Funktionsgesetz gibt. Von einem Kühlschrank wissen wir, was er leisten soll; von einem Bild, einem Musikstück, einem Buch erhoffen wir uns nicht Funktionieren, sondern eine Erfahrung. »Dahinter« steht eine Leistung, von der wir oft ebenso wenig wissen wie von Edisons Forschung, die doch dazu führte, dass wir des Nachts im Bett lesen können, wenn uns das Leben oder die Bücher nicht schlafen lassen.
Dieses »Dahinter« hat uns interessiert. Das Schreiben ist zunächst ein einfacher Vorgang; es braucht wenig und nur preiswertes Material. Anders als Bildhauerei, Komposition, Malerei ist die Literatur eine demokratische Kunst, wie gemacht für arme Leute. Bildung schadet natürlich nicht, vor allem aber braucht man: Zeit. Und darum ist es, obwohl für jeden der Tag vierundzwanzig Stunden hat, doch wieder sehr undemokratisch bestellt. Denn Zeit heißt hier: Verfügungsmacht. Eine geschlossene oder doch angelehnte Tür. Ein paar Minuten wenigstens, um den Satz, der angefangen ist, zu Ende zu schreiben. Und mit dem letzten zusammen zu lesen, des Wohlklangs und des Zusammenhangs halber. Und für den nächsten Tag die Chance der Fortsetzung.
In weiten Teilen der Welt sind diese Bedingungen inzwischen auch für Autorinnen erreicht. In Europa, Australien und den USA, in Lateinamerika und in vielen Regionen Asiens gehen Mädchen inzwischen zur Schule und zur Universität, können ihren Lebensweg suchen und - ein nicht zu überschätzender Vorteil – sich Vorbilder wählen, die nicht in der Psychiatrie, im Wochenbett oder in der Namenlosigkeit verkommen sind. Für diese Teile der Welt ist eine solche Anthologie eine Art historischer Bilanz: unvollständig, selbstverständlich, aber in der Tendenz erfreulich und in den Lebensgeschichten eine Galerie der Emanzipation. Am einsamen Anfang steht Sappho, von der wir wenig mehr wissen, als dass sie vor etwa 2600 Jahren mit der Göttin Aphrodite ihre Liebesqualen besprach - und am dicht bevölkerten Ende steht Joanne K. Rowling, eine öffentliche Figur, erfolgreicher als alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller jemals. Von ihr wissen wir unter anderem, dass sie den ersten Roman der Harry-Potter-Serie an einem Teestubentisch verfasste. Sie hatte, alleinerziehend, geschieden und ohne Beruf, so wenig Geld, dass sie mit einem Glas Tee den Vormittag hinbringen musste, aber sie hatte Zeit, da ihre Tochter im Kindergarten war. Und sie ist eine gebildete und gut ausgebildete Frau.
Virginia Woolfs berühmtes Gedankenspiel, was aus einer Schwester Shakespeares geworden wäre - vorausgesetzt, sie wäre so begabt wie ihr Bruder -, gilt mit unverminderter Brisanz für weite Teile Afrikas, der arabischen und muslimischen Welt. Es hat nicht nur mit der Übersetzungslage zu tun, dass so wenige Autorinnen aus diesen Teilen der Erde in unserer Sammlung auftauchen. (Im englischen und französischen Sprachraum jedenfalls gibt es aus diesen Regionen weit mehr zu lesen.) Auch wenn es zunächst nur Zeit, Papier und Bleistift braucht: Damit aus einem Erfahrungsbericht eine Erzählung werden kann, die wir nicht nur der Neuigkeit wegen lesen, muss in aller Regel die Autorin selbst viel gelesen haben, was nicht allein Bericht von Neuigkeiten ist. Die Bibel war nicht nur für Hildegard von Bingen, Emily Dickinson und Margaret Mitchell die wegweisende ästhetische Schulung. Wo, wie in vielen Regionen Afrikas, die Schriftlichkeit ein Importphänomen ist - und ein Lesepublikum erst langsam wächst -, wird die Literatur als Raum der Selbsterfahrung und des Ausdrucks womöglich später entdeckt als andere Medien. Auch ist die Vereinzelung, die zum Schreiben erforderlich ist, kein überall gleichermaßen geschätzter Zustand. Beengte Verhältnisse machen sie unmöglich. Die erfolgreichste Formel der Literatur aber lautet, immer noch: Ein Mensch gibt Auskunft. Einer. Von sich und dem, was er im Kopfe hat.
Für dieses Buch war zweierlei von Bedeutung: Wir wollten Autorinnen vorstellen, weil deren Geschichte eine andere war und ist als die ihrer männlichen Kollegen. Und sie sollten für die Literaturgeschichte bedeutsam sein. Dafür kann es, so wie wir es sehen, nicht nur ein Kriterium geben. Bei dem Versuch zu definieren, was ein Spiel ist, kam der Philosoph Ludwig Wittgenstein auf den Gedanken der Vernetzung, der Vielzahl von Ähnlichkeiten und Überlappungen: Es gibt unterhaltende Spiele, Brettspiele, Glücksspiele, Spiele mit dem Ball oder mit Murmeln, es gibt Mannschaftsspiele, Kampfspiele et cetera - und nicht eine Eigenschaft ist allen gemeinsam. So stellen wir aus der Geschichte der weiblichen Literatur vor, was Geschichte geschrieben hat, und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Hedwig Courths-Mahler erfand mit ihren zweihundertacht Romanen ein Genre, das sprichwörtlich geworden ist, so wie Agatha Christie nicht nur die erste erfolgreiche Kriminalautorin war, sondern ihr Name auch Synonym für eine weltweit erfolgreiche Gattung wurde. Hildegard von Bingen und Christine de Pizan sind die ersten noch heute bekannten weiblichen Stimmen Europas, 1800 Jahre nach Sappho, Ikonen von Innigkeit und Furor, während von der alten Hochkultur Japans Sei Shonagon und Murasaki Shikibu geblieben sind. Harriet Beecher Stowe hat mit einem einzigen Buch, mit »Onkel Toms Hütte«, Weltgeschichte gemacht, doch kämpfen in unserem Bewusstsein ihre drastisch-blutigen Bilder mit dem anmutig-sentimentalen Panorama des amerikanischen Südens, wie Margaret Mitchell es in »Vom Winde verweht« ausgemalt hat. Allerdings beschrieb sie nicht nur Reif röcke, sondern auch das Elend der heimkommenden Soldaten, die Ruhr und den Hunger so realistisch wie kein Mann zuvor. Bettine von Arnim, Mutter von sieben Kindern, ging ihren literarischen Träumen mit kindlichem Enthusiasmus nach und hatte doch politische Empfindsamkeit genug, das Elend ihrer erstickten Epoche einem preußischen König unter die Nase zu reiben. Rahel Levin Varnhagen, Brief-Schriftstellerin, fasste dieselbe zeitgenössische Lage in ihrem Tagebuch so kurz wie hellsichtig zusammen: »Negerhandel, Krieg, Ehe! - und sie wundern sich, und flicken -«. Friederike Mayröcker, mehr als ein halbes Leben in derselben Stube mit dem Rücken zum Weltgeschehen, erdichtet einen Kosmos sui generis, radikal mit sich beschäftigt wie Emily Dickinson, die zwanzig Jahre ihr Haus nicht verließ und von der zu Lebzeiten nicht mehr als zehn Gedichte anonym veröffentlicht wurden. Wisława Szymborska, Nobelpreisträgerin, verfasst ihre lyrischen Kommentare zu dem, was für sie von Bedeutung ist, unter geheim gehaltener Adresse; Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin, packt die Übel unseres Alltags frontal mit radikalen sprachlichen Mitteln an, fährt aber zum Schutz ihrer Persönlichkeit nicht einmal nach Stockholm, um den berühmtesten Preis der Welt entgegenzunehmen. Die Amerikanerin Gertrude Stein schrieb eine literarische Revolution; die Schwedin Astrid Lindgren und die Schweizerin Johanna Spyri erfanden zwei weltweit bekannte Figuren. Françoise Sagan wurde mit melancholischen, schmalen Romanen weltberühmt, von denen so schwer zu sagen ist, was sie so überaus wirkungsvoll macht - während bei Anaïs Nin doch ziemlich klar gesagt werden kann, dass eine solche Ausbeutung des intimen weiblichen Lebens zu literarischen Zwecken einzigartig ist.
Es gibt also viele Kriterien, die unsere Auswahl begründen. Es spielen heiße, persönliche Leidenschaften eine entscheidende Rolle - so wie, beispielsweise, für Unica Zürn, eine niemals prominente Autorin, die, wie Friederike Mayröcker und Emine Sevgi Özdamar, ihren eigenen Stollen in das Bergwerk der Sprache trieb. Oder für die Surrealistin Leonora Carrington, die ihre Erfahrung mit dem hellen wie düsteren Wahn zum Material ihres Schreibens machte. Und es gibt die gewissermaßen kühle Leidenschaft, die Kultur- und Literaturgeschichte erzwingen: Was machte das Werk einer Courths-Mahler so legendär, warum ist Spyris »Heidi« bis heute ein Exportschlager, und weshalb sind die Zumutungen, die Jelinek uns aufgibt, so produktiv? Der kulturgeschichtliche Kanon ist, weil er die tatsächliche Wirkung zum letzten Kriterium nimmt, weniger anfechtbar und veränderlich als der literarische, doch eine spezielle Qualität beider Übereinkünfte liegt eben darin, dass sie, wie das Wetter für alle und die Fußballbundesliga für die meisten, ein Gespräch ermöglichen. Eine andere Qualität: Dieses Gespräch führt immer zurück zu den Fragen, die wir, indem wir lesen, an uns stellen. Was wollen wir wissen? Worauf hoffen wir? Was wollen wir vielleicht sogar tun?
Die Inderin Arundhati Roy verbindet das Leben einer Literatin mit dem einer politischen Aktivistin; sie steht damit in einer Reihe mit Susan Sontag und Simone de Beauvoir - um nur diese zu nennen. Sie nutzt ihre literarische Prominenz für gesellschaftlichen Einfluss, was, wie beispielsweise auch bei Allende, die übliche Reihenfolge ist. Doch kann auch eine spezifische politische Erfahrung, wie bei Herta Müller und Anna Seghers, jene Unruhe erzeugen, die beim literarischen Schreiben den Basso continuo anschlägt. In unseren Porträts ist das Wechselspiel von Zeitgenossenschaft, von familiärer Erfahrung, von Rasse und Klasse, von muttersprachlicher Prägung und, natürlich, dem weiblichen Geschlecht unterschiedlich bedeutsam. Irène Némirovsky, Mascha Kaleko und Christa Wolf sind, wie andere in diesem Buch, in ihrem Werk eher gegen ihren Willen von dem geprägt, was die Zeitgeschichte ihnen diktierte. Für viele Lebensläufe gilt das trotzige und nur deshalb nicht vollkommen trostlose Diktum Marina Zwetajewas: »Das Allerwertvollste in den Gedichten wie im Leben ist das, was misslang.«
Die Bedingungen für das Schreiben sind so spezifisch und unterschiedlich wie die Umstände, die zum Erfolg führen. Emily Brontë blieb lebenslang in ihrem Elternhaus, während ihre Schwestern Charlotte und Agnes als Gouvernante und Lehrerin immerhin Erfahrungen jenseits eines armen englischen Pfarrhaushalts machten. Und während diese beiden davon in ihren Romanen berichteten, die literarisch recht ähnlich sind, schuf jene mit »Sturmhöhe« ein radikales Werk, das beispiellos und einsam in der literarischen Landschaft steht. Charlotte war überaus erfolgreich, Agnes komplett erfolglos, Emily ebenso. An den Namen kann es nicht gelegen haben, denn sie schrieben allesamt unter männlichem Pseudonym, und der durchaus clevere Verleger gab sie sogar als Brüder aus.
Aurore Dupin, bekannt als George Sand, profitierte wie Mary Ann Evans, bekannt als George Eliot, von historischen Umständen, die ein bisschen komfortabler und freier waren als die der Schwestern Brontë. Doch während die französische Adelstochter Sand, Freigeist und Abenteurerin wie Eliot, aus dem Vollen des Lebens schöpfte und schrieb, lag der Segen für ihre bürgerliche britische Kollegin in der Beschränkung. Die eine hatte geerbtes Geld, Verbindungen und jene Sorglosigkeit, die daraus erwachsen kann; sie schrieb mit Leidenschaft und Lässigkeit zugleich und konnte sich Kinder sowie Geliebte leisten. Die andere, vom Vater aufs schmale Pflichtteil gesetzt, war ein fleißiges Genie, das seinen kinderlosen Haushalt der Produktion unterzuordnen wusste, und zudem mit einem Mann gesegnet, der sie inspirierte und stärkte: ein weibliches Ausnahme-Leben. Selbstbewusst waren beide, aber was heißt das schon? Selbstbewusst war Zwetajewa auch. »Das Schicksal meiner Bücher: jeder will sie 1. einfacher, 2. lustiger, 3. schöner.« Die Überzeugung, ein literarisches Genie zu sein, konnte nichts ausrichten gegen die Wucht eines Schicksals, das Bürgerkrieg und Emigration, Armut und Diktatur in dieses kurze Leben drängte. Wann soll ich schreiben, klagte sie, wenn Kinder und Mann an mir zerren, das Geld vorn und hinten nicht reicht und niemand liest, was ich des Nachts und in den frühen Morgenstunden zu Papier bringen kann? »Die Epoche ist gegen mich... nicht so gegen mich, wie ich gegen sie. Ich hasse sie, sie bemerkt mich nicht...«
Das Selbstbewusstsein, so viel ist klar, reicht alleine nicht hin, doch wenn die Umstände günstig sind, pflügt es den Lebenslauf in geradezu männlicher Weise um: Gertrude Stein, Marguerite Yourcenar, Patricia Highsmith sind Autorinnen, die mit Frauen so lebten, wie ihre erfolgreichen Kollegen immer schon: hier Geld und Glanz und Ruhm, dort Fürsorge und narzisstische Bescheidenheit. Das sind, um eine kleine Statistik aufzumachen, drei von 99. Nimmt man stabile Partnerschaften als gute Basis an, um sich der Arbeit widmen zu können, sind es schon mehr, kaum zwanzig, was wiederum bedeutet: Es handelt sich um ein Ausnahmeschicksal, das im Übrigen seine relative Verbreitung dem zwanzigsten Jahrhundert verdankt. Mit einem erwachsenen Gegenüber, das Beruf und Berufung erträgt oder sogar unterstützt, mit statistisch normalen Lebensläufen steigt die Produktivität. Zeruya Shalev, Doris Lessing und Joanne K. Rowling sind Beispiele für moderne Biografien, in denen Scheidung wie Kinder sich nicht verheerend auswirken, während für Mary Shelley Geburten und Totgeburten ein erstickendes Unglück waren. Und sicher ist der Wohlstand, der eben auch Zeit und Gesundheit bedeutet, ein Grund dafür, dass das Leben mit Kindern, die Geburt als elementare Erfahrung und die Reflexion auf die Mutterschaft erst in den letzten Jahrzehnten einen größeren literarischen Raum einnimmt. Fanny Reventlow, Magda Szabó, Sylvia Plath - um nur drei zu nennen - konnten ihre Kinder mit jener Aufmerksamkeit betrachten, die nicht nur von Überlebenssorge getrieben war; mit jener Zuversicht, mit der man auf etwas sieht, das bleibt.
Statistik führt nicht weit, wenn man hier Schlüsse ziehen will. Dazu ist kein Leben einfach genug. Immerhin: von unseren 99 waren rund vierzig von Schwermut befallen, die sich, je nachdem, in sogenannter Geistesstörung äußerte oder in einfacher Melancholie, in Trunksucht mit Todesfolge oder Suizid. Zwetajewa hängte sich auf, Woolf ging in die Ouse, Plath steckte den Kopf in den Gasofen, Zürn sprang aus dem Fenster, Kane erhängte sich an ihren Schnürsenkeln in einer psychiatrischen Klinik. Immer einzelne Gründe, und immer auch »Schicksalsprügel; wovon die Flecke nicht vergehen«, wie Levin Varnhagen schreibt. Empfindsamkeit, das Produktionsmittel, das sich nicht beherrschen lässt - mit suizidalen Folgen vermehrt seit etwa einem Menschenalter.
Es gibt aber eine große Bewegung; die zeigt sich seit dem neunzehnten Jahrhundert: ein Mehr an Produktivität und mehr Autorinnen, die von ihrem Schreiben leben wollen und können. Diese Bewegung geht mit der Wohlstandsentwicklung einher, mit einem Zugewinn an Gesundheit, mit Geburtenkontrolle und Emanzipation. Davor entschieden Bedingungen im Kleinsten, Ausnahmen von Ort, Zeit und Gesundheit: Die Klosterfrau von Bingen in ihrem geschützten Lebensraum, mit einer Infrastruktur samt Sekretariat und Lektorat fürs Latein. Die kinderlose Jane Austen, die materiell sorgenfrei gestalten konnte, was sie hörte und sah. Die Witwe Madame de Sévigné, wohlhabend wie die getrennt lebenden Madame de La Fayette und Madame de Staël; die einsame, aber gutsituierte Annette von Droste-Hülshoff. Sie alle hatten Bildung und das »Zimmer für sich allein«, von dem Woolf in ihrem berühmten Essay schrieb: Zufälle, Sonderfälle, Glücksfälle. Inzwischen so etwas wie Standard, wenn auch nicht überall. Zhang Jie schrieb die sechshundert Seiten des Epos »Schwere Flügel«, erschienen 1981, mit Hilfe eines Brettes als Tisch auf der Toilette. Und wer weiß, wo gerade in Simbabwe, in Nordkorea, im Iran geschrieben wird, was wir in zehn und zwanzig Jahren lesen werden.
Dieses Buch ist als Coda und Auftakt gedacht. Es zieht eine mögliche Bilanz. Es zeigt Vereinzelung und Traditionen, die Entwicklung von Genres, ein Geflecht von Bedingungen und Ausnahmen, das schon historisch geworden ist. Für fast alle Autorinnen gilt noch, was Mascha Kaléko, deutsche Jüdin im Exil, für ihr Leben in zwei Gedichtzeilen brachte: »Auf nichts war Verlass. Nur auf Wunder.« Das hat sich, in unserer Sphäre, geändert. Das Erscheinen des Wunders kann sich einstweilen auf die Kunst beschränken, wo es gut aufgehoben ist.
Wenn es aber so kommt, wie wir es wünschen, setzt sich das Buch als Projekt fort: indem es in anderen Ländern erscheint, wo hinzugefügt wird, was dort von Bedeutung ist und was wir noch nicht kennen. Auf dass der Wunder mehr werden.
Elke Schmitter
VERENA AUFFERMANN, geboren 1944 in Höxter, studierte nach einer Buchhandelslehre und einem Volontariat Kunstgeschichte in Frankfurt am Main. Sie ist als freischaffende Publizistin, Jurorin, Dozentin und Kritikerin tätig mit den Schwerpunkten Literatur und Kunst unter anderem für die »Frankfurter Rundschau«, den Deutschlandfunk, die »ZEIT«, »Literaturen« und die »Süddeutsche Zeitung«. Als Autorin veröffentlichte sie unter anderem den Essayband »Das geöffnete Kleid. Von Giorgione zu Tiepolo« (1999) und, zusammen mit Iso Camartin, die Briefromanze »Nelke und Caruso« (1997). Verena Auffermann lebt in Berlin.
Verena Auffermann schrieb über: Ilse Aichinger, Margaret Atwood, Djuna Barnes, Karen Blixen, Leonora Carrington, Inger Christensen, Paula Fox, Elfriede Jelinek, Lidia Jorge, Sarah Kane, Marie Luise Kaschnitz, Sarah Kirsch, Hanna Krall, Agota Kristof, Else Lasker-Schüler, Katherine Mansfield, Friederike Mayröcker, Carson McCullers, Margriet de Moor, Herta Müller, Alice Munro, Joyce Carol Oates, Silvina Ocampo, Dorothy Parker, Jean Rhys, Françoise Sagan und Gertrude Stein.
GUNHILD KÜBLER, geboren 1944 in Karlsruhe, studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg, Berlin und Zürich. Sie war Literaturkritikerin bei der »Neuen Zürcher Zeitung«, Redakteurin der »Weltwoche« und schreibt heute für die »Neue Zürcher Zeitung am Sonntag«. Von 1990 bis 2006 war sie Mitglied im Kritikerteam der Sendung »Literaturclub« des Schweizer Fernsehens. Für ihre Übertragung der Gedichte von Emily Dickinson wurde sie 2008 mit dem Paul Scheerbart-Preis ausgezeichnet. Ihre gesammelten Kolumnen für die »NZZ am Sonntag« erschienen 2008 in Buchform unter dem Titel »Noch Wünsche?«. Gunhild Kübler lebt in Zürich.
Gunhild Kübler schrieb über: Ingeborg Bachmann, Christine de Pizan, Emily Dickinson, Annette von Droste-Hülshoff, Hildegard von Bingen, Juana Inés de la Cruz, Brigitte Kronauer, Madame de La Fayette, Astrid Lindgren, Clarice Lispector, Irmtraud Morgner, Toni Morrison, Murasaki Shikibu, Erica Pedretti, George Sand, Sei Shonagon, Madame de Sévigné, Johanna Spyri, Madame de Staël, Harriet Beecher Stowe, Wisława Szymborska und Zhang Jie.
URSULA MÄRZ wurde 1957 in Mittelfranken geboren. Sie absolvierte ein Volontariat bei der »Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen« in Kassel und studierte nach Auslandsaufenthalten Philosophie und Literaturwissenschaft in Köln und Berlin. Zunächst war sie als Autorin für den Rundfunk tätig, verfasste Feature und Hörspiele. Seit Mitte der achtziger Jahre arbeitet sie hauptsächlich als Kritikerin und Feuilletonistin für das »Kursbuch«, die »Frankfurter Rundschau« und die »ZEIT«. Im Jahr 1999 veröffentlichte sie den biografischen Essay »Du lebst wie im Hotel« über die Fotografin Ré Soupault. 1990 wurde sie beim Klagenfurter Publizistik-Wettbewerb mit dem Preis für Essayistik, 2005 mit dem Berliner Preis für Literaturkritik ausgezeichnet. Seit mehreren Jahren verfaßt sie auch Zeitungskolumnen, unter anderem die »ZEIT«-Kolumne »Vom Stapel«, die sich populärer Literatur widmet. Ursula März lebt in Berlin.
Ursula März schrieb über: Simone de Beauvoir, Eileen Chang, Colette, Hedwig Courths-Mahler, Assia Djebar, Marguerite Duras, Marieluise Fleißer, Natalia Ginzburg, Nadine Gordimer, Patricia Highsmith, A. L. Kennedy, Elsa Morante, Anaïs Nin, Emine Sevgi Özdamar, Yasmina Reza, Joanne K. Rowling, Arundhati Roy, Nelly Sachs, Sappho, Nathalie Sarraute, Zeruya Shalev, Susan Sontag, Christa Wolf und Marguerite Yourcenar.
ELKE SCHMITTER wurde 1961 in Krefeld geboren. Sie studierte Philosophie an der Universität München. 1989 wurde sie Kulturredakteurin der »tageszeitung« in Berlin, wo sie von 1992 bis 1994 als Chefredakteurin tätig war. Anschließend schrieb sie als freie Autorin vor allem für die »Süddeutsche Zeitung« und die »ZEIT«. Seit 2001 gehört sie der Kulturredaktion des »Spiegel« an. 1989 veröffentlichte sie einen Essayband über Heinrich Heine. 2000 erschien ihr erster Roman »Frau Sartoris«, er wurde in neunzehn Sprachen übersetzt. Ihm folgten die Romane »Leichte Verfehlungen« (2002) und »Veras Tochter« (2006). Außerdem hat sie zwei Lyrikbände veröffentlicht: »Windschatten im Konjunktiv« (1981) und »Kein Spaniel« (2005). Elke Schmitter lebt in Berlin.
Elke Schmitter schrieb über: Anna Achmatowa, Isabel Allende, Bettine von Arnim, Jane Austen, Jane Bowles, Anne, Emily und Charlotte Brontë, Willa Cather, Paulina Chiziane, Agatha Christie, George Eliot, Ricarda Huch, Mascha Kaleko, Doris Lessing, Rahel Levin Varnhagen, Margaret Mitchell, Irene Nemirovsky, Sylvia Plath, Katherine Anne Porter, Fanny Gräfin zu Reventlow, Anna Seghers, Mary Shelley, Magda Szabó, Ljudmila Ulitzkaja, Virginia Woolf, Unica Zürn und Marina Zwetajewa.
Bildredaktion: Dietlinde Orendi und Annette Mayer
Agentur Focus, Hamburg: Bild 1(Abe Frajndlich; Leonora Carrington © VG Bild-Kunst, Bonn 2009); Akg-Images, Berlin: Bild 2, Bild 3, Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8, Bild 9, Bild 10, Bild 11, Bild 12, Bild 13, Bild 14, Bild 15 (N.N.), Bild 16 (British Library), Bild 17 (Janos Kalmar), Bild 18, Bild 19, Bild 20 (Erich Lessing), Bild 21, Bild 22, Bild 23 (Bruni Meya), Bild 24 (Album), Bild 25 (Marion Kalter), Bild 26 (Bildarchiv Pisarek), Bild 27 (Doris Poklekowski); Barra Lori, Sausalito: Bild 28 (Lori Barra © 2008); Deutsches Literaturarchiv, Marbach: Bild 29, 629; Fotostiftung Schweiz, Winterthur: Bild 30 (© Paul Bowles Estate); Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro: Bild 31; Getty images, München: Bild 32 (Ulf Andersen), Bild 33 (Hulton Archive/Pictorial Parade); Interfoto, München: Bild 34, Bild 35, Bild 36, Bild 37, Bild 38, Bild 39, Bild 40 (Archiv Friedrich), Bild 41, Bild 42, Bild 43, Bild 44 (Brigitte Friedrich), Bild 45, Bild 46, Bild 47, Bild 48 (Sammlung Rauch), Bild 49, Bild 50 (Felicitas), Bild 51 (Blackpool), Bild 52 (Mary Evans Picture Library), Bild 53 (Karger-Decker), Bild 54 (Georgy), Bild 55, Bild 56 (Alinari), Bild 57, Bild 58, Bild 59 (Anita Schiffer-Fuchs), Bild 60, Bild 61 (IFPAD), Bild 62 (Gert Eggenberger), Bild 63 (Wolfgang Maria Weber), Bild 64 (Baptiste); Laif, Köln: Bild 65 (Hollandse Hoogte/Okhuizen); Ohlbaum Isolde, München: Bild 66; Picture-Alliance, Frankfurt: Bild 67 (dpa/Scanpix); Shapton Derek, Toronto: Bild 68; The Bridgeman Art Library, Berlin: Bild 69 (Roger-Viollet/Private Collection); Ullstein Bild, Berlin: Bild 70 (Lambert), Bild 71 (adoc-photos), Bild 72, Bild 73, Bild 74, Bild 75 (Granger Collection), Bild 76 (sinopictures/Fotoe), Bild 77 (Gezett), Bild 78,Bild 79 (AP), Bild 80, Bild 81 (B. Friedrich), Bild 82 (Lieberenz), Bild 83 (Reinke), Bild 84 (dpa), Bild 85 (UlfAndersen/SIPA), Bild 86 (iT), Bild 87 (Kujath), Bild 88 (Roger Viollet), Bild 89, Bild 90 (Lebrecht Music & Arts Photo Library), Bild 91 (N.N.), Bild 92 (Kruse); Unionsverlag, Zürich: Bild 93; Verlag Brinkmann & Bose, Berlin: Bild 94 (Foto Johann Lederer, Courtesy Ubu Gallery New York & Galerie Berinson, Berlin); Wikimedia Foundation Inc.: Bild 95, Bild 96, Bild 97, Bild 98
Der Rechteinhaber dieses Fotos konnte trotz intensiver Recherche bis Redaktionsschluss leider nicht ermittelt werden. Der Verlag bittet den Rechteinhaber sich zwecks angemessener Vergütungzu melden.

Bild 34
Ihr Stern ist klein. Er ist selten zu sehen und schimmert nur schwach. Aber er wird nicht sinken. Seine Form ist beinahe ein Kreis, sein Durchmesser beträgt neun Kilometer, seine Entfernung von der Erde mindestens 141 Millionen Kilometer. Der Planet Nr. 3067 wurde im Jahr 1982 in das Verzeichnis der »Minor Planet Circulars« aufgenommen, »named in honor of Anna Andreevna Akhmatova. Outstanding Poetress.«
Zwei Leserinnen sorgten dafür. Ljudmila Karatschkina und Ljudmila Schurawljowa nutzten ihre Tätigkeit am Astrophysischen Institut auf der Krim in den achtziger Jahren zu einer so diskreten wie nachhaltigen Korrektur der sowjetischen Kulturgeschichte: Im selben Jahr wie Achmatowa erhielten der Regisseur Andrei Tarkowski sowie die Schriftsteller Michail Bulgakow und MARINA ZWETAJEWA einen Himmelskörper auf ihren Namen - Tote und Totgeschwiegene.
Anna Achmatowa hat das nicht mehr erlebt, doch es ist anzunehmen, dass es ihr gefallen hätte. Nicht nur wegen der Unsterblichkeit - die sie verdient zu haben sicher war. Nicht nur, weil die Literaturzeitschrift ihrer Lebensstadt Petersburg den Titel »Swesda« (Stern) trug. Sondern auch, weil in ihren Gedichten der Himmel, die Wolken und die Gestirne das sprechende Ich treulich begleiten: als Resonanzräume einer Seele, der die Welt nicht groß genug sein kann.
Mit Liebesgedichten fing sie an. Die großgewachsene, überwältigend schöne Anna Andrejewna Gorenko war von Anfang an überzeugt, dass die Stimmungen eines einzelnen, eines einzigen Menschen, formuliert man sie nur gut genug, von mitteilenswerter Bedeutung sind. Die Schwüle eines Abends im Sommer, der silbern glitzernde Teich, die vertrockneten Immortellen - sind das nicht sprechende Zeichen für ein denkendes Herz? Der Mensch und das Universum, das Ich und sein Wetter, das war von Anfang an ihr Programm. Wörtlich und konkret: Die Metaphern der Symbolisten, die den Ton angaben, als sie die literarische Bühne betrat, verachtete sie. Kein Antlitz wie eine Blume, kein Vögelzwitschern, wenn man Liebesgeflüster meint - sondern das Antlitz, genau wie es war, »schmerzlich« und »böse« vielleicht, und die Worte grob oder zärtlich, so wie sie waren. »Gedichte müssen schamlos sein«, nur dann kann entstehen, worum es geht: Die Geheimnisse der Psyche werden offenbar, und das Einzelne wird allgemein, das Unbegriffene verständlich, die tiefste Einsamkeit mitteilbar.
Die Hörer und Leser dankten ihr die Radikalität. Von ihren ersten Auftritten an war die junge Dichterin, die sich den klangvollen Namen Achmatowa gab (der nicht genuin russisch ist, sondern an eine tatarische Ahnin erinnert), ein populäres Phänomen. Ihre Gedichte - kurz oder lang, aber streng im Versmaß gehalten und gereimt - konnten ihre Leser auswendig. Sie waren, am Beginn ihrer Laufbahn, modern. Am Ende waren sie Klassiker. Literarische Programme, Parteitagsbeschlüsse und Kulturrevolutionen zogen daran vorbei. Zweimal wurde vernichtet, was es gedruckt von ihr gab - auf staatlichen Befehl. Über Jahrzehnte hatte sie Berufsverbot. Sie schrieb kaum etwas auf, sondern trug ihre Gedichte den engsten Freunden vor, damit sie die Verse im Gedächtnis behielten. Manuskripte zu verstecken, in einem spärlich möblierten Zimmer, wäre zu gefährlich gewesen. So wanderte, was sie schrieb, unmateriell ins Bewusstsein. Das passte zu ihrem Werk. Das Politische wurde sphärisch, und die stupid-brachiale Kulturpolitik der Sowjetunion gekontert mit dem letzten Unerreichbaren : dem menschlichen Gedächtnis.
Sie selbst war, am Ende des Lebens, verkörperte Erinnerung. »Ich aber wuchs in buntbestickter Stille / Im kühlen Kinderzimmer des Jahrhunderts.« Im Kinderzimmer des Jahrhunderts, das heißt: in der Vorzeit der Russischen Revolution, in einer Epoche, die kulturell vollständig vernichtet wurde. Eine melancholische, von Ehestreitigkeiten und Todesfällen in der Familie belastete Kindheit - zwei Schwestern starben früh an Tuberkulose - im russischen Bürgertum : hohe Spiegel in Rahmen aus Nussholz im gelben Licht der Öllampen, gepolsterte Sessel, enge Mieder und raschelnde Röcke. Ein einziges Buch im Haus: die Hinterlassenschaft des ersten Manns ihrer Mutter, der in das Attentat auf den Zaren Alexander II. im Jahr 1881 verwickelt war und sich erschossen hatte, um der Verhaftung zu entgehen. Hinter den Kulissen rumorte es in Russland längst.
Ein paar Jahre lang gab es für Achmatowa das, was man eine emanzipierte Künstlerjugend nach europäischem Vorbild nennen kann. Sie begann ein Jurastudium in Petersburg, sie schrieb, sie verliebte sich und heiratete. Als Jungvermählte ging sie mit ihrem Mann nach Paris, eine entschlossene Bohemienne und bald schon eine unglückliche Ehefrau. Ihr erster Mann - Dichter und Exzentriker wie sie, aber auch Reisender aus Passion - zog weiter nach Afrika und ließ sie zurück. Achmatowa blieb zunächst in Paris, freundete sich mit dem italienischen Maler Amedeo Modigliani an (ein von Modigliani gemaltes Porträt von ihr hing zeitlebens über ihrem Bett) und bereiste, wieder mit ihrem Mann, den Norden Italiens. Zurück in Russland, gab es für sie noch ein Jahr der reinen Künstlerexistenz: Lesungen und Partys, programmatische Zusammenkünfte ihrer literarischen Gruppe, der Akmeisten, Freundschaften mit Boris Pasternak und Ossip Mandelstam, mit der Tänzerin Olga Glebowa-Sudejkina. Als Anna Achmatowa ihren zweiten Gedichtband publizierte, brach der Erste Weltkrieg aus, an dessen Ende stand in Russland die Revolution. Von nun an war ihr Leben nicht nur überschattet, sondern geprägt von der trostlosen Geschichte ihrer Heimat. Von den siebenhundert Autoren, die 1934 am Ersten Schriftstellerkongress der Sowjetunion in Moskau teilgenommen hatten, überlebten nur fünfzig bis zum Zweiten Kongress im Jahr 1954. Von denen, die nicht im Krieg gefallen waren, wurden Unzählige liquidiert, verschwanden in Arbeitslagern oder starben an staatlich organisierter Verelendung. »Ihr aber, Freunde, letztes Aufgebot! / Mir blieb das Leben, damit ich Euch bewein.«
Achmatowas erster Mann meldete sich 1914 freiwillig an die Front; sie blieb mit dem einzigen Kind zunächst bei den Schwiegereltern auf deren ländlichen Gut. Dann ging sie zurück nach Petersburg und zog in das Palais des Grafen Scheremetjew, das in kleine Wohnungen aufgeteilt worden war - ihre Heimat mit wechselnder Besetzung bis in die fünfziger Jahre. Die zweite und dritte Ehe fand hier statt, in der typischen sowjetischen Enge: Phasenweise lebte sie mit der ersten und der aktuellen Gattin ihres geschiedenen dritten Mannes zusammen, nie hatte sie mehr als »ein Zimmer für sich allein« (VIRGINIA WOOLF), und manchmal nicht einmal das.
Ihre Ehen waren nicht glücklich, das Verhältnis zum Sohn belastet von Angst: Dessen Vater war 1921 als »Verräter« erschossen worden, Lew selbst verbrachte über fünfzehn Jahre im Gefängnis, in Arbeitslagern und Verbannung. Um ihn zu retten, schrieb sie patriotische Hymnen und Bittgesuche an Stalin. Unmittelbar half das nicht, aber immerhin wurde sie vorübergehend wieder in den Schriftstellerverband aufgenommen, was hieß: garantierter Wohnraum, Anspruch auf ein Minimum an Lebensmitteln und medizinischer Versorgung.
Die Umschwünge der Kulturpolitik ertrug sie mit äußerer Gelassenheit, doch niemals war sie ohne Grund zur Furcht. Als »halb Nonne, halb Hure« wurde sie öffentlich verfemt, da die Boheme zum Klassenfeind geworden war: ihre rein subjektive Lyrik, in der jede, auch die politische Erfahrung, zur Wahrnehmung verschmolz (»Und in der toten Stadt mit ihrem gnadenlosen Himmel / Schweif ich umher nach Brot und Obdach«), ihre Anrufung Gottes und der vorrevolutionären Vergangenheit waren dem Regime immer suspekt. Doch gerade weil sie nur ihrer Wahrnehmung vertraute, fand sie Worte für die leidvollen Erfahrungen des Krieges, die sie zur inoffiziellen Nationaldichterin machten : »Und wieder gehen in Reih und Glied die Leningrader, / Lebende, Tote im Rauch: Der Ruhm kennt keine Toten.« Ihre Verse waren aus dem kollektiven Gedächtnis nicht zu tilgen.
Lebenslang materiell bedürfnislos, brachte sie sich über Jahrzehnte mit Übersetzungen durch. In der Sowjetunion erhielt sie niemals eine offizielle Ehrung; in der »Tauwetterperiode« unter Chruschtschow, Mitte der fünfziger Jahre, wurde ihre Existenz allerdings leichter, nach 1957 durfte sie Einzelnes wieder publizieren. Sie lebte abwechselnd in ihrem kleinen Sommerhaus bei Petersburg und bei Freunden in Moskau, immer umgeben von Vertrauten und ihrem Sekretär, und empfing Bewunderer aus der ganzen Welt. Neben Alexander Solschenizyn ist sie die wichtigste literarische Zeugin des Stalinismus - Zeugin der Vernichtung einer literarischen Hochkultur, wie sie ihre Freunde Pasternak, Mandelstam und Marina Zwetajewa repräsentierten, aber auch der Qualen des russischen Volkes, als deren Stimme sie sich empfand. Wie hunderttausende andere hatte sie jahrlang nicht gewusst, ob die ihr Liebsten noch lebten, ob sie in der Verbannung waren, ob man ihnen etwas zukommen lassen durfte. »In den furchtbaren Zeiten der Herrschaft Jeschows brachte ich siebzehn Monate in den Warteschlangen vor den Gefängnissen Leningrads zu. Irgendwann irgendwie erkannte mich jemand wieder. Eine hinter mir stehende Frau mit blaugefrorenen Lippen, die natürlich noch nie meinen Namen gehört hatte, erwachte aus der uns allen eigenen Erstarrung und Vereinzelung und fragte dicht an meinem Ohr (alle sprachen dort nur im Flüsterton): Und können Sie das hier beschreiben? Da sagte ich: Ich kann. Da ging so etwas wie ein Lächeln über das, was einstmals ihr Gesicht gewesen war.«
Biografisches
Anna Andrejewna Gorenko wurde am 23. Juni (nach dem russischen Kalender: 11. Juni) 1889 in Bolschoi Fontan bei Odessa als viertes Kind des Marineoffiziers Andrei Gorenko und seiner Ehefrau Inna Erasmowna geboren. Die Ehe der Eltern wurde 1905 geschieden; mehrere Geschwister Annas starben früh an Tuberkulose. Ab 1907 studierte sie Jura an der Universität Kiew und veröffentlichte Gedichte in Literaturzeitschriften. 1910 heiratete sie den Studenten, Reisenden und Dichter Nikolai Stepanowitsch Gumiljow. Sie ging mit ihm nach Paris, wo sie Amedeo Modigliani begegnete. 1911 gründete sich in St. Petersburg, dem von nun an dauerhaften Wohnsitz Achmatowas, die Gruppe der Akmeisten, zu der neben ihr und Gumiljow auch Ossip Mandelstam, Michail Kusmin und andere Dichter gehörten. Anna Achmatowa, die seit etwa einem Jahr unter ihrem selbsterdachten Pseudonym veröffentlichte, wurde bald die bekannteste Vertreterin dieser Gruppe. Ein Jahr später, kurz nach der Geburt des Sohnes Lew, trennten sich Achmatowa und Gumiljow.
Zwei weitere Ehen folgten: 1918 heiratete sie den Assyrologen Wladimir Schileiko, 1922 den Kunstwissenschaftler Nikolai Punin. Im selben Jahr erschien ihr fünfter und letzter Gedichtband vor dem Berufsverbot. 1935 erfolgte die erste Verhaftung des Sohnes Lew. Nachdem sich dieser durch den Frontdienst im Zweiten Weltkrieg vorübergehend rehabilitieren konnte. wurde er 1949 erneut verhaftet und zu zehn Jahren Lagerhaft in Sibirien verurteilt. 1956 wurde er aus der Haft entlassen. Ab 1940 vollzog sich die zeitweilige Rückkehr Anna Achmatowas ins literarische Leben der UdSSR. Im Jahr 1950 verfasste sie ihre Stalingedichte, 1951 erfolgte die Wiederaufnahme in den Sowjetischen Schriftstellerverband. 1962 widmete Alexander Solschenizyn ihr die Erzählung »Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch«; im selben Jahr erschien ihr »Poem ohne Held«. 1964 nahm sie in Sizilien den Ätna-Taorima-Literaturpreis entgegen, ein Jahr später in Oxford die Ehrendoktorwürde. Am 5. März 1966 starb Anna Achmatowa an den Folgen ihres vierten Herzinfarktes in einem Sanatorium in Domodedowo bei Moskau.
Leseempfehlung
»Vor den Fenstern Frost« (Gedichte und Prosa). Aus dem Russischen von Barbara Honigmann und Fritz Mierau.
»Gedichte. Russisch—Deutsch«. Herausgegeben von Ilma Rakusa. Aus dem
Russischen von Heinz Czechowski.
»Liebesgedichte«. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg.
»Ein niedagewesener Herbst« (Gedichte). Aus dem Russischen von Sarah und Rainer Kirsch.
»Briefe, Aufsätze, Fotos«. Herausgegeben von Siegfried Heinrichs. Aus dem Russischen von Irmgard Wille u. a.
Elke Schmitter