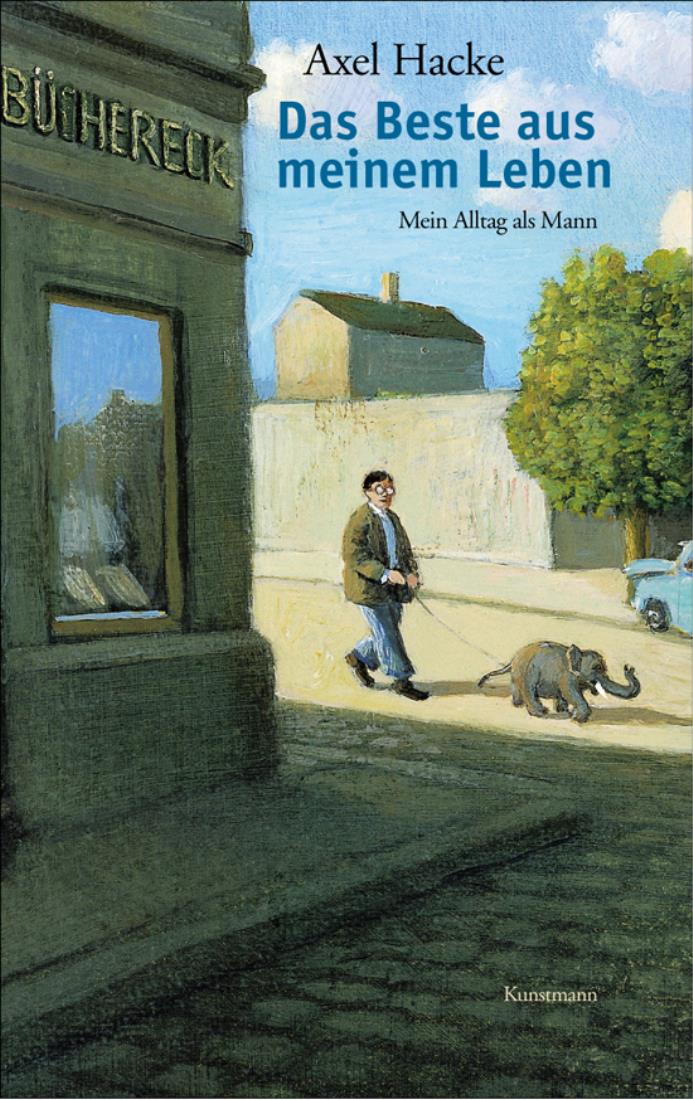
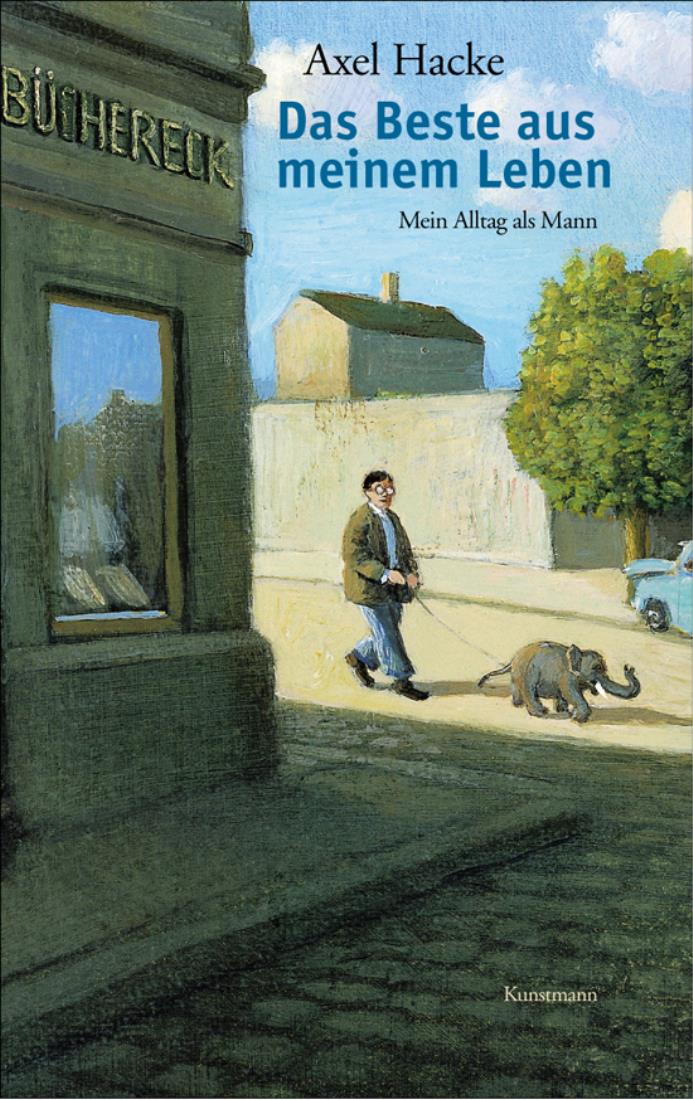
Das Beste aus meinem Leben
Mein Alltag als Mann
Verlag Antje Kunstmann
Für Ursula und David
Manchmal wache ich nachts auf, der Rücken tut mir weh, ich bin steif wie ein Brett und schweißgebadet und denke, ich schaffe es alles nicht, die viele Arbeit und die Familie und die ganze Verantwortung und das Geldverdienen – ich schaffe es nicht.
Warum kann ich nicht einen Schreibwarenladen haben, denke ich dann, einen kleinen Schreibwarenladen, in den die Leute hereinkommen und aus dem sie wieder herausgehen? Dazwischen kaufen sie etwas und lassen dafür ein bisschen Geld da, und ansonsten herrscht Ruhe. Oder warum besitze ich nicht eine Heißmangel, wo es den ganzen Tag nach frischer Wäsche riecht, und abends um halb acht sperrt man zu und geht nach Hause, und Schluss und Tagesschau?
Das sei ja wohl nicht mein Ernst, sagt Paola dann zu mir: Was wüsste ich denn von den Problemen der Schreibwarenverkäufer und Heißmangelbesitzer!? Ich solle nicht immer nach Sicherheit und Ruhe suchen im Leben, sagt sie, ich solle es endlich einmal als Herausforderung sehen. »Das Leben«, rief sie einmal nachts, »ist ein Abenteuer.« Dann nahm sie mich in den Arm und tröstete mich und sagte, ich würde es schon schaffen, alles.
Manchmal wache ich auf, weil mein Sohn schreit, Luis. Er ist gerade zwei Jahre alt, und dann und wann wird er wach und ist ganz verschwitzt und schreit einfach so, und dann und wann schreit er auch nicht einfach so, sondern er schreit: »Bügäln!«
Es hört sich vielleicht komisch an, aber Bügeln ist seine Lieblingsbeschäftigung, jedenfalls das, was er für Bügeln hält. Man holt das Bügeleisen aus dem Flurschrank und das Bügelbrett dazu, und dann bügelt er mit dem kalten Eisen ein Stück Stoff, immer das gleiche Stück Stoff, täglich ungefähr hundertmal.
Neulich ist er mitten in der Nacht aufgewacht und hat »Bügäln!« gebrüllt, und Paola ist zu ihm gegangen, um ihn wieder in den Schlaf zu singen, aber er wollte nicht in den Schlaf gesungen werden. Er wollte bügeln und brüllte »Bügäln!«. Paola sagte, er könne jetzt nicht bügeln, es sei drei Uhr in der Früh, alle Menschen schliefen. Aber er schrie »Bügäln! Bügäln! Bügäln!«, stand in seinem Kinderschlafsack in seinem Bett, rüttelte an den Gitterstäben, weinte – ein kleiner, verzweifelter Mann, der bügeln musste und nicht konnte. Sein Kopf wurde rot, der ganze Mensch wurde Kopf, ein großer, runder, roter, geschwollener Kopf auf einem Schlafsack, ein Kopf, in dem ein einziger entzündeter Gedanke schmerzte, und dieser Gedanke war:
»Bügäln!«
Es half nichts. Paola nahm ihn aus dem Bett, holte das Bügelbrett aus dem Flurschrank und das Eisen dazu, und der Kleine bügelte voller Eifer auf dem üblichen Stückchen Stoff herum.
Wissen Sie, manchmal stelle ich mir vor, dass auch der Bundeskanzler Kohl nachts hochschreckt und verzweifelt in seinem Bett liegt und schwitzt. Oder dass er auf der Matratze steht und »Regierän!« brüllt. Seine Frau sagt dann zu ihm, er könne jetzt nicht regieren, es sei tief in der Nacht. Aber er brüllt weiter: »Regierän!« Dann resigniert sie, geht mit ihm ins Kanzleramt, er setzt sich ein bisschen an den Schreibtisch und regiert eine Viertelstunde. Darauf bringt ihn seine Frau ins Bett, er sinkt wieder in die Kissen und schläft entspannt ein. Oder ich bilde mir ein, Schummel-Schumi-mit-dem-großen-Kinn rufe im Schlaf »Rennenfah’n!«, gehe in die Garage, setze sich in sein Auto und spiele eine Viertelstunde lang Formel 1, bis ihn seine Frau wieder ins Bett bringt.
Na ja, so ist es wohl mal wieder nicht, aber die beiden wären mir sympathischer, wenn es so wäre.
Was nun den kleinen Luis angeht, so standen Paola und ich eine Viertelstunde lang um ihn herum, während er bügelte, gähnten und dachten, wie merkwürdig doch das Leben sein kann, so merkwürdig, dass es Menschen gibt, die nachts um halb vier um ein bügelndes Kleinkind herumstehen und sagen:
»Fein machst du das! Schön bügelst du!«
Nach einer Viertelstunde hatte er genug. Paola nahm ihn auf den Arm, wir brachten ihn ins Bett, und ich dachte noch, vielleicht macht er ja mal eine Heißmangel auf, er hätte es im Blut. Möglicherweise, dachte ich noch, wird er ja auch Bundeskanzler oder Rennfahrer oder Journalist oder irgendetwas, das ich mir gar nicht vorstellen kann.
Ich flüsterte ihm ins Ohr:
»Du schaffst das schon, alles. Das Leben ist ein Abenteuer!«
Paola sah mich kurz an, gab ihm einen Kuss, sah mich wieder an und fragte müde:
»Was hast du gerade gesagt?«
Wissen Sie, wer mir vollkommen wurscht ist? Alain Delon ist mir vollkommen wurscht.
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie egal mir Alain Delon ist.
Alain wer? ist? das? überhaupt?
Die neue zweite Kraft bei »Serge, le Coiffeur« in der Sendlinger Straße? Der Favorit im dritten Daglfinger Rennen? Ein Deodorant-Stift von Gillette?
Kann mich nicht erinnern.
Einmal kam ein junger Bursche in die Bar des italienischen Dorfs, das wir in den Ferien immer besuchen. Er war anscheinend nicht aus der Gegend und fragte die verrückte Alte, die oft im geblümten Kittel am einzigen Tisch sitzt, ob er sich setzen dürfe, und sie sagte:
»Wenn du Alain Delon wärst…«
»Was wäre dann?«
»Wenn du Alain Delon wärst, dann würde ich mir das Gebiss rausnehmen und dir einen…« (Entschuldigung, für das letzte Wort hat leider mein Italienisch nicht gereicht.)
Toll, was Alain Delon für Frauen haben kann, was?
Na, wie gesagt, mir ist er egal.
Wie komme ich überhaupt auf seinen Namen?
Ich komme darauf, weil ich sehr oft zusammen mit der Frau meines Lebens Filme anschaue, sagen wir, nur ein Beispiel, Die Farbe des Geldes mit Paul Newman. Wir sitzen zusammen auf dem Sofa, und ich schaue und schaue, und Paola schaut und seufzt, und ich schaue zu ihr, und sie schaut zu Paul Newman und seufzt, und ich schaue wieder auf den Bildschirm, und sie auch und seufzt, und ich schaue wieder zu ihr, und sie seufzt, den Blick auf Paul Newman gerichtet. Und ich frage:
»Was seufzt du eigentlich dauernd so?«
Und sie seufzt.
»Sag’s ruhig«, sage ich ruhig, »kannst es ruhig sagen.« Und sie seufzt.
»Ach«, sagt sie dann seufzend und schaut mich an, als Paul Newman einmal kurz nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist, »wie souverän er ist…«
Und ich seufze.
Dann nehme ich meine Rhett-Butler-Maske aus dem Schrank, tanze ein paar Schritte durch das Zimmer und singe das Lied aller Männer, die mit ihrer Frau zusammen Filme anschauen:
»Bin nicht Brad, bin nicht Pitt,
bin nur Du-hu-hurchschnitt.
Bin nicht Al, nicht Pacino,
sitz nur neben dir im Kino.
Bin nicht Redford, nicht Marcello –
findst du mich denn gar nicht bello?«
Klasse, oder? Aber jetzt hören Sie den Refrain:
»Bin nicht Clark, bin nicht Gable,
aber ich hab’ einen Faible:
für dich!
Bin nicht Cary, bin nicht Grant,
aber mein Herz, das brennt:
für dich!«
Jedenfalls ist es besser, als es zu machen wie mein Onkel Heinz. Vor vielen Jahren sah meine Tante Elma einmal Omar Sharif in Doktor Schiwago. Wochenlang sprach sie bei jeder Gelegenheit von Omar, seiner Leidenschaft und Männlichkeit, so lange, bis der Onkel mit rotem Kopf in den Keller rannte, sich eine Axt holte und im Garten eine mittelgroße Tanne fällte, bei jedem Hieb brüllend: »Doktor Schiwago! Doktor Schiwago!«
Das ist lange her. Onkel Heinz ist schon tot, Tante Elma lebt bei ihrer Tochter und den Enkeln, und Omar ist wahrscheinlich auch schon Opar.
Wie hieß jetzt noch mal dieser Typ, der mir völlig schnuppe ist?
Richtig: Alain Delon. Was also nun Alain Delon angeht, so hatte ich kürzlich einen kleinen Streit mit meiner Frau, in dessen Verlauf ich mich sehr erregte, zu allerlei Unverschämtheiten verstieg, schließlich sogar das Haus verließ, um in einem Lokal in der Nähe zu trinken, dann zurückkehrte, mich weiter in der Wortwahl vergriff, bis Paola mich schließlich anschrie:
»Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Alain Delon, oder was?«
Gut, dass mir ausgerechnet Alain Delon so total gleichgültig ist.
Ich saß mal wieder nachts in der Küche und starrte aus dem Fenster in den Hinterhof und auf das gegenüberliegende Haus, in dem gerade das letzte Licht hinter einem Fenster im vierten Stock erloschen war. Es war die Stunde, in der ich mich oft mit Bosch unterhalte, meinem sehr alten Kühlschrank und Freund. Ich trank Rotwein.
»Ich hätte auch gerne mal Rotwein«, sagte Bosch. »Nie stellst du Rotwein in mich rein.«
»Rotwein ist nichts für Kühlschränke«, antwortete ich, »und Kühlschränke sind nichts für Rotwein.«
Sein Motor brummte ein bisschen mürrischer als sonst, und ich fügte hinzu: »Ich habe gelesen, dass es bald Kühlschränke mit eingebautem Computer geben wird. Sie werden an das Internet angeschlossen und können selbständig im Supermarkt Nachschub bestellen, wenn keine Butter mehr da ist oder keine Erdbeermarmelade. Und wenn das Verfallsdatum der Milch abgelaufen ist, bestellen sie auch Milch. Solche Kühlschränke könnten sich auch selbst Rotwein kommen lassen.«
»Und wie kommt die Butter dann hierher und der Wein?«, fragte Bosch.
»Ein Bote bringt sie«, sagte ich.
»Schade«, sagte Bosch. »Es wäre doch schön, wenn die Kühlschränke auch selbst einkaufen gehen würden. Sie könnten in die Geschäfte gehen und Butter, Milch und Marmelade holen, und an der Kasse würden sie ihre Tür öffnen, und die Kassiererin könnte gleich alles in ihren Leib hineinstellen. Sie bräuchten nicht einmal einen Einkaufskorb.«
»Aber wie willst du in den Supermarkt kommen?«, fragte ich. »So ein langes Elektrokabel gibt es nicht.«
»Man bräuchte halt einen Akku, der sich auflädt und zwei, drei Stunden hält«, sagte Bosch. »Ich habe gehört, dass es Akkus gibt. Der kleine Black & Decker hat es mir erzählt, der Tischstaubsauger, weißt du. Er hat selbst einen Akku.« Er seufzte. »Man würde auch mal andere Kühlschränke kennenlernen. Wir könnten uns beim Einkaufen treffen und über alles reden. Ich habe gehört, dass es auch Kühlschränke gibt, die Siemens heißen oder Liebherr. Und ich würde so gerne mal in ein Geschäft gehen und selbst einkaufen. Ich war noch nie in einem Geschäft, außer in dem Laden, in dem du mich gekauft hast, damals.«
Ich machte seine Tür auf, um mir ein Stück Käse zu nehmen. Er atmete mich kühl an, wie immer, aber irgendwie kam es mir vor, als leuchte er besonders hell, wenn er so erzählte. Er hat ja wirklich nur mich zum Reden und ein paar Elektrogeräte in der Küche. Aber die meisten mag er nicht: Der Herd sei ein Idiot, sagt er immer, alle Herde seien Idioten, und die Mikrowelle sei schon gar nicht sein Fall, ein hysterisches junges Ding, das ihn anschwärme, weil er so cool sei, immer so herrlich cool. Ich hatte auch gelesen, dass ein Professor in den USA beabsichtige, nicht mehr bloß Herzen und Lebern, sondern auch Köpfe zu verpflanzen. Eines Tages wird es soweit sein, dass man Köpfe auf Kühlschränke verpflanzt, dachte ich, und Beine wird man auch dranmachen, und dann wird so ein Bosch mit ins Wohnzimmer kommen können, wenn ich Fußball sehe, und ich muss nicht mehr aufstehen zum Bierholen. Andererseits: Wenn man manchmal gewisse Managertypen im Flugzeug sieht – vielleicht machen sie das alles ja schon längst, das mit den Köpfen auf Kühlschränken. Und wir wissen es nur nicht.
Ich war wieder zum Fenster gegangen und blickte ins Dunkel hinaus. »Ich bin schon zu alt für diese Computer und dieses Internet«, sagte Bosch leise. »Für mich kommt das alles zu spät. Manchmal fühle ich mich krank, und der Kompressor tut so weh, und ich habe Angst vor Kühlmittelkrebs.«
»Ach was«, sagte ich. »So jammerst du schon seit Jahren. Du bist noch bestens in Schuss und so schön rund, und du brummst so sonor und bist nicht so ein dämlicher, unauffälliger Einbaukühlschrank wie die anderen.«
»Du wirst mich nicht verkaufen?«, fragte er noch leiser als vorher. »Du wirst mich nicht, ähm, entsorgen, nicht wahr? Du wirst dir nicht so ein junges Internet-Ding zulegen?«
»Nie im Leben!«, rief ich. »Keiner kühlt mein Bier wie du! Und jetzt lass uns schlafen gehen!« Ich gab ihm einen Klaps auf die Tür. Er hörte auf zu brummen. Ich ging auf den Flur hinaus und zum Schlafzimmer, aber auf halbem Wege kehrte ich noch einmal zurück, nahm die angebrochene Flasche Rotwein vom Tisch, öffnete den Kühlschrank und stellte sie hinein.
Manchmal begegnet einem ein schönes, unbekanntes Wort so unverhofft, wie man bei einem Spaziergang durch den Dschungel vielleicht plötzlich einem seltenen und schillernd bunten Schmetterling gegenübersteht.
So geschah es mir, als ich vom Mittagessen in mein Büro zurückkehrte und ein Eilt!-Eilt!-Fax auf meinem Schreibtisch vorfand, abgesandt vom Sekretär des Herrn O., eines berühmten und bedeutenden Mannes, mit dem ich am nächsten Morgen verabredet war. Herr O., teilte mir sein Sekretär mit, könne unseren Termin leider nicht einhalten – und zwar »wegen einer plötzlichen Erkrakung«.
Fassungslos bedachte ich das Schicksal des O., welches so unerwartet über ihn hereingebrochen war. Eine Erkrakung! Schlimm wäre ja schon eine unvorhergesehene Erkrankung gewesen. Aber eine Erkrakung? Das klang wie etwas Unheilbares, Nichtwiederrückgängigzumachendes.
Ich stellte mir vor, wie O. noch sein Frühstück gemeinsam mit der Ehefrau verzehrte, die Hand mit der Marmeladensemmel zum Mund führte… Wie aber dann im Laufe des Vormittags aus eben dieser Hand und dem dazugehörigen Arm ein Tentakel wurde mit Saugnäpfen sonder Zahl, wie auch der andere Arm sowie die Beine sich in Fangarme verwandelten, wie der Mund zu einem Schnabel wurde, der ganze O. zu einem schleimig-weichen Polypen, ein erkrakter Mann, der seine Umgebung anstarrt »mit seinen hasserfüllten, menschenähnlichen Augen, während seine pneumatische Haut von Grau zu Violett wechselt, seine Saugorgane auf- und zuklappen, aus seinem Maul Wasserstrahlen sprudeln«, getreu Vilém Flussers Krakenbeschreibung in seinem Buch Vampyrotheutis infernalis.
Gut, dass man die Verabredung noch abgesagt hatte, dachte ich, sonst hättest du mit ihm kämpfen müssen, wie einst die Besatzung der »Nautilus« in Jules Vernes 20000 Meilen unter dem Meer mit dem Kalmar kämpfen musste. Oder du wärst von ihm verzehrt worden, wie Odysseus’ Freunde von der zwölffüßigen, sechsköpfigen Skylla verzehrt wurden, »das Ärgste von allem, was je meine Augen gesehen«, berichtete Odysseus.
Dann dachte ich an Alfred Polgars Geschichte über das Urich. Polgar blieb einmal beim flüchtigen Zeitungslesen an einem Satzstück hängen, das lautete: »…so spürt das Urich sich seiner übermächtigen Leidenschaften beraubt…« Gleich trat vor sein inneres Auge ein gewaltiges, elefantengroßes Urich mit langem, drahtigem Schweif, den es benutzte, sich selbst die Flanken zu peitschen, ein Tier mit scharfem Gebiss und tückischen Augen, gewöhnt, seine übermächtigen Leidenschaften an Hirschkuh und Gazelle, ja selbst an Löwinnen auszutoben. Nun aber schrie dieses Tier in des Autors Träumen immerzu jammervoll, es fühle sich seiner übermächtigen Leidenschaften beraubt.
Dann las Polgar den Zeitungsartikel noch einmal und entdeckte, dass dort nicht von einem Urich, sondern vom Ur-Ich die Rede gewesen war, dem reinen, der menschlichen Natur eingepflanzten Ego.
Ich nahm mir meinerseits den Faxbrief ein zweites Mal vor, sah aber, dass ich mich keineswegs verlesen hatte. Zwar hatte der Sekretär möglicherweise von der »Erkrankung« des O. Mitteilung machen wollen, geschrieben hatte er indes eindeutig »Erkrakung«. Und so sandte ich O. meine besten Wünsche an sein Krakenlager. Mit ein bisschen Krakengymnastik und einer guten Krakenversicherung werde alles schon wieder werden, schrieb ich. Aber ich weiß bis heute nicht, ob er sich wieder entkrakt hat. Weder O. noch sein Sekretär haben sich nach meinem Brief je bei mir gemeldet.
Also, wir haben hier nun zuerst einen sehr höflichen Zweijährigen, welcher anscheinend, ohne es zu wollen, in eine frühe Trotzphase geraten ist.
»Lieber Luis, hast du Hunger?«, fragt Paola.
»Leider nein«, sagt Luis.
»Möchtest du nicht eine Semmel mit Marmelade zum Frühstück?«
»Leider nein«, sagt Luis.
»Oder hättest du gerne ein paar Cornflakes?«
»Leider nein.«
»Ja, aber du musst doch irgendetwas essen!«
»Leider nein.«
Man sieht: Er bedauert sehr, dass er seinen Eltern solche Ungelegenheiten machen muss, doch die Trotzphasen kommen und gehen, da kann man nichts machen als kleiner Mensch. Aber die Zeit schreitet fort, und es liegt in der Natur von Trotzphasen, dass sie sich mit der Gewalt von Hurrikanen entwickeln. Alle Höflichkeit wird hinweggefegt, und jedes vom Trotz zermürbte, porös gewordene Leider verfliegt im Wind – auch bei diesem kleinen Herrn hier.
»Luis, schau, hier ist so schöner Griesbrei, davon musst du etwas essen«, sagt Paola.
»Nein«, sagt Luis.
»Aber wenn du nichts mehr isst, wirst du ganz dünn, hast keine Kraft und kannst nicht mehr spielen«, sagt Paola.
»Nein«, sagt Luis.
Sein Mund bildet einen dünnen Strich.
»In der Trotzphase entdeckt das Kind seinen eigenen Willen«, sage ich. »Es experimentiert damit, ohne Sinn dafür, wo es angebracht ist und wo nicht.«
»Ach ja?«, seufzt Paola.
»Pass auf!«, sage ich und nehme einen Löffel Griesbrei. »Dies hier ist ein Feuerwehrauto, und es will in die Garage: Tatütata!«
Der dünne Strich klappt auf, und das Feuerwehrauto fährt in die Garage, das erste Feuerwehrauto der Welt, das mit Martinshorn in die Garage fährt.
»Siehst du!«, sage ich zu Paola. »So macht man das. Jedes trotzige Kind kann man mit einem netten Spiel überzeugen.«
Ich nehme einen zweiten Löffel Griesbrei.
»Achtung!«, rufe ich, »hier ist noch ein Feuerwehrauto. Tatütata!«
Der Mund bleibt hart. Ich wiederhole das Tatütata. Die Garage bleibt zu. Tatütata zum dritten. Nichts.
»Kannst du es mir noch mal zeigen?«, fragt Paola lächelnd. »Ich habe es beim ersten Mal nicht gesehen.«
»Tatütata!«, rufe ich, ein letztes Tatütata.
Der Mund öffnet sich.
»Nein!«, sagt der Mund. Außerdem entquillt ihm der Griesbrei vom ersten Löffel.
»Er hat halt keinen Hunger«, sage ich.
»Nein«, sagt der Mund.
»Ich kann das Wort Nein nicht mehr hören«, sagt Paola. »Wenn ich mit ihm spazierengehe, springt er aus dem Buggy, und wenn ich ihn rufe, sagt er ›Nein‹. Wenn ich ihn wickeln muss, windet er sich auf der Kommode und schreit ›Nein!‹. Wenn ich ihm Schuhe anziehen will, macht er sich steif wie ein Brett und brüllt ›Nein!!‹. Und jetzt muss ich mit ihm in den Drogeriemarkt… Kannst du nicht mit ihm gehen?« Sie fügt leise hinzu: »Ich… schaffe… es… nicht.«
»Ich, ähm, habe eine sehr dringende Arbeit zu erledigen«, sage ich.
»Bitte!«, sagt sie.
»Also gut«, sage ich. Ich habe alle Trotzphasen hinter mir und bin gereinigt von eigenem Willen.
So mache ich mich mit Luis auf den Weg zum Drogeriemarkt. Als ich ihn in den Kindersitz des Einkaufswagens setzen will, schreit er »Nein«. Als ich ihn daran zu hindern trachte, das Regal mit der Zahnpasta auszuräumen, brüllt er »Neinnein«. Als ich ihm erkläre, er solle sich nicht mitten im Geschäft auf dem Boden wälzen, kreischt er »Neinneinnein«. Ich versuche, Babynahrung aus dem Regal zu nehmen, er öffnet währenddessen eine Packung Präservative. Ich überlege, welche Windelmarke ich nehmen soll, er versprüht derweil Glasreiniger über die Kräutertees. Ich laufe schnell zum Toilettenpapier, er untersucht den Schrank mit den teuren Pudern. Ich haste nervös wieder zu ihm, er pudert sich die Nase. Ich rutsche auf einer Dose Haarspray aus, die er auf den Boden geworfen hat, krache fallend in das Sonderangebot von Kölnisch Wasser und brülle: »Hör endlich auf damit und bleib bei mir!«
»Nein«, sagt er.
Über mir erscheint das Gesicht einer Verkäuferin. Sie sagt: »Es ist doch ein kleines Kind! Können Sie sich denn gar nicht beherrschen?«
Und ich murmele: »Leider nein.«
Sicher wollen Sie wissen, warum ich so einen schönen auberginefarbenen Pullover anhabe, was? Na gut, ich werde es Ihnen erzählen.
Manchmal sieht man ja Männer, sitzend in Boutiquen, und sie haben traurige Augen, und sie denken an Fußball oder an das Steuersystem oder an Proschinsky, das Schwein vom Controlling, mit seinen Intrigen. Und vor ihnen geht die Frau ihrer Träume auf und ab, und sie probiert eine Bluse, und sie probiert eine Hose, und sie probiert eine Jacke, und sie probiert Schuhe, und die Männer denken »Ach …« und blicken nach innen. Solche Männer sieht man manchmal, und neulich war ich einer von ihnen.
Es war einer von jenen Tagen, an denen Paola, meine Frau, nichts anzuziehen hat. Sie steht dann vor dem Kleiderschrank und hat nichts anzuziehen und nimmt einen Rock und tut ihn wieder weg und hat nichts anzuziehen und nimmt einen Pullover und hält ihn sich vor den Oberkörper und tut ihn wieder weg und hat nichts anzuziehen und streift ein Kleid über und streift es wieder ab und tut es wieder weg und hat nichts anzuziehen, aber auch reineweg gar nichts. Und das, was sie hat, kann sie nicht mehr sehen. Und überhaupt sei sie so hässlich. Ob ich sie noch anschauen könne, so hässlich wie sie sei? Mich überfiel ein schlechtes Gewissen. Ich rief, dass ich ihr gerne etwas kaufen würde, etwas Schönes zum Anziehen. Wir gingen in den sehr bedeutenden Laden eines sehr bedeutenden Modeschöpfers. Das Geschäft wirkte irgendwie leer, und ich dachte, vielleicht sei dem Modeschöpfer in letzter Zeit wenig eingefallen, oder jedenfalls wenig sehr Bedeutendes, und dann dachte ich an Loriots Bemerkung, als er in einem Restaurant eines sehr bedeutenden Kochs sein Essen serviert bekam: Es sieht sehr übersichtlich aus.
Eine sehr bedeutende Verkäuferin servierte uns Kaffee, und von ganz hinten kamen doch Kleider und Röcke und Blusen und Westen und Mäntel und Schuhe zum Vorschein. Paola probierte dies und probierte jenes, nahm etwas Enges und etwas Weites und etwas Langes und etwas Kurzes und dann etwas Blaues, und dann fragte sie mich: »Wie gefällt es dir?«
Ich sagte: »Ich finde es zauberhaft.«
Sie sagte: »Unsinn, Blau macht mich so blass.«
Sie zog etwas Violettes an, fragte mich wieder, und ich sagte, ich fände es wunderbar. Sie sagte bloß: »Mmmmmmh-nein.« Dann nahm sie etwas Türkisfarbenes und fragte: »Und das?«
»Oh, es ist toll!«
»Immer findest du alles toll.«
»Aber es ist toll.«
»Ach.«
Dann probierte sie etwas Gelbes, und ich sagte zur Abwechslung: »Gefällt mir nicht.«
»Schade«, sagte sie, »ich mag es. Aber wenn es dir nicht gefällt…«
Die sehr bedeutende Verkäuferin servierte noch mal Kaffee.
Ich glaube, etwa zu dieser Zeit begann ich an Fußball zu denken. Ich machte mir Vorwürfe deswegen, weil ich Paola eine Freude hatte machen wollen, und nun war ich hier so wenig bei der Sache. Dann dachte ich an das Steuersystem und machte mir mehr Vorwürfe: Hier, vor dir, geht die Frau deines Lebens, dachte ich, und du wagst es, an das Steuersystem zu denken?! Als ich an Proschinsky, das Schwein, zu denken begann, stand Paola vor mir mit etwas Rotem.
»Es ist süß«, sagte ich.
Paola zischte: »Ja, aber es ist aberwitzig teuer.«
»Lass es uns trotzdem nehmen«, flüsterte ich verzweifelt. »Niemals«, sagte sie, »es ist unverschämt.«
Ich hätte es gekauft, schon weil die Verkäuferin soviel Kaffee gemacht und mich irgendwie eingeschüchtert hatte, aber Paola zog sich um und mich zum Ausgang, die Verkäuferin mit einem Berg Ware zurücklassend.
»Das können wir nicht machen«, sagte ich, »alles probieren und nichts kaufen.« Gleichzeitig machte ich mir Vorwürfe, dass ich mich von einer Verkäuferin einschüchtern ließ. Paola wirkte erfrischt.
In der Fußgängerzone kamen wir bei einem Herrenausstatter vorbei. Paola drückte mich hinein. Ich war sehr müde von all den gelben, grünen und roten Sachen und von den Selbstvorwürfen auch, probierte apathisch den auberginefarbenen Pullover an, den Sie nun an mir sehen, und kaufte ihn.
»Er ist toll«, sagte Paola.
»Aber wir wollten doch etwas für dich kaufen«, sagte ich. »Ach was«, sagte sie, »ich brauche nichts.«
So kam ich zu dem Pullover, den ich trage. Heute morgen stand Paola übrigens verzweifelt vor dem Schrank, und weil mich das schlechte Gewissen überfiel, wollen wir in die Stadt gehen, um etwas für sie zu kaufen. Mal sehen, was ich diesmal bekomme.
Neulich las ich die Gesundheitstipps in einer Zeitschrift. Mitten aus diesen Gesundheitstipps heraus blickte mich das Gesicht Franzi van Almsicks an. Und Franzi van Almsick sprach also zu mir etwa wie folgt:
Ich hab’s euch immer schon gesagt, ihr sollt schwimmen dreimal die Woche und sollt euren Pulsschlag dadurch erhöhen, wie es auf den Gesetzestafeln des Sportbundes verzeichnet ist, auf dass ihr gesund bleibt und den Allgemeinen Ortskrankenkassen nicht zur Last fallt. Und ihr sollt jeweils eine halbe Stunde schwimmen und unter Wasser ausatmen, und wenn ihr also tut, das ist optimal, und ihr werdet euch dann nie einer Koronargruppe anschließen müssen.
Ich blickte an mir herunter und sah, dass ich fett war, fühlte mich kurzatmig, hässlich und herzkrank und tat, wie Franzi mich geheißen hatte, ging schwimmen, dreimal die Woche, atmete unter Wasser aus und über Wasser ein und verwechselte beides nur einmal, dann nie wieder. Ich kaufte mir eine Schwimmbrille und betrachtete, während ich schwamm, die anderen Schwimmer von unten: eine merkwürdige, ins Babyblau des Bassins getauchte Welt schwebender Bäuche, umkurvt von langgestreckten, wie Außenbordmotoren durchs Wasser wütenden Kraulern.
»Der Leib wird leicht im Wasser«, heißt es bei Brecht, und das ist schön, dachte ich, besonders für die großen Wasserverdränger, denn jeder Körper verliert im Wasser soviel an Gewicht wie die Wassermasse wiegt, deren Stelle er einnimmt, capito? Das heißt, wenn ich nicht irre, dass der Dicke im Wasser mehr Gewicht verliert als der Dünne, aber leider nur so lange, bis er wieder heraussteigt. Richtig gut wäre es, wenn der Gewichtsverlust auch an Land erhalten bliebe, wenn man also zum Abnehmen nur kurz in die Badewanne gehen müsste, schon würde das Übergewicht durch den Abfluss gluckern. Aber das hat sich wohl nicht machen lassen bei der Erschaffung der Welt, wie so vieles andere auch, und wir müssen zufrieden sein, wie es ist.
Ich möchte aber auf Grund meiner Erfahrungen anmerken, dass es keine, aber auch gar keine Form des Sports gibt, die einen dermaßen wühlenden Appetit erzeugt wie das Schwimmen. Man hievt seinen ertüchtigten Leib aus dem Wasser, und sofort spürt man in dessen Mitte ein schmerzendes Loch. Mir ist ein Rätsel, wie Franzi dieses erträgt. Hält sie sich nicht täglich stundenlang im Wasser auf, dabei Unvergleichliches leistend? Wie kommt es, dass sie nach dem Training nicht sofort noch am Beckenrand ihren Übungsleiter frisst? Wie ist es möglich, dass nach einem Schwimmrennen nicht Teile des Publikums zwischen den Zähnen der Athleten landen, die anders ihres Hungers nicht mehr Herr werden? Bei mir ist es jedenfalls nun so, dass ich nach dreißig Bahnen im Dantebad schon auf dem Weg zur Dusche nicht mehr fähig bin, meinen Appetit zu zähmen: Ich rase zu den Kabinen wie ein tobsüchtiger Velociraptor in Spielbergs Jurassic Park, falle bereits auf dem Weg zu den Duschen zartfleischige Badegäste an und verschmähte kürzlich auch eine muskulöse Bademeisterin nicht, die Widerworte gab, als ich ihr das mitgebrachte Pausenbrot aus der Hand schnappte. Dem Wirt einer nahe der Schwimmanstalt befindlichen Gaststätte bin ich ein lieber Gast, weil ich dreimal die Woche sein gesamtes Speisekartenprogramm verzehre.
In meinem Hungerschmerz und meiner Gier nehme ich nach jedem Badbesuch ein Vielfaches dessen zu mir, was ich durch die Körperbewegung tatsächlich abarbeite. Die Konsequenz: Ich werde dicker, weil ich schwimme, Schwimmen dient meiner Fettness. Eines Tages, wenn ich sehr viel geschwommen sein werde, werde ich meinen massigen Körper auf den Zehner-Sprungturm hinaufwuchten und mit einem gigantischen Juchhu! hinunterspringen. Die größte Arschbombe der Welt! Das Becken ist wasserfrei danach und mein Lachen fröhlich wie nie, denn ich bin fat for fun.
Danke, Franzi, für den Tipp!
Bitte, Sie müssen wissen, dass ich aus bescheidenen Verhältnissen stamme. Wir lebten zu fünft in drei Zimmern, die Toilette war auf der Etage, die Mahlzeiten bestanden aus einfachen Gerichten. Aber- und abermals wurde unsere Kleidung mit Flicken ausgebessert, wenn sie beim Spielen zerriss. Später kaufte der Vater ein winziges Haus am Stadtrand, in dem mehr Platz war. Aus dem Garten versorgte die Mutter uns mit Gemüse und Obst. Aber in mancher Hinsicht wurde die Lage noch schwieriger. Die Schulden für das Haus drückten den Vater so, dass er eine zweite Arbeitsstelle annahm und jeden Morgen die Zeitung austrug. Danach ging er ins Postamt, um den Dienst als Schalterbeamter zu versehen.
Das Schlimmste jedoch war der Buchstabenmangel, der uns in jenen Jahren quälte. Es gab damals eine Reihe von ungewöhnlich langen, kalten, dennoch schneearmen Wintern, unter deren Folgen die Ernte der Buchstaben auf den Feldern rings um die Stadt genauso litt wie die des Weizens, der Gerste, des Roggens. Heute wissen viele Kinder nicht einmal mehr, woher die Buchstaben kommen. Sie denken, sie seien einfach da oder kämen aus der Fabrik, wie ein Glas Milch oder eine Kuh einfach da seien oder aus der Fabrik kämen. Nie haben sie eine Kuh, ein Kornfeld, eine Buchstabenpflanze gesehen.
Damals herrschte Not. Die Halme blieben spindeldürr, die Buchstabenähren darauf klein. Wenn die Mähdrescher im Sommer über die Felder fuhren, dauerte es doppelt so lange wie in normalen Jahren, bis einer der Wagen hinter den wartenden Traktoren mit Buchstaben gefüllt war. Die Buchstabenpreise stiegen aufs Dreifache. Anfangs konnte Mutter im Buchstabenladen, in dem sie einkaufte, anschreiben lassen. Bald gab der Händler keinen Kredit mehr.
Wir standen oft am Rand der Äcker, und wenn die Wagen und Dreschmaschinen weggefahren waren, sammelten wir auf dem Stoppelfeld herabgefallene Buchstaben auf, um sie nach Hause zu tragen. An Wochenenden wanderten wir ins Land hinaus und bettelten bei den Buchstabenbauern um einen Korb mit Vokalen oder Konsonanten.
Nicht selten wurden wir vom Hof gescheucht und kehrten mit leeren Händen zurück. Ich erinnere mich an einen Winter, in dem die Familie fast kein Wort miteinander sprechen konnte. Wir hatten keine Buchstaben mehr, um Wörter zu bilden. Stumm erwachten wir morgens, schweigend saßen wir um den Mittagstisch, wortlos abends im Wohnzimmer. Was hätte man sich zu sagen gehabt, aber es ging nicht! An Weihnachten kratzten die Eltern alle Vorräte zusammen, um wenigstens »Frohes Fest!« zu wünschen. Mutter hatte eine Schwester in Amerika, die dann und wann ein Päckchen schickte, leider mit viel Tiejdsch und Dabbeljuh, aber besser als nichts. Die Antwortbriefe sparten wir uns vom Munde ab. Nie erfuhr jemand, dass mein Vater auf der Post gelegentlich Briefe unterschlug und die Buchstaben mit nach Hause brachte, damit wir das Nötigste besprechen konnten. Wer seine Korrektheit kannte, weiß, was es für ihn bedeutete.
Schlimm war es im Gymnasium. Es gab die Kinder der Reichen, die immer genug Lettern für Aufsätze und Diktate hatten. Wie aber sollte unsereiner, mochte er noch so begabt sein, jemals im Deutschunterricht vorankommen!? Mir erschien die Orthografie früh als Mittel der Herrschenden zur Erhaltung eines Klassensystems. Fast den ganzen Rilke konnte ich auswendig, aber wenn es ans Niederschreiben ging, war ich verloren; meine Eltern hatten kein Geld für teure Umlaute. »Sein Blick ist vom Vorybergehn der Stebe / so myd geworden, das er nichz mer helt«, schrieb ich – aus Mangel, nicht aus Unkenntnis! Es macht einen krank vor Wut, dass die etablierte Schriftstellerkaste heute gegen die Rechtschreibreform ist: Seit die Kerle sich Buchstaben säckeweise leisten können, versuchen sie, sich den Nachwuchs vom Leibe zu halten.
Ach, einmal aus dem Vollen schöpfen, einmal genug haben von allem! Stattdessen finanziere ich mir mit dem Honorar für einen Text nur die Buchstaben für den nächsten – wie da zu Großem kommen, Romanen von 800 Seiten?! Muss schon wieder aufhören, Vokalmangel, Schlss, st fst nchts mhr vrhndn…
Wir wohnten damals am Stadtrand, im Grünen. Luis besuchte vormittags eine Kindergruppe, betrieben von einer Elterninitiative. Alle vier Wochen gab es einen Elternabend, bisschen oft, dachte ich, sagte aber nichts. Nicht selten dauerte der Elternabend bis nachts um eins, bisschen spät, dachte ich, sagte aber nichts. Sind eben initiative Eltern, dachte ich, initiativer als ich.
Als eines Abends kein Elternabend war, saß ich um neun in der Küche, aß ein Wurstbrot. Das Telefon klingelte. Jörg, ein Vater aus der Elterninitiative und ihr Vorsitzender, wollte wissen, woher die Wurst auf dem Frühstückstisch der Kindergruppe gekommen sei.
»Weiß nicht«, sagte ich und schluckte leise mein Wurstbrot hinunter.
»Bist du nicht diese Woche für den Frühstückseinkauf zuständig?«, fragte Jörg.
Ja, sagte ich, aber Wurst hätte ich nicht gekauft.
Dann müsse er weiterrecherchieren, sagte Jörg, die Kindergärtnerin anrufen, andere Eltern. Er wolle nicht, dass die Kinder Wurst äßen, werde das verhindern. Wurst sei schlecht für die Menschen. »Der Käse war von Tengelmann«, sagte er scharf.
Ja, sagte ich.
»Nicht aus dem Ökoladen«, sagte er.
»Nein«, sagte ich.
»Aha«, sagte Jörg mit Kommissarstimme und legte auf. Ich machte mir ein zweites Wurstbrot.
Er rief noch oft an. Jörg war nicht nur Vorsitzender der Elterninitiative, sondern auch eine Art Wurstwart. Er telefonierte ebenfalls, wenn er Weißbrot auf dem Frühstückstisch gesehen hatte oder Zuckerkekse aus dem Supermarkt oder Nichtbio-Äpfel oder Unöko-Mohrrüben. Ob wir nicht wüssten? Nie gehört hätten? Nicht klar sei? Immer, wenn er aufgelegt hatte, machte ich mir sofort ein Wurstbrot. Oder zwei. Später drei. Ich wurde wurstsüchtig. Jörgs Stimme löste in mir einen so unmäßigen Wurstappetit aus, dass ich nachts nach einem Telefonat zu Aral fuhr, Tankstellenschinken kaufte oder Industriefleischsalat, aaah, ich löffelte ihn noch im Auto.
Einmal machte Paola allen Kindern mittags Fleischpflanzl. Sofort berief Jörg einen Sonderelternabend ein. Wir tagten zwei Tage und Nächte in Permanenz, verabschiedeten dann eine Resolution gegen Wurst allgemein mit spezieller Verurteilung von Fleischpflanzln. Als ich im Morgengrauen heimkam, pfiff ich mir elf Fleischpflanzl und acht Scheiben Leberkäs hinein.
Leider geschah nun folgendes: Luis schlug einem Jungen aus der Kindergruppe einen Holztraktor auf den Kopf, weil er ihm ein Spielzeug nicht hatte geben wollen. Leider blutete der Junge sogar. Leider war er Jörgs Sohn. Als Jörg bei uns anrief, war nur die Oma da. Er schrie sie an. Es reiche nun. Die Oma bat, er möge sich an die Eltern wenden. »Ist doch Wurst!«, schrie er. »Liegt doch alles in der Familie!«
Es gab einen Luis-Spezial-Eil-Elternabend. Jörg hielt einen schriftlich ausgearbeiteten Vortrag über Friedenserziehung. Ich ging hinaus, um aus dem Proviantkühlkoffer, ohne den ich schon lange keinen Elternabend mehr besuchte, heimlich drei Schinkenbrote, acht kalte Schnitzel und eine Schweinskopfsülze zu essen. Ging wieder hinein. Fragte, ob nicht Raufereien unter Kindern zum Alltag gehörten. Und Skinheads mit Baseballschlägern, rief Jörg, gehörten die auch zum Alltag? Ich wieder hinaus. Koffer auf, acht Pfälzer, zwei Leberwürste, zwei Blutwürste. Wieder hinein.
Er habe, sagte Jörg, »einen verheerenden Eindruck« von unserer gesamten Familie.
Ich spürte die Wurst nun unter meinen Haarwurzeln, war wie besoffen von Cholesterin. Nannte Jörg brüllend einen Control-Freak, eine Blockwart-Type, einen Wurstfaschisten. Ging türenknallend ab. Kühlkoffer auf, zwei Pfund Tatar.
Wir sind dann weggezogen, hinunter in die Stadt. Luis ist in einer anderen Kindergruppe, eine fast ohne Elternabende. Ich lebe vorerst von Salat und Obst. Vor allem lebe ich ohne Jörg, ohne Jörg, ohne Jörg.
Lange Zeit glaubte ich, dass es im Irrenhaus eine Abteilung für gescheiterte Hobby-Handwerker gibt. Heute weiß ich es. Denn ich lebe dort, hihi.
Eines Tages sagte Paola zu mir, sie hätte gern im Schlafzimmer einen neuen Vorhang. Sie möchte aber keine Vorhangstange, sondern ein gespanntes Drahtseil, an dem Ringe hängen, an denen wiederum der Vorhang hängt.