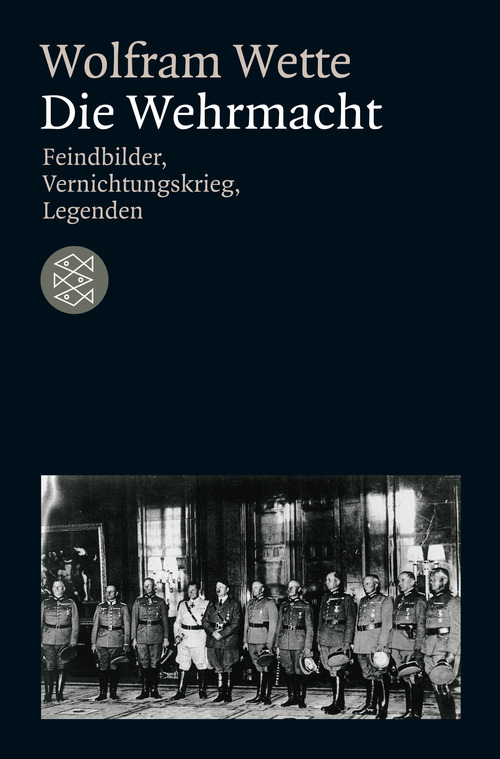
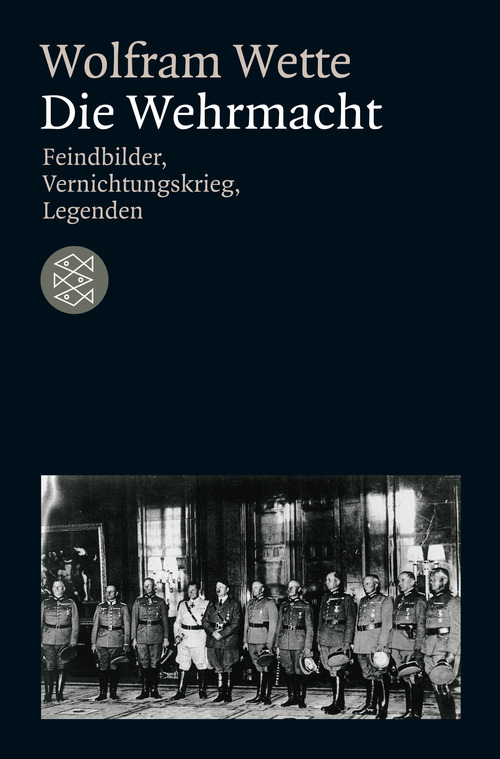
Wolfram Wette
Die Wehrmacht
Feindbilder
Vernichtungskrieg
Legenden
FISCHER E-Books

Wolfram Wette, geboren 1940, Historiker und freier Autor, ist Mitbegründer der Historischen Friedensforschung. Von 1971–1995 war er am Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) in Freiburg i.Br. tätig. Er ist apl. Professor an der Universität Freiburg und hat eine Ehrenprofessur an der russischen Universität Lipezk.
In den Fischer Verlagen erschienen von ihm u.a. ›Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941‹; ›Stalingrad‹ (beide hrsg. mit G.-R. Ueberschär); ›Retter in Uniform. Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der Wehrmacht‹ ( Hrsg.); ›Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen Kultur‹; sowie zuletzt ›Feldwebel Anton Schmid. Ein Held der Humanität‹.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2002, überarbeitete Ausgabe 2005
Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger
Coverabbildung: Hitler in der Reichskanzlei am 14.8.1940 im Kreise seiner Generalfeldmarschälle/AP/Picture Alliance
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403260-3
West-östliche Spiegelungen. Russen und Russland aus deutscher Sicht und Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht von den Anfängen bis zum 20. Jahrhundert. Wuppertaler Projekt zur Erforschung der Geschichte deutsch-russischer Fremdenbilder unter der Leitung von Lew Kopelew.
Lew Kopelew: Fremdenbilder in Geschichte und Gegenwart. Einleitung zu: West-östliche Spiegelungen. Reihe A. Band 1: Russen und Russland aus deutscher Sicht 9.-17. Jahrhundert. Hrsg.v.Mechthild Keller. München 1985, S. 11–34, hier: S. 13.
Vgl. Der Westen und die Sowjetunion. Einstellungen und Politik gegenüber der UdSSR in Europa und in den USA seit 1917. Hrsg.v.Gottfried Niedhart. Paderborn 1983.
Vgl. Das Russlandbild im Dritten Reich. Hrsg.v.Hans-Erich Volkmann. Wien, München 1994.
Arnold Sywottek: Russen und »Sowjets« – Bilder und Feindbilder. In: epd-Dokumentation Nr. 5/1988: »Begegnungen und Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion als Schritt im konziliaren Prozess«, S. 16–25, hier: S. 16f.
Vgl. dazu Robert C. Williams: The Russian Soul. A Study of European Thought and Non-European Nationalism. In: Journal of the History of Ideas 31 (1970), S. 573–588, sowie Arvid Broderson: Der russische Volkscharakter. Neuere englisch-amerikanische Forschungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 8 (1956), S. 477–509.
Neues Konversations-Lexikon, ein Wörterbuch des allgemeinen Wissens. Hrsg.v.Hermann J. Meyer. 2. Aufl., 13. Bd., Hildburghausen 1866, Stichwort »Russisches Reich«, S. 883–936, hier: S. 894.
Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Aufl. 17. Bd., Leipzig und Wien 1907, Stichwort »Russen«, S. 276f. Vgl. dazu auch die Illustrationen in: Wilhelm Stöckle: Deutsche Ansichten. 100 Jahre Zeitgeschichte auf Postkarten. München 1982.
Vgl. West-östliche Spiegelungen, Band 3: Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19. Jahrhundert. München 1992.
Zu den kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland vgl. Ingeborg Fleischhauer: Die Deutschen im Zarenreich. Stuttgart 1986.
Lew Kopelew, Fremdenbilder (wie Anm. 2), S. 23f. Im Einzelnen Mechthild Keller: Wegbereiter der Aufklärung: Gottfried Wilhelm Leibniz' Wirken für Peter den Großen und sein Reich. In: West-östliche Spiegelungen. Bd. 1, S. 391–413.
Fritz Fischer: Deutschland – Russland – Polen vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart. In: ders.: Hitler war kein Betriebsunfall. Aufsätze. München 1992, S. 215–256, Zitat S. 224.
Die reichen Wissenschafts- und Kulturbeziehungen behandelt Karl Schlögel: Die schwierige Rückkehr zur Normalität – Veränderungen im Bild der Deutschen von der Sowjetunion (Vortrag, gehalten am 19.5.1991 in Kiew), hier: S. 12.
Zu den Kulturbeziehungen in den 20er Jahren vgl. allgemein Günter Rosenfeld: Sowjetunion und Deutschland 1922–1933. Berlin (Ost) 1983. Zur Rede von Max Planck: Schlögel (wie Anm. 13), S. 15f.
Mit der realgeschichtlichen Bedeutung dieses Vorgangs beschäftigt sich Karl-Heinz Ruffmann: Schlüsseljahre im Verhältnis zwischen dem deutschen Reich und der Sowjetunion. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 24/1991, S. 3–10.
Grundlegend Peter Lösche: Der Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903–1920. Berlin 1967 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Band 29).
Vgl. dazu die detaillierte Untersuchung von Jürgen Zarusky: Die deutschen Sozialdemokraten und das sowjetische Modell. Ideologische Auseinandersetzung und außenpolitische Konzeptionen 1917–1933. München 1992 (= Studien zur Zeitgeschichte. Hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte. Band 39).
Diesen bekannten Ausspruch August Bebels zitierte Gustav Noske in einer seiner Reichstagsreden zum Militäretat im Jahre 1907. Siehe: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, Band 228, Sitzung vom 24. April 1907, S. 110.
Rosa Luxemburg: Die Krise der Sozialdemokratie (Junius-Broschüre, 1916). In: Politische Schriften. Hrsg. und eingeleitet v.Ossip K. Flechtheim. Band 2. Frankfurt/M., Wien 1966, S. 151.
Gustav Noske in der Chemnitzer »Volksstimme« vom 1. August 1914. Zit. nach Wolfram Wette: Gustav Noske. Eine politische Biographie. Düsseldorf 21987, S. 139.
Sywottek, Russen (wie Anm. 5), S. 17, meint dagegen, der Erste Weltkrieg sei noch im Stil des 19. Jahrhunderts begriffen worden, als »Krieg um die Hegemonie«, und er sei »noch kein Völkerkrieg mit Feindbildern« gewesen.
Vgl. Günter Gorski u.a.: Deutsch-sowjetische Freundschaft. Ein historischer Abriss von 1917 bis zur Gegenwart. Berlin (Ost) 1975.
Fritz Fischer, Hitler (wie Anm. 12), S. 177f.
Fritz Fischer: Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen in Deutschland 1871–1945. Düsseldorf 1979, S. 24.
Abgedruckt bei Wilhelm Stöckle: Deutsche Ansichten. 100 Jahre Zeitgeschichte auf Postkarten. München 1982, S. 54.
Text des »Aufrufs an die Kulturwelt« vom 4. Oktober 1914 in: Aufrufe und Reden deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg. Mit einer Einleitung hrsg.v.Klaus Böhme. Stuttgart 1975, S. 47–49.
Vgl. Rolf-Dieter Müller: Von Brest-Litowsk bis zum »Unternehmen Barbarossa« – Wandlungen und Kontinuität des deutschen »Drangs nach Osten«. In: Frieden mit der Sowjetunion – eine unerledigte Aufgabe. Hrsg.v.Dietrich Goldschmidt u.a. Gütersloh 1989, S. 70–86; und ausführlicher ders.: Das Tor zur Weltmacht. Die Bedeutung der Sowjetunion für die deutsche Wirtschafts- und Rüstungspolitik zwischen den Weltkriegen. Boppard a.Rh. 1984.
Vgl. Rolf-Dieter Müller: Rapallo – Karriere eines Reizwortes. In: DIE ZEIT Nr. 16, 10. April 1992, S. 60. Ausführliche Darstellung der »Rapal-lo-Ära (1921–1933)« in: F. A. Krummacher/Helmut Lange: Krieg und Frieden. Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen. Von Brest-Litowsk zum Unternehmen Barbarossa. München und Esslingen 1970, S. 103–254.
Vgl. jetzt Manfred Zeidler: Reichswehr und Rote Armee 1920–1933. Wege und Stationen einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit. München 1993 (= Beiträge zur Militärgeschichte, Band 36).
Vgl. Andreas Hillgruber: Das Russlandbild der führenden deutschen Militärs vor Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion. In: Russland -Deutschland – Amerika. Wiesbaden 1978, S. 296–310. Wiederabdruck in: Das Russlandbild im Dritten Reich. Hrsg.v.Hans-Erich Volkmann. Köln, Weimar, Wien 1994, S. 125–140.
Vgl. die breit gefächerten Analysen des Sammelbandes: Faschismus und Rassismus. Kontroversen um Ideologie und Opfer. Hrsg.v.Werner Röhr in Zusammenarbeit mit Dietrich Eichholtz, Gerhart Hass und Wolfgang Wippermann. Berlin 1992, in dem allerdings die Frage, in welchem Ausmaß der Rassismus Bestandteil der NS-Propaganda war, nicht eigens thematisiert wird.
»Unternehmen Barbarossa«. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. Hrsg.v.Gerd.R.Ueberschär/Wolfram Wette. Paderborn 1984. Taschenbuchausgabe u.d.T: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. »Unternehmen Barbarossa« 1941. Frankfurt/M. 1991.
Im Einzelnen Wolfram Wette: Das Russlandbild in der NS-Propaganda. Ein Problemaufriss. In: Volkmann, Russlandbild (wie Anm. 30), S. 55–78.
Vgl. die Bild-Text-Broschüre: Der Untermensch. Bearbeiter: SS-Hauptamt-Schulungsamt. Berlin o.J. (1942).
Vgl. Rolf-Dieter Müller: Raub, Vernichtung, Kolonisierung: Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten 1941–1944. In: Hans Schafranek/Robert Streibel, 22. Juni 1941. Der Überfall auf die Sowjetunion. Wien 1991, S. 99–111; ders., Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik. Die Zusammenarbeit von Wehrmacht, Wirtschaft und SS. Frankfurt/M. 1991.
Siehe dazu Wolfram Wette: Die propagandistische Begleitmusik zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. In: Ueberschär/Wette. Überfall (wie Anm. 32), S. 45–65.
Vgl. Hans-Heinrich Wilhelm: Rassenpolitik und Kriegführung. Sicherheitspolizei und Wehrmacht in Polen und der Sowjetunion. Passau 1991; Gegen das Vergessen. Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 1941–1945. Hrsg.v.Klaus Meyer/Wolfgang Wippermann. Frankfurt/M. 1992; Hans-Heinrich Nolte: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. Hannover 1991; »Gott mit uns«. Der deutsche Vernichtungskrieg 1949–1945. Hrsg.v.Ernst Klee u. Willi Dreßen. Frankfurt/M. 1989; Paul Kohl: »Ich wundere mich, dass ich noch lebe«. Sowjetische Augenzeugen berichten. Gütersloh 1990. Taschenbuchausgabe u.d.T.: Der Krieg der deutschen Wehrmacht und der Polizei 1941–1944. Sowjetische Überlebende berichten. Frankfurt/M. 1997.
Andreas Hillgruber: Die »Endlösung« und das deutsche Ostimperium als Kernstück des rassenideologischen Programms des Nationalsozialismus. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 20 (1972), S. 133–153.
Fischer, Hitler (wie Anm. 12), S. 178.
Vgl. die Bild-Dokumentation von Reiner Diederich, Richard Grübling und Max Bartholl: Die Rote Gefahr. Antisozialistische Bildagitation 1918–1976. Westberlin 1976.
Arnold Sywottek: Die Sowjetunion aus westdeutscher Sicht seit 1945. In: Der Westen und die Sowjetunion. Hrsg.v.Gottfried Niedhart. Paderborn 1983, S. 289–362.
Zeidler, Reichswehr (wie Anm. 29).
Vgl. dazu auch Olaf Groehler: Selbstmörderische Allianz. Deutsch-russische Militärbeziehungen 1920–1941. Berlin 1992.
Mit dieser Frage beschäftigt sich Manfred Zeidler in einem speziellen Beitrag: Das Bild der Wehrmacht von Russland und der Roten Armee zwischen 1933 und 1939. In: Volkmann, Russlandbild (wie Anm. 30), S. 105–123.
Vortrag von Joachim v.Stülpnagel vom Februar 1924: Gedanken über den Krieg der Zukunft. In: Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA) Freiburg i.Br., RH 2/417, Bl. 3–46, hier: 4 und 11–13. Zum Zusammenhang der damit verbundenen Rüstungsplanungen vgl. Carl Dirks u. Karl-Heinz Janßen: Der Krieg der Generäle. Hitler als Werkzeug der Wehrmacht. Berlin 1999, S. 11–33.
Zeidler, Bild (wie Anm. 44), S. 106 und 109f.
Wilhelm Keitel (1882–1946), seit 1938 Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW), als solcher an allen Planungen für den Krieg maßgeblich beteiligt. 1940 Generalfeldmarschall. Unterzeichnete den verbrecherischen Kommissarbefehl und andere völkerrechtswidrige Erlasse wie z.B. den Kugelerlass sowie den Nacht-und-Nebel-Erlass. – Zum fraglichen Zusammenhang vgl. Zeidler, Bild (wie Anm. 44), S. 109f.
Ebda., S. 110.
Hauptmann Hans Krebs: Bericht über Eindrücke bei der Führung fremdländischer Offiziere vom 27.9.1932. Zit. nach Zeidler, Bild (wie Anm. 44), S. 111 mit Anm. 24.
Am 5. Mai 1941 trug Krebs dem Generalstabschef Franz Halder vor, das russische Führerkorps sei »ausgesprochen schlecht«. Siehe: Generaloberst Halder: Kriegstagebuch, Band II. Bearbeitet v.Hans-Adolf Jacobsen. Stuttgart 1954, S. 396f. Zit. nach Groehler, Allianz (wie Anm. 43), 177f.
Ebda., S. 114.
Vgl. Bernd Boll u. Hans Safrian: Auf dem Weg nach Stalingrad. Die 6. Armee 1941/42. In: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. Hrsg.v.Hannes Heer/Klaus Naumann. Hamburg 1995, S. 260–296.
Zeidler, Bild (wie Anm. 44), S. 119; siehe auch Groehler, Allianz (wie Anm. 43), S. 100.
Juri J. Kirschin: Die sowjetische Militärdoktrin der Vorkriegszeit. Moskau 1990, S. 92; weitere Informationen über den Zustand der Roten Armee in dieser Zeit bieten die Aufsätze dess. Autors: Die sowjetischen Streitkräfte am Vorabend des Großen Vaterländischen Krieges. In: Zwei Wege nach Moskau. Vom Hitler-Stalin-Pakt zum »Unternehmen Barbarossa«. Hrsg.v.Bernd Wegner. München, Zürich 1991, S. 389–403, und Bernd Bonwetsch: Die Repression des Militärs und die Einsatzfähigkeit der Roten Armee im »Großen Vaterländischen Krieg«. In ebda., S. 404–424.
Zeidler, Bild (wie Anm. 44), S. 119, 123.
Andreas Hillgruber: Das Russland-Bild der führenden deutschen Militärs vor Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion. In: Russland – Deutschland – Amerika. Festschrift für Fritz T. Epstein zum 80. Geburtstag. Hrsg.v.Alexander Fischer u.a. Wiesbaden 1978; Wiederabdruck in: Andreas Hillgruber: Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepoche 1914 bis 1945. Frankfurt/M., Berlin 1988, S. 256–271. Erneuter Wiederabdruck in: Volkmann, Russlandbild (wie Anm. 30), S. 125–140, hier: S. 126.
Ebda., S. 127.
Zusammenfassung der Ausführungen ebda., S. 136–140.
Ebda., S. 140.
Jürgen Förster: Das Unternehmen »Barbarossa« als Eroberungs- und Vernichtungskrieg. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 4: Der Angriff auf die Sowjetunion. Stuttgart 1983, S. 434f.
Siehe Groehler, Allianz (wie Anm. 43), S. 189f.
Gerd R. Ueberschär: Die Haltung deutscher Widerstandskreise zu Hitlers Russlandpolitik und Ostkrieg. In: Goldschmidt, Frieden (wie Anm. 27), S. 117–134.
Ebda., S. 133.
Ebda., S. 125.
Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Berlin 1996, Kap. 16: Der eliminatorische Antisemitismus: Das Motiv für den Völkermord, S. 487–531.
Vgl. Helmut Berding: Moderner Antisemitismus in Deutschland. Frankfurt/M. 1988, und die dort angegebene Literatur; Shulamit Volkov: Die Juden in Deutschland 1780–1918. München 1994 (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Band 16); Moshe Zimmermann: Die deutschen Juden 1914–1945. München 1997 (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Band 43).
Manfred Messerschmidt: Juden im preußisch-deutschen Heer. In: Deutsche jüdische Soldaten. Von der Epoche der Emanzipation bis zum Zeitalter der Weltkriege. Hamburg, Berlin, Bonn 1996, S. 39–62. Tatsächlich geht es in diesem Beitrag auch um den Antisemitismus im preußisch-deutschen Heer. Zur Erstauflage dieses Katalogs siehe Anm. 15.
Rainer Wohlfeil: Heer und Republik. Frankfurt/M. 1970 (= Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648–1939) Teil VI: Reichswehr und Republik (1918–1933).
Francis L. Carsten: Reichswehr und Politik 1918–1933. Köln, Berlin 31966, S. 136f., 220–223, 261f. u.ö.; vgl. auch unten, Kap. Weimarer Republik.
Horst Fischer: Judentum, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert. Zur Geschichte der staatlichen Judenpolitik. Tübingen 1968.
Zum Beispiel Max J. Löwenthal: Jüdische Reserveoffiziere. Berlin 1914; Die Juden im Heere. Hrsg. vom Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Berlin 1910.
Vgl. u.a.: Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914–1918. Ein Gedenkbuch. Hrsg. vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Berlin 1932.
Vgl. Clemens Picht: Zwischen Vaterland und Volk. Das deutsche Judentum im Ersten Weltkrieg. In: Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse. Hrsg.v.Wolfgang Michalka. München, Zürich 1994, S. 736–755.
Ulrich Dunker: Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten 1919–1938. Düsseldorf 1977.
Zunächst unter dem Titel: Kriegsbriefe gefallener deutscher Juden. Hrsg. vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Berlin 1935; dann, noch 1935, unter dem von den NS-Behörden erzwungenen neuen Titel: Gefallene deutsche Juden. Frontbriefe 1914–1918.
Kriegsbriefe gefallener deutscher Juden. Mit einem Geleitwort von Franz Josef Strauß. Stuttgart-Degerloch 1961.
Ebda., Zum Geleit, S. 12f.
Ebda, S. 5f.
Katalog: Deutsche jüdische Soldaten 1914–1945. Im Auftrage des Bundesministeriums der Verteidigung zur Wanderausstellung herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Freiburg 1982. Es handelt sich um den Vorläufer des in Anm. 3 genannten Katalogs.
Richard Stücklen, ebda. (wie Anm. 15), S. 5.
Othmar Hackl, Oberst i.G., Amtschef des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, ebda. (wie Anm. 15), Vorwort, S. 10.
So F. J. Strauß in dem oben erwähnten Geleitwort (wie Anm. 12).
Rolf Vogel: Wie deutsche Offiziere Juden und »Halbjuden« geholfen haben. In: ebda. (wie Anm. 15), S. 154–168.
»Widmet Eure Kräfte dem Vaterlande!« Dokumente zum Patriotismus deutscher Juden, 8. Teil. In: Deutsche National-Zeitung (DNZ) Nr. 28, 4. Juli 1997, S. 10, zum Gesamtthema »Deutsche und Juden«; auch zum Folgenden.
Vgl. dazu die ausgezeichneten Überblicksdarstellungen von Yaakow Ben-Chanan: Juden und Deutsche. Der lange Weg nach Auschwitz. Kassel 1993; und John Weiss: Der lange Weg zum Holocaust. Die Geschichte der Judenfeindschaft in Deutschland und Österreich. Hamburg 1997.
Karl Demeter: Das deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und Staat 1650–1945. Frankfurt/M. 41965, zur »Judenfrage« S. 217–224, hier: S. 217.
Grundlegend: Werner T. Angress: Prussia's Army and The Jewish Reserve Officer Controversy before World War I. In: Year Book of the Leo Baeck Institute. London 1972, S. 19–42; Demeter, Offizierkorps (wie Anm. 22), S. 217, nennt zwei Ausnahmen aus der Zeit des Vormärz.
Zum Rekrutierungsprinzip »erwünschte Kreise« vgl. Detlef Bald: Der deutsche Offizier. Sozial- und Bildungsgeschichte des deutschen Offizierkorps im 20. Jahrhundert. München 1982, S. 39–43; und Manfred Messerschmidt: Das preußische Militärwesen. In: Handbuch der preußischen Geschichte. Hrsg.v.Wolfgang Neugebauer. Bd. III. Berlin, New York 2001, S. 433f.
Der Erlass ist abgedruckt in: Manfred Messerschmidt u. Ursula v.Gersdorff: Offiziere im Bild von Dokumenten aus drei Jahrhunderten. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Stuttgart 1964, S. 197; ebenfalls in: Bald, Offizier (wie Anm. 24), S. 39. Diese Devise der kaiserlichen Personalpolitik für das Militär wurde sinngemäß wiederholt in der Kabinettesordre vom 29. März 1902.
Reinhard Höhn: Sozialismus und Heer. Band III: Der Kampf des Heeres gegen die Sozialdemokratie. Bad Harzburg 1969, S. 29–61 und 107–209.
Werner T. Angress: Das deutsche Militär und die Juden im Ersten Weltkrieg. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen 19 (1976), S. 77–146, hier: S. 77f.
Heinrich Walle: Deutsche jüdische Soldaten 1914–1918. In: Deutsche jüdische Soldaten (wie Anm. 15), S. 14–84, hier: S. 21.
Ebda., S. 21f.
Zit. nach Demeter, Offizierkorps (wie Anm. 22), S. 20.
Ebda., S. 20. Die Schrift des Verbandes deutscher Juden erschien in Berlin 1911. Vgl. dazu auch die im Auftrage des Verbandes der deutschen Juden verfasste Broschüre von Dr. Max J. Loewenthal: Jüdische Reserveoffiziere. Berlin 1914.
Walle, Soldaten (wie Anm. 28), S. 14.
Demeter, Offizierkorps (wie Anm. 22), S. 220, unter Bezugnahme auf die Spezialstudie von Jakob Segall: Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914/18. Berlin 1921.
Dies bestätigen nicht zuletzt die oben zitierten »Kriegsbriefe gefallener deutscher Juden« (siehe Anm. 12).
Zit nach Walle, Soldaten (wie Anm. 28), S. 18.
Vgl. ebda., S. 16f. und 29.
Zum Reichshammerbund vgl. Werner Jochmann: Die Ausbreitung des Antisemitismus. In: Deutsches Judentum in Krieg und Revolution 1916–1923. Ein Sammelband. Hrsg.v.W. E. Mosse und A. Paucker. Tübingen 1971, S. 411.
Angress, Militär und Juden (wie Anm. 27), S. 79.
Walle, Soldaten (wie Anm. 28), S. 49. Der Autor bezeichnet diese Ungleichbehandlung als einen »Mißstand, der bis Kriegsende nicht zu beheben war« (ebda.), weicht aber konsequent der Frage aus, wer denn für diesen Missstand verantwortlich war.
Vgl. dazu Werner T. Angress, Militär und Juden (wie Anm. 27), S. 77–146; sowie ders.: The German Army's »Judenzählung« of 1916. In: Jahrbuch des Leo Baeck Instituts, Bd. 23. London, Jerusalem, New York 1978, S. 117–135.
Titelseite des Israelischen Familienblatts vom 9. November 1916. Zit. nach Walle, Soldaten (wie Anm. 28), S. 57.
Franz Oppenheimer: Die Judenstatistik im preußischen Kriegsministerium. München 1922.
Aufzeichnung des Oberstleutnants Max Bauer über die Rückwirkungen der innenpolitischen Situation auf das Feldheer von Ende Juli 1918. In: Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914–1918. Bearb. von Wilhelm Deist. Düsseldorf 1970 (= Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Zweite Reihe: Militär und Politik. Bde. 1/I—II), Zweiter Teil, Dok. Nr. 464, S. 1239–1247, Zitat: S. 1243.
Denkschrift des Oberstleutnants Max Bauer über den Reichskanzler Bethmann-Hollweg vom 3.3.1917. In: ebda., Erster Teil, S. 570ff., Zitat S. 574, ähnlich ebda., Zweiter, Teil S. 673 und 717.
Brief Helfritz vom 2.10.1917. In: ebda., Dok. 395, S. 1067.
Aufzeichnungen des Oberstleutnants Max Bauer über die innere Politik vom 23.4.1918. In: ebda., Dok. 452, S. 1211–1216, Zitat S. 1214.
Fritz Fischer: Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen in Deutschland 1871–1945. Düsseldorf 1979, S. 58.
Aus einem 1918 verbreiteten antisemitischen Flugblatt. Zit. nach Angress, Militär und Juden (wie Anm. 27), S. 77 und Anm. 2.
Weiss, Weg (wie Anm. 21), S. 286–288, unter Berufung auf das Buch von Egmont Zechlin.
Ebda., S. 287.
Erich Ludendorff: Kriegführung und Politik. Berlin 1923, S. 141, 322, 339.
Eine Ausnahme bildete General Ludwig Beck, der sich diese Ideen nicht zu eigen macht.
Heinz Hagenlücke: Deutsche Vaterlandspartei. Die nationale Rechte am Ende des Kaiserreiches. Düsseldorf 1997 (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 108), S. 16f.
Ebda., S. 136f.; zu Tirpitz siehe ebda., S. 123f., 219 und 280.
Dies behauptet Hagenlücke, Vaterlandspartei (wie Anm. 53), S. 407, allerdings ohne Belege und nähere Untersuchung.
Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses des Alldeutschen Verbandes am 19./20. Oktober 1918. Zit. nach Hagenlücke, Vaterlandspartei (wie Anm. 53), S. 410.
Michael Epkenhans: »Wir als deutsches Volk sind doch nicht klein zu kriegen …«. Aus den Tagebüchern des Fregattenkapitäns Bogislaw von Selchow 1918/19. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen 55 (1996), S. 165–224.
Tagebucheintragung vom 11. November 1918, S. 199.
Vgl. Wolfram Wette: Die propagandistische Begleitmusik zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. In: »Unternehmen Barbarossa«. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. Hrsg.v.Gerd R. Ueberschär u. Wolfram Wette. Paderborn 1984, S. 111–130, besonders S. 120f.
Epkenhans, Selchow (wie Anm. 57), S. 200.
Vgl. Wolfram Wette: Gustav Noske. Eine politische Biographie. Düsseldorf 21987, S. 308–315, sowie Klaus Gietinger: Eine Leiche im Landwehrkanal. Die Ermordung der Rosa L. Berlin 1995, S. 112f. sowie Anhang: »Die Beteiligten des Mordkomplotts«, S. 127–133.
Gustav Strübel: »Ich habe sie richten lassen«. Vor 70 Jahren: Offiziere morden, Richter versagen, die SPD zahlt den Preis. In: Sebastian Haffner, Stephan Hermlin, Kurt Tucholsky u.a., Zwecklegenden. Die SPD und das Scheitern der Arbeiterbewegung. Berlin 1996, S. 109–122.
Weiss, Weg (wie Anm. 21), S. 259.
Zu Pabst vgl. Wette, Noske (wie Anm. 61), S. 251ff. u.ö.
Gietinger, Leiche (wie Anm. 61), S. 48f.
Namentlich aufgelistet von Emil Julius Gumbel: Vier Jahre politischer Mord [Erstauflage Berlinl922], Reprint Heidelberg, S. 43–49.
Hinweis von Weiss, Weg (wie Anm. 21), S. 292.
Zu entnehmen einem Brief an seine Frau vom 3.11.1918. In: Fritz Ernst: Aus dem Nachlass des Generals Walther Reinhardt. In: Die Welt als Geschichte XVIII. Stuttgart 1985, S. 39–65 und 67–121. Sonderdruck Stuttgart 1958, S. 5.
Carsten, Reichswehr (wie Anm. 5), S. 136.
Ebda., S. 220.
Wohlfeil, Heer (wie Anm. 4), S. 138f.
Vgl. den Bericht »Die schwarz-rot-goldene Judenfahne«. In: Vorwärts Nr. 440, 29.8.1919, Morgen-Ausgabe, Beilage.
Gustav Noske in: Verhandlungen der Nationalversammlung, Band 328, 26.7.1919, S. 1970, auch zum Folgenden. Zit. nach Wette, Noske (wie Anm. 61), S. 583.
Vgl. ebda., S. 583.
Wiedergabe der Rede Scheidemanns vom 11. September 1919 in: Vorwärts Nr. 466, 12.9.1919, Morgen-Ausgabe, S. 1 (ganzseitig). Zum Kontext siehe Wette, Noske (wie Anm. 61), S. 584–589.
Scheidemann-Rede in: Verhandlungen NV, Band 330, 7.10.1919, S. 2888; sowie: Vorwärts Nr. 586, 15.11.1919, Leitartikel Scheidemanns »Der Feind steht rechts!«
Siehe unten, Teil II, Kap. »Der Anschlag auf …«
Vgl. dazu die Statistiken des Pazifisten und Mathematikers Gumbel, Vier Jahre (wie Anm. 66). Zur Person Gumbels vgl. Christian Jansen: Emil Julius Gumbel. Portrait eines Zivilisten. Heidelberg 1991.
Emil Julius Gumbel, »Verschwörer verfallen der Feme«. Opfer/Mörder/Richter 1919–1929. Unter Mitwirkung von Bertold Jacob und Ernst Falck. Berlin 1929, S. 114. Vgl. auch Irmela Nagel: Fememorde und Fememordprozesse in der Weimarer Republik. Phil. Diss. Köln 1991.
Vgl. hierzu die Spezialstudie von Gabriele Krüger: Die Brigade Ehrhardt. Hamburg 1971.
Martin Sabrow: Der Rathenaumord. Rekonstruktion einer Verschwörung gegen die Republik von Weimar. München 1994 (= Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 69), S. 17. Vgl. auch die Rezension von Armin Wagner in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 55 (1996), S. 503–505.
Ernst von Salomon: Der Fragebogen. Hamburg 1951, S. 394.
Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 150.
Ebda., S. 33f.
Vgl. Susanne Meinl: Nationalsozialisten gegen Hitler. Die nationalrevolutionäre Opposition um Friedrich Wilhelm Heinz. Berlin 2000, die sich auch mit der Kontinuitätslinie von der Marinebrigade Ehrhardt zur SS beschäftigt.
»Die Freiheit« (vermutlich am 9. Oktober 1919), zit. nach: Gustav Noske: Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demokratie. Offenbach 1947, S. 146f.
Noske, Erlebtes (wie Anm. 86), S. 146 und 148.
Ebda., S. 147f.; Noske erwähnt hier Richard Fischer, den langjährigen Geschäftsführer des »Vorwärts«, der seinen antisemitischen Gefühlen nicht selten einen recht drastischen Ausdruck gegeben habe.
Vgl. im Einzelnen Hans Langemann: Das Attentat. Eine kriminalwissenschaftliche Studie zum politischen Kapitalverbrechen. Hamburg 1956, S. 128ff.
Wilhelm Hoegner: Die verratene Republik. Deutsche Geschichte 1919–1933. München 1979, S. 83.
Vgl. im Einzelnen Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 17–27.
Vgl. die Broschüre von Karl Helfferich: Fort mit Erzberger. Berlin 1919; zum zeitgeschichtlichen Kontext vgl. Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 17f.
Weiss, Weg (wie Anm. 21), S. 308, 494.
Kurzvita in: Das große Lexikon des Dritten Reiches. Hrsg.v.Christian Zentner u. Friedemann Bedürftig. München 1985, S. 308.
Die Klärung dieses Sachverhalts erfolgte in einem Gerichtsprozess im Jahre 1947. Siehe Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 27.
Ebda., S. 29.
Ebda., S. 45f.
Siehe unten, Teil II, Kap. »Die Einführung des ›Arierparagraphen‹…«.
Vgl. im Einzelnen Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 56–68, auch zum Folgenden.
Ebda., S. 56f.
Ebda., S. 72, unter Berufung auf zeitgenössische Presseberichte.
Arnold Brecht: Rathenau und das deutsche Volk. München 1950, S. 7. Brecht war 1921–27 Ministerialdirektor im Reichsministerium des Innern. 1933 emigrierte er in die USA.
Einzelheiten bei Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 74f.
Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 76f., mit Belegen.
Rathenau. Hauptwerke und Gespräche. Hrsg.v.Ernst Schulin. München, Heidelberg 1977, S. 854.
Weiss, Weg (wie Anm. 21), S. 308f.
Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 70f.; das Verhältnis Rathenaus zum Militär untersucht im Einzelnen Gerhard Hecker: Walther Rathenau und sein Verhältnis zu Militär und Krieg. Boppard a.Rh. 1983.
Zit. nach Schulin (Hrsg.), Rathenau (wie Anm. 105), S. 841.
Uwe Lohalm: Völkischer Radikalismus. Die Geschichte des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes 1919–1923. Hamburg 1970, S. 220. Zit. nach Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 115, Anm. 6.
Anonym: Minister Rathenau, in: Der Wiking, 15.2.1922. Zit. nach Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 116.
Ebda., S. 87 und 90.
Informationen über die Lebensläufe von Kern, Fischer und Karl Tillessen ebda., S. 96, 118f., 134.
Ebda., S. 150.
Aus dem Urteil gegen Kern. Zit. ebda., S. 114.
Zit. ebda., S. 122.
Noske, Erlebtes (wie Anm. 86), S. 224.
Vgl. Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 169–183.
Ebda., S. 171f.
Beide Aussagen zit. nach Sabrow, Rathenaumord (wie Anm. 81), S. 176.
Volker R. Berghahn: Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten 1918–1935. Düsseldorf 1966 (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Band 33), S. 286f.
Ebda., S. 65f.
Ebda., S. 66f.
Ebda., S. 239.
Ebda., S. 240f.
Ebda., S. 241–243, auch zum Folgenden.
Vgl. Hagenlücke, Deutsche Vaterlandspartei (wie Anm. 86). Dazu die Besprechung von Hans-Ulrich Wehler »Rechte Trommler« in: DIE ZEIT Nr. 24, 6.6.1997, S. 15.
Zur Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und ihrem verbandspolitischen Umfeld vgl. zusammenfassend Hans Mommsen: Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang 1918 bis 1933. Berlin 1989 (= Propyläen Geschichte Deutschlands. Bd. 8), S. 80f.
Seeckt-Brief vom 19. März 1919. Zit. nach Carsten, Reichswehr (wie Anm. 5), S. 38.
Walle, Soldaten (wie Anm. 86), S. 60.
Ebda., S. 67.
Vgl. Dunker, Reichsbund (wie Anm. 10), und Walle, Soldaten (wie Anm. 28), S. 67.
Mommsen, Freiheit (wie Anm. 127), S. 308.
Klaus-Jürgen Müller: Armee und Drittes Reich 1933–1939. Darstellung und Dokumentation. Paderborn 1989, S. 57.
Reichsgesetzblatt 1933 I S. 175. Wiederabdruck in: Ingo v.Münch, Uwe Brodersen: Gesetze des NS-Staates. Dokumente des Unrechtssystems. Paderborn u.a. 21982, S. 29–31, hier: S. 30.
Wortlaut des Blomberg-Erlasses vom 28.2.1934 in: Klaus-Jürgen Müller: Das Heer und Hitler. Armee und nationalsozialistisches Regime 1933–1940. Stuttgart 1969, Dok.-Anh. Nr. 3, S. 592f.
Müller, Armee (wie Anm. 133), S. 58.
Verlautbarung des Reichswehrministeriums vom 12.10.1933. Zit. nach Müller, Heer (wie Anm. 135), S. 79, Anm. 223.
Endgültige Zusammenstellung der Zahl der durch die Einführung des Arier-Paragraphen betroffenen Soldaten der Reichswehr (Juni 1934). In: Müller, Heer (wie Anm. 135), Dok. Nr. 5, S. 598; siehe auch ebda., S. 79, Anm. 223.
Die Bandbreite schildert Müller, Armee (wie Anm. 133), S. 59f., auf der Basis einer Briefsammlung des Kapitäns zur See a.D. Lebram.
Müller, Heer (wie Anm. 135), S. 82, spricht in diesem Zusammenhang – in einer eher zurückhaltenden Formulierung – davon, dass Fritsch »auch von jenen in weiten Kreisen eingewurzelten und mehr oder weniger unreflektiert gepflegten antisemitischen Vorurteilen nicht frei gewesen zu sein« scheint.
Manfred Messerschmidt: Die Wehrmacht als tragende Säule des NS-Staates (1933–1939). In: Die Wehrmacht im Rassenkrieg. Der Vernichtungskrieg hinter der Front. Hrsg.v.Walter Manoschek. Wien 1996, S. 39–54, hier: S. 45.
Denkschrift des Chefs des Generalstabes des Wehrkreiskommandos III (3. Division), Oberst i.G.von Manstein, über die nachträgliche Anwendung des Arier-Paragraphen auf die Wehrmacht nebst Anschreiben an den Chef des Truppenamtes, Generalleutnant Beck, vom 21. April 1934. In: Müller, Heer (wie Anm. 135), Dok. Nr. 4, S. 593–598.
Ebda., S. 597.
Ebda., S. 83, Anm. 242.
Vgl. dazu den Hinweis des ehemaligen Manstein-Ordonnanzoffiziers Alexander Stahlberg: Die verdammte Pflicht. Erinnerungen 1932 bis 1945. Berlin, Frankfurt a.M. 1987, S. 345.
Vgl. den Armeebefehl des Oberbefehlshabers der 11. Armee, Generaloberst v.Manstein, vom 20. November 1941. Wortlaut in: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. »Unternehmen Barbarossa« 1941. Hrsg.v.Gerd R. Ueberschär u. Wolfram Wette. Frankfurt a.M. 1991, Dok. Nr. 22, S. 289ff.
Stahlberg, Pflicht (wie Anm. 145), S. 344.
Ebda., S. 314 und 344.
Vgl. ebda., S. 224, 314f., 342–345, 357f. Auf der von der 11. Armee eroberten Halbinsel Krim ermordete die Einsatzgruppe D 23000 Juden. Zur Zusammenarbeit von 11. Armee (Manstein) und Einsatzgruppe D (SS-Gruppenführer Otto Ohlendorf) siehe Bernd Boll: Generalfeldmarschall Erich von Lewinski, gen. von Manstein. In: Hitlers militärische Elite. Bd. 2: Vom Kriegsbeginn zum Weltkriegsende. Hrsg.v.Gerd R. Ueberschär. Darmstadt 1998, S. 143–152, hier: S. 146f.
Stahlberg, Pflicht (wie Anm. 145), S. 343f.
Vgl. dazu die autobiographische Rechtfertigungsschrift: Erich Manstein: Verlorene Siege. Bonn 1955.
Der Ausspruch ist überliefert von einem Offizier aus dem Widerstandkreis des 20. Juli 1944, Rudolf-Christoph Frhr.v.Gersdorff: Soldat im Untergang. Frankfurt/M., Berlin, Wien 1977, S. 134.
Vgl. dazu Christian Schneider: Denkmal Manstein. Psychogramm eines Befehlshabers. In: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. Hrsg.v.Hannes Heer u. Klaus Naumann. Hamburg 1985, S. 402–417.
Messerschmidt, Wehrmacht (1996) (wie Anm. 141), S. 47.
Vgl. dazu im Einzelnen ebda., S. 44.
Militär-Wochenblatt Nr. 14, 11.10.1933, Sp. 448f.; vgl. auch Nr. 17 vom 4.11.1933, Sp. 552f. So Müller, Heer (wie Anm. 135), S. 81, Anm. 237.
Messerschmidt, Wehrmacht (1996) (wie Anm. 141), S. 48.
Wortlaut des Wehrgesetzes in: Reichsgesetzblatt 1935, Teil I, S. 609–614.
Ebda., S. 611, auch zum Folgenden.
Erlass »Rassegedanke und Führerauslese« des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht vom 13. Mai 1936. In: Oberkommando der Wehrmacht (Hrsg.), Politisches Handbuch. Teil I (Pol.H.I). Berlin 1938, Teil G: Rassefragen. Wiederabdruck in: Politisches Handbuch, Teil I, vom 1.3.1943, Abschnitt G: Rassefragen, S. 100 [Bibliothek des Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA)J.
Reichsbürgergesetz vom 15.9.1935. In: Reichgesetzblatt 1935 I, S. 1146, hier: § 2 (1).
Reichsgesetzblatt 1936 I, S. 518.
Uwe Dietrich Adam: Judenpolitik im Dritten Reich. Düsseldorf 1972, S. 331.
Oberkommando der Wehrmacht, Nr. 524/40 geh., Berlin, den 8. April 1940, betr.: Behandlung jüdischer Mischlinge in der Wehrmacht. In: BA-MA RH 15/186, Bl. 99–101.
Messerschmidt, Juden (wie Anm. 3), S. 59.
Vgl. unten, Teil II, Kap. »Ausnahmeregelungen …«.
So Brian Rigg in einem Vortrag am 2. März 1998 in der Arbeitsstelle Freiburg des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (MGFA). Eine Buchpublikation ist in Vorbereitung.
Brian Rigg fand eine Liste mit 77 Namen von Wehrmachtoffizieren jüdischer Abstammung. Siehe den Pressebericht: Riggs Liste. Warum gehorchten Soldaten jüdischer Herkunft einem Regime, das ihre Familien umbrachte? Von Brian Mark Rigg. In: DIE ZEIT Nr. 15, 4. April 1997, S. 11f.
Kurzvita – mit Erwähnung der jüdischen Abstammung Milchs – in: Das große Lexikon des Zweiten Weltkrieges. Hrsg.v.Christian Zentner u. Friedemann Bedürftig. München 1988, S. 380.
Brief Fritschs an Stülpnagel vom 16.11.1924. Zit. nach Carsten, Reichswehr (wie Anm. 5), S. 223.
Messerschmidt u. Gersdorff, Offiziere (wie Anm. 25), Dok. 100, S. 259.
Weisung des Oberbefehlshabers des Heeres, Werner Frhr.v.Fritsch, vom 15. Januar 1936, betr. »Arische Abstammung des Offizierkorps«. In: BA-MA RH 53–7/637. Faksimile in: Deutsche jüdische Soldaten (1982) (wie Anm. 15), S. 71.
Als Faksimile veröffentlicht von Nicholas Reynolds: Der Fritsch-Brief vom 11. Dezember 1938. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 28 (1980), S. 360ff., Zitat S. 370.
Müller, Heer (wie Anm. 135), S. 82; zu Fritschs politischem Denken vgl. auch Carsten, Reichswehr (wie Anm. 5), S. 220f.
Vgl. Manfred Messerschmidt: Die Wehrmacht im NS-Staat. Zeit der Indoktrination. Hamburg 1969, S. 37–40.
Zitate aus dem Vorspann zum Heft 1 des 1. Jahrgangs der »Schulungshefte für den Unterricht über nationalsozialistische Weltanschauung und nationalpolitische Zielsetzung«, hrsg. vom Oberkommando der Wehrmacht, J (II), Berlin, 14. Februar 1939, i.A. Reinecke. In: BA-MA Amtsdrucksachen RWD 12/9.
Dr. C. A. Hoberg: Die Juden in der deutschen Geschichte. In: Schulungshefte für den Unterricht über nationalsozialistische Weltanschauung und nationalpolitische Erziehung. Hrsg. vom Oberkommando der Wehrmacht, 1. Jg., Heft 5, S. 3–42.
Messerschmidt, Wehrmacht (1969) (wie Anm. 175), S. 354, mit Anm. 1193.
Hoberg, Juden (wie Anm. 177), S. 3.
Siehe oben, Teil II, Abschnitt 2, Kap. »Ludendorff, Bauer …«.
Hoberg, Juden (wie Anm. 177), S. 28.
Richard Grelling (1853–1929), Rechtsanwalt, Schriftsteller und Journalist, 1982 Mitbegründer der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG). Kurzbiographie in: Die Friedensbewegung. Organisierter Pazifismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hrsg.v.Helmut Donat u. Karl Holl. Düsseldorf 1983, S. 162–163.
Hoberg, Juden (wie Anm. 177), S. 30.
Ebda., S. 31.
Ebda., S. 32.
Ebda., S. 37.
Ebda., S. 40.
Ebda., S. 42.
Vgl. die präzise belegte Darstellung von Jürgen Förster: Das Unternehmen »Barbarossa« als Eroberungs- und Vernichtungskrieg. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Band 4: Der Angriff auf die Sowjetunion. Stuttgart 1983, S. 413–447.
Jürgen Förster: Zur Rolle der Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 45/80 vom 8.11. 1980, S. 1–15, hier: S. 6.
Hitler-Geheimrede vom 30. März 1941, nach den Aufzeichnungen von Generaloberst Halder. In: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. »Unternehmen Barbarossa« 1941. Hrsg.v.Gerd R. Ueberschär u. Wolfram Wette. Frankfurt/M. 1991 (13. Tsd. 1997), S. 248f. Der Band wurde zuerst veröffentlicht u.d.T: »Unternehmen Barbarossa«. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. Hrsg.v.Gerd R. Ueberschär u. Wolfram Wette. Paderborn 1984.
Christopher Browning: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizei-Bataillon 101 und die »Endlösung« in Polen. Reinbek bei Hamburg 1993.
Vgl. die Biographien von Gerd R. Ueberschär: Generaloberst Franz Halder. Generalstabschef, Gegner und Gefangener Hitlers. Göttingen, Zürich 1991, und Christian Hartmann: Halder. Generalstabschef Hitlers 1938–1942. Paderborn 1991.
Fall 12. Das Urteil gegen das Oberkommando der Wehrmacht, gefällt am 28. Oktober 1948 in Nürnberg vom Militärgerichtshof V der Vereinigten Staaten von Amerika. Berlin 1960, S. 91.
Heinrich Uhlig: Der verbrecherische Befehl. Eine Diskussion und ihre historisch-dokumentarischen Grundlagen. In: Vollmacht des Gewissens. Band II. Hrsg. von der Europäischen Publikation e.V. Frankfurt a.M., Berlin 1965, S. 284–410, hier: S. 293f.
Gerd R. Ueberschär: Hitlers Entschluß zum »Lebensraum«-Krieg im Osten. In: Ueberschär/Wette, Überfall (wie Anm. 3), S. 41, unter Berufung auf das Halder-Kriegstagebuch; Förster, Unternehmen »Barbarossa« (wie Anm. 1), S. 428, berichtet, erst bei einem gemeinsamen Frühstück der Heeresführung mit der oberen Truppenführung sei Protest gegen Hitlers ideologisch motivierte Kriegführung laut geworden. Es sei jedoch sehr zweifelhaft, ob die Heeres- und Truppenführung wirklich daran gedacht habe, Hitler durch die Androhung des gemeinschaftlichen Rücktritts zur Zurücknahme seiner Forderungen zu zwingen.
Förster, Rolle der Wehrmacht (wie Anm. 2), S. 6.
Förster, Unternehmen »Barbarossa« (wie Anm. 1), S. 434f.
Das Zustandekommen schildert Förster, Unternehmen »Barbarossa« (wie Anm. 1), S. 421ff.
Wortlaut des Befehls des ObdH, Generalfeldmarschall v.Brauchitsch, über die Zusammenarbeit mit der Sicherheitspolizei und dem SD über den vorgesehenen Ostkrieg vom 28.4.1991 in: Ueberschär/Wette, Überfall (wie Anm. 3), S. 249f.
Siehe Ziff. 3 des Brauchitsch-Befehls.
Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland vom 19. Mai 1941. In: Ueberschär/Wette, Überfall (wie Anm. 3), S. 258.
1