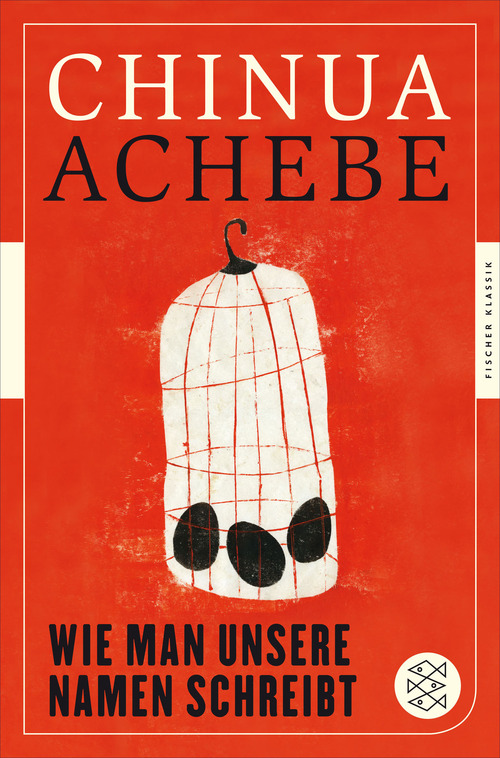
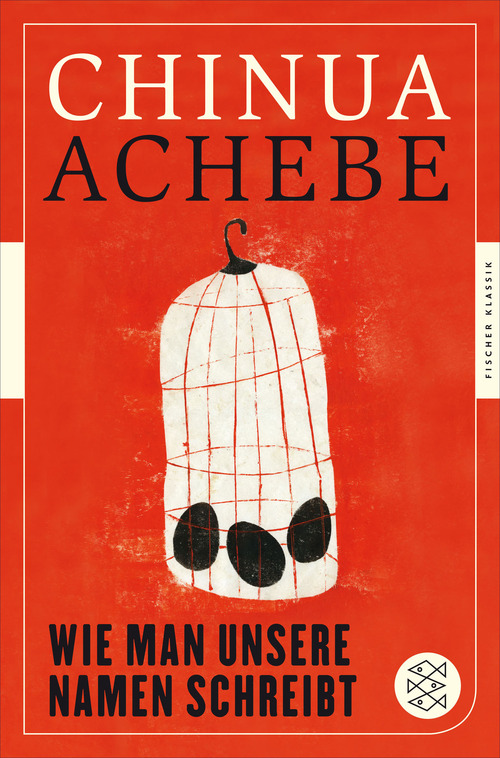
Chinua Achebe
Wie man unsere Namen schreibt
Essays
Aus dem Englischen von Uda Strätling
FISCHER E-Books

Chinua Achebe wurde 1930 in Ogidi im Osten Nigerias als Sohn eines Katechisten aus dem Stamm der Igbo geboren. Er studierte am University College von Ibadan und lehrte seitdem als Professor an nigerianischen, englischen und amerikanischen Universitäten. 1958 erschien sein erster Roman ›Things Fall Apart‹, heute das meistgelesene Buch eines afrikanischen Autors. 2002 wurde Achebe für sein politisches Engagement mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt, 2007 erhielt er den Man Booker International Prize. Chinua Achebe starb 2013 in Boston.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Ezeulu ist Oberpriester der Dorfgemeinschaft von Umuaro. Als Mittler zwischen Gott Ulu und der Igbo-Gemeinde liegt es in seiner Hand, die Ernte auszurufen, Bedrohung vorauszuahnen und Streitigkeiten zu schlichten. Das Einfallen der britischen Kolonialherren bringt die jahrhundertealte Tradition der Igbo-Gemeinschaft in Ungleichgewicht. Als Ezeulu sich weigert, das Fest des Yams auszurufen, weiß die christliche Kirche die drohende Hungersnot zu ihrem Vorteil zu nutzen.
»Er fing die Seele eines ganzen Kontinents ein.« Chimamanda Ngozi Adichie
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Edel Rodriguez
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel
›The Education of a British-Protected Child‹ bei
Alfred A. Knopf, New York
© Chinua Achebe 2009
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400733-5
Guy Burrows: »The Land of the Pigmies.« Zit. n. der von Robert Kimbrough herausgegebenen kritischen Ausgabe von Joseph Conrads »Heart of Darkness«. New York: Norton 1988. 3. Aufl., S. 128, 130.
Chinua Achebe: »Wie Onkel Ben wählte«, aus dem Englischen von Albert von Haller. In: Cyprian Ekwensi, Albert von Haller (Hg.): »Moderne Erzähler der Welt – Nigeria«. Tübingen/Basel: Horst Erdmann Verlag 1973, S. 312ff.
Siehe hierzu das Sprichwort in dem Essay »Den eigenen Namen schreiben«, S. 62
Das Individuum wird bei den Igbo nicht nach seinem biologischen, sondern nach seinem sozialen Alter eingeordnet; es wird in jeder Hinsicht mit seinen Alterskameraden verglichen und hat den Erwartungen an seine Gruppe zu genügen. Diese Verbände bilden soziale Hilfs- und Brüdergemeinschaften. Die Aufnahme in eine Altersgruppe ist Teil der Initiation, man gehört ihr lebenslang an. Die Benennung einer Altersgruppe nach einem Weißen war vor Captain O’Connor undenkbar.
Robert B. Shepard: »Nigeria, Africa, and the United States: from Kennedy to Reagan«. Bloomington. Indiana University Press 1991, S. 88f.
Dieser Essay beruht auf der anlässlich des Silver Jubilee des Guardian am Nigerian Institute of International Affairs (NIIA) auf Victoria Island in Lagos am 9. Oktober 2008 gehaltenen Grundsatzrede. Sie wurde am 14. Oktober 2008 in der Nigeria Daily News abgedruckt.
James Baldwin: »Mein Kerker bebte. Brief an meinen Neffen zum hundertsten Jahrestag der Sklavenbefreiung«. In: »Hundert Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung«. Aus dem Amerikanischen von Hans Georg Heepe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1964, S. 15.
Ebd., S. 16.
Ebd., S. 14.
James Baldwin: »A Stranger in the Village«. In: Notes of a Native Son, 1955. Deutsch: »Ein Fremder im Dorf«. Aus dem Amerikanischen von Leonharda Gescher-Ringelnatz. In: »Schwarz und Weiß oder Was es heißt, ein Amerikaner zu sein«. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1977 [1963], S. 50.
John Buchan: »Prester John«. Zit. n. Brian V. Street: »The Savage in Literature«. London, Boston: Routledge & K. Paul 1975, S. 14. 1955 in einer deutschen Übersetzung von Richard Mummendey unter dem Titel »Trommeln über Transvaal« bei Aschendorff in Münster verlegt.
James Baldwin aaO S. 14f.
Basil Davidson: »The African Slave Trade«. Boston: Atlantic-Little Brown 1961, S. 147f. Zit. n. Chinweizu: »The West and the Rest of Us: White Predators, Black Slavers and the African Exile«. Lagos: Pero Press 1987, S. 28.
C.R. Boxer: »The Kingdom of Congo«. In: Roland Oliver (Hg.): »The Dawn of African History«. London: Oxford University Press 1968, S. 78. Zit. n. Chinweizu aaO S. 331.
Dorothy Randall Tsuruta: »James Baldwin and Chinua Achebe«. In: Black Scholar Nr. 12 (März/April 1981), S. 73.
»The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African. Written by Himself«, edited and with an introduction by Paul Edwards. Harlow and White Plains, New York: Longman 1989. Deutsch: »Olaudah Equiano’s oder Gustav Wasa’s, des Afrikaners merkwürdige Lebensgeschichte von ihm selbst geschrieben«. Ins Deutsche übersetzt von Georg Friedrich Benecke, Göttingen bey Johann Christian Dietrich 1792 und 1990 als »Merkwürdige Lebensgeschichte des Sklaven Olaudah Equiano, von ihm selbst veröffentlicht im Jahre 1789« in der Übersetzung Brigitte Wünnebergs in Frankfurt am Main, Insel Verlag, neu aufgelegt. Siehe dort S. 41f.
Léopold Senghor: »Botschaft und Anruf. Sämtliche Gedichte«. Herausgegeben und übertragen von Janheinz Jahn. München: Hanser 1963 (dtv 1966, S. 36).
Dorothy Hammond, Alta Jablow: »The Africa That Never Was: Four Centuries of British Writing about Africa«. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press 1992, S. 22f.
Albert Schweitzer: »Zwischen Wasser und Urwald« [1921]. München: Beck’sche Reihe 1995, S. 115.
Joseph Conrad: »Heart of Darkness«. Herausgegeben von Robert Kombrough. New York: Norton 1972. Deutsch: »Herz der Finsternis«, übersetzt von Manfred Allié. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2007, S. 117.
Ebd. S. 118.
Ebd. S. 9.
Diese Darstellung verdanke ich in Grundzügen Basil Davidsons »The African Slave Trade«. Boston: Little, Brown and Company 1980.
Mbanza war die Hauptstadt des Königreichs Kongo; der König taufte sie bald in São Salvador um. Das Zitat entstammt Davidson aaO S. 136.
Ebd. S. 152.
Joseph Conrad: »Geography and Some Explorers«. National Geographic, Vol. 45, March 1924.
Davidson aaO S. 147.
Sylvia Leith-Ross: »African Women: A Study of the Igbo of Nigeria«. London: Faber and Faber 1938. Vgl. S. 19.
Joseph Conrad: »Herz der Finsternis« aaO S. 119.
Ebd. S. 143.
Davidson aaO S. 29.
Conrad: »Geography and Some Explorers« aaO S. 147.
David Lingstone: »Missionary Travels and Researches in South Africa« (dort Chapter 25, 1st October), zit. n. Hammond und Jablow aaO S. 43. Livingstones Ausführungen sind in der deutschen Fassung »Reisen in Afrika«, herausgegeben 1861 von Hermann Kletke in der Hasselberg’schen Verlagsbuchhandlung Berlin, nur umschrieben, siehe S. 591.
Reyahn King u.a.: »Ignatius Sancho: An African Man of Letters«. London: National Portrait Gallery 1997, S. 28.
Ebd. S. 30.
William F. Schultz/Willis Hartshorn: 1997 Amnesty International Calendar – Photographs from the Collection of the International Center of Photography. New York: Universe Publishing 1996.
Ebd.
Obiajunwa Wali: »The Dead End of African Literature?« In: Transition 4 (No. 10), 10. September 1963.
Ngũgĩ wa Thiong’o: »The Language of African Literature«. In: »Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature«. London: Heinemann 1986, S. 42–45.
Ebd.
Richard Symonds: »The British and Their Successors«. Evanston, Illinois: Northwestern University Press 1966, S. 202.
David R. Smock, Kwamena Bentsi-Enchill (Hg.): »The Search for National Integration in Africa«. London: Collier Macmillan 1975, S. 174.
Jacob Festus Ade Ajay: »Christian Missions in Nigeria, 1841–1891: The Making of a New Elite«. London: Longman 1965, S. 133f.
David R. Smock, Kwamena Bentsi-Enchill aaO S. 176.
Milan Kundera: »Das Buch vom Lachen und vom Vergessen.« Aus dem Tschechischen von Franz Peter Künzel. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1980, S. 32.
Zit. nach Brian Street: »The Savage in Literature«. London/Boston: Routledge & Kegan 1975, S. 14.
Philip D. Curtin: »The Image of Africa: British Ideas and Actions«. Madison: University of Wisconsin Press 1964, vi.
Joseph Conrad: »Herz der Finsternis«. In der Übersetzung von Manfred Allié. Frankfurt am Main: S. Fischer S. 80.
Cheikh Hamidou Kane: »Ambiguous Adventure«. London: Heinemann, 1972. Deutsch: »Der Zwiespalt des Samba Diallo«. Aus dem Französischen übersetzt von János Riesz und Alfred Prédhumeau. Frankfurt am Main: Lembeck 1980, S. 42.
Ebd.
»In Dialogue to Define Aesthetics: James Baldwin and Chinua Achebe«. In: »Conversations with James Baldwin«. The Black Scholar 12 (März–April 1981).
Jules Chametzky: »Our Decentralized Literature«. Amherst: University of Massachusetts Press 1986, S. 3.
Dieser Essay beruht auf einer Ansprache, die der Autor zur King Holiday Celebration am 20. Januar 1992 in der Smithsonian Institution, National Museum of Natural History in Washington D. C., hielt.
Basil Davidson: »The African Slave Trade«. Boston: Atlantic – Little Brown 1961, S. 12.
Ebd. S. 25
Dorothy Randall Tsuruta: »In Dialogue to Define Aesthetics: James Baldwin and Chinua Achebe.« The Black Scholar 12 (März–April 1981), S. 73.
House of Lords Official Report, 27. August 1968.
Suzanne Cronje: »The World and Nigeria: The Diplomatic History of the Biafran War 1967–1970«. London: Sidgwick & Jackson 1972, S. 211.
Zit. nach Jonah Raskin: »The Mythology of Imperialism«. New York: Random House 1971. Siehe Joseph Conrad: »Sieg: Eine Inselgeschichte«. Deutsch von Walter Schürenberg, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1983, S. 445.
James Baldwin: »Fifth Avenue, Uptown«. In: Esquire, Juli 1960, S. 72–76.
James D. Wolfensohn: »Africa’s Moment«. The World Bank. Washington D.C. 1998.
John Buchan: »Prester John«. Zit. n. Brian V. Street: »The Savage in Literature«. London, Boston: Routledge & K. Paul 1975, S. 14.
Für Charles P. Stevenson Jr.
2008 feierte mein allerletzter Roman Alles zerfällt sein fünfzigjähriges »Jubiläum«. Das Ereignis wurde von Menschen in verschiedensten Teilen der Welt festlich begangen; ein denkwürdiges Jahr, darf man sagen. Es gab hochkarätig besetzte Symposien und kleine, ausgelassene Straßenfeste. In meiner nigerianischen Heimatstadt Ogidi, die wir noch heute liebevoll als Dorf bezeichnen, übertrafen die Menschen sich geradezu selbst an Originalität und Kühnheit: Sie machten Inventur, kramten einen alten Ritus, das Nwafor-Fest, hervor und modelten ihn zur Zelebration eines Romans um.
Nur stellte sich die Frage, ob man mit der Umdeutung dieser traditionellen Festivitäten nicht vielleicht die Ahnengeister und Gottheiten brüskierte. In Gemengelagen wie dieser gehen die Menschen von Ogidi diplomatisch und sehr überlegt vor. Aus dem reichen Festinventar wählten sie gerade dieses »profane«, dem Vergnügen und dem Spaß, der Feier und der Gemeinschaft vorbehaltene Nwafor-Fest: somit kamen rivalisierende Gottheiten gar nicht ins Spiel. Vielmehr weihte Ogidi diesen ausgelassenen Festtag eben dem Buch, das erstmals in der Schriftliteratur die unsterblichen Sitten und Gebräuche des Dorfs feierte, nämlich Alles zerfällt.
So sehr der ganze Wirbel der Vorbereitungen die Alten verwirrt haben mag, so freudig begrüßten die Jungen diese zeitgemäße Auslegung. Ein begabter Schauspieler – derselbe, der einst in der Hauptstadt mit großem Erfolg die Bühnenversion des Okonkwo aus Alles zerfällt gegeben hatte –, zog, wie ich hörte, im Triumph ins Rathaus von Ogidi ein. Jubelnde Dorfbewohner gaben ihm das Geleit. Sie begriffen und bejahten den ungewöhnlichen Trubel um ein Buch, aber eben auch um alles das, was nun zu unserer Geschichte gehört.
In diesem bewegten Festjahr begann ich auch über ein neues Buch nachzudenken, eine Essaysammlung, die den Bogen meiner langen Schaffensjahre als Autor nachzeichnen sollte. Ich gab mich den schönsten Hoffnungen hin. Ich würde das facettierte Licht der Vielfältigkeit auf die Erfahrungen werfen, die das Leben mir persönlich beschert hat, und zeigen, was Schreiben und Leben verbindet. Es wäre gewiss kein leichtes Unterfangen, und der Erfolg der Sammlung hinge davon ab, wie dicht ich die so unterschiedlichen Erfahrungen miteinander verweben könnte. Um konkrete Begegnungen, Momente und Fragen sollte es in dem Band gehen. Einen Punktekatalog, der abzuarbeiten wäre hingegen, einen Schwerpunkt, den ich zu setzen für notwendig hielt, gab es nicht. Das Buch sollte so persönlich wie eklektisch werden; es würde keinen Werkanalysen zuarbeiten.
Ich begann also, Essays zu sichten. Der Beitrag »Meine Töchter« fand anstandslos seinen Platz. Andere folgten, doch nach einer ersten Lektüre meinte mein Lektor: »Und was ist mit den Jungen?« Da ahnte ich schon, dass die nächste Frage sehr wohl lauten könnte: »Wo bleibt Ihre Frau?«, dass meine kompositorische Rechnung nicht aufginge und es mir kaum gestattet werden würde, bestimmte Lebensbereiche auszusparen. Durfte ich denn tatsächlich den Verkehrsunfall übergehen, der mich 1990 an den Rollstuhl fesselte? Was sollte ich aber groß von dem Unfall erzählen – außer, dass ich mit einem meiner Söhne hinten saß, dass er, als er den Unglückswagen nicht hochstemmen konnte, um mich zu befreien, derjenige war, der an die Straße stürzte und so lange meinen Namen schrie, bis alle anhielten und man mich ins Krankenhaus brachte … Wäre mein Sohn nicht gewesen, sähe alles anders aus. Meine Frau Christie hielt gerade ihr Lieblingsseminar vor Abschlussstudenten der University of Nigeria, als sie von dem Unglück erfuhr. Diese Arbeit stellte sie ohne Zögern zurück und tut es noch. Christie, unsere beiden Mädchen Chinelo und Nwando, unsere Söhne Ikechukwu und Chidi waren meine Rettung. Sollte ich, konnte ich wirklich über all das schreiben? Nein, der Band würde Lücken und Auslassungen aufweisen müssen, die Essays ihrer eigenen inneren Logik gemäß von einem Thema zum anderen fortschreiten.
In der Endphase der Arbeit an diesem Buch bot mir eine Einladung, die ich einige Zeit zuvor von der Library of Congress in Washington D.C. erhalten hatte, Gelegenheit, einen Bogen von Zurückliegendem zu einem Ausblick auf Kommendes zu schlagen. Man hatte mich zur Feier des Jubiläums von Alles zerfällt gebeten, und zwar an meinem achtundsiebzigsten Geburtstag. Man empfing mich überaus freundlich. Wiederholt verliehen meine Gastgeber ihrer Freude Ausdruck, dass ich leibhaftig zugegen sei. Das war am 3. November 2008.
Wir hatten ein volles Haus. Ein phänomenaler Trommler aus Kamerun hielt uns in Atem. Ich trug Gedichte vor und signierte Bücher. Dann wurde unter tosendem Beifall eine monströse Geburtstagstorte die Rampe hinauf auf die Bühne gerollt. Meine Dankesworte beschränkten sich auf nur eine Frage: »Macht ihr das etwa immer so?« Welche Antwort ich erwartete, kann ich nicht sagen. Aber an die Bemerkung einer schwarzen Amerikanerin vom Vormittag erinnere ich mich gut. Auch sie hatte mir für mein Kommen gedankt und in einem Ton zwischen Poker und Folklore hinzugefügt: »Und morgen wählen wir für Sie einen schwarzen Präsidenten!«
Sehr wahrscheinlich werden die Leute einander in kommenden Jahren fragen, wo sie gerade waren, als Barack Obama ins Amt gewählt wurde. Ich hingegen hoffe auf eine andere Frage als die, wo wir waren oder was wir gemacht haben, nämlich danach, was die Nachricht mit uns gemacht hat.
Chinua Achebe
Annandale-on-Hudson, New York, 2009
Der Titel, den ich für meine Betrachtungen gewählt habe, wird sich nicht jedermann unmittelbar erschließen und verlangt daher, obgleich ohnehin eher lang, eine Erklärung oder weitere Ausführungen. Doch zuvor möchte ich mich kurz einer anderen Sache zuwenden, die mir mehr Sorge bereitet: dem Vortrag selbst.
Der Leser möge hier bitte keine akademische Abhandlung erwarten. Ich selbst musste mir, als ich eingeladen wurde zu sprechen, vor Augen führen, dass derjenige, den andere für einen Kenner halten, in gewisser Weise wohl einer ist. Das gleich »zur Sache«, wie man hierzulande gern sagt; ich halte es klarstellend fest, um Missverständnissen vorzubeugen.
Zwar würde ich eine gelungene Darbietung durchaus dem Trost einer höflich hingenommenen Blamage vorziehen, doch gebe ich zu bedenken, dass einer Blamage, so bedauerlich sie wäre, immerhin der Hauch poetischer Gerechtigkeit anhaftete, blieb mir doch die Chance, Akademiker reinsten Wassers zu werden, vor vierzig Jahren verwehrt, als das Trinity College in Cambridge es vorzog, die Bewerbung eines Absolventen der neu gegründeten Universität in Ibadan unberücksichtigt zu lassen. Dabei war mein Lehrer und Förderer in Ibadan, James Welch, selbst Cambridge-Mann; wir kommen noch zu ihm. Ich jedenfalls blieb damals daheim – und wurde Schriftsteller. Das einzig entscheidende »Wenn« dieses persönlichen Werdegangs, meine Damen und Herren, liegt darin, dass Sie andernfalls heute einen akademischen Text läsen und nicht die impressionistische Skizze einer Kindheit im Britischen Protektorat Nigeria.
Sie sehen schon, nichts gedeiht im Humus kolonialen Diskurses so willig und so üppig wie wechselseitige Schuldzuweisungen. Dafür, dass aus mir ein Schriftsteller wurde und nicht ein Wissenschaftler, muss irgendjemand den Kopf hinhalten. Doch selbst in einem unwirtlichen Haus achtet man die maskierten Geister der Ahnen und gewährt ihnen Immunität vor Kritik.
1957, drei Jahre nach der vergeblichen Bewerbung in Cambridge, bot sich mir, als ich zu einer Schulung an der BBC Staff School in London aufbrach, die erste Gelegenheit zur Ausreise aus meinem Heimatland Nigeria. Zum ersten Mal in meinem Leben benötigte und erhielt ich einen Reisepass, der mich als »British Protected Person« auswies. Mein Personalstand war bis dahin nie Thema gewesen! Drei weitere Jahre noch, bis zur Unabhängigkeit Nigerias 1960, musste ich warten, um dieser doch sehr willkürlichen Protektion ein Ende zu setzen.
Nun hoffe ich, dass hier niemand darauf brennt, sich erneut das ganze Für und Wider der Kolonialherrschaft anzuhören. Von mir gäbe es nur Widerreden. Lieber erlaube ich mir einen Luxus, den unsere gegenwärtige Kultur selten gestattet: einen weder vorder- noch hintergründigen Blick auf die Ereignisse, sondern ein Mittelding.
Die Mitte gilt allerdings als am wenigsten bewunderungswürdig. Es fehlt ihr der Glanz, sie ist undramatisch, unspektakulär. Doch hat mich die traditionelle Igbo-Kultur, der ich entstamme und die mich in der Stunde ihrer Niederlage dem Schein nach in einem Schilfkorb den Wassern des Nils überließ – nicht allerdings ohne im Verborgenen eifersüchtig über mich zu wachen und mich schließlich in Gestalt der Tochter des Pharao in der Fremde zu nähren – einen Kinderreim gelehrt, der die Mitte als ausgesprochen günstigen besingt.
Obu-uzo anya na-afu mmo
Ono-na-etiti ololo nwa
Okpe-azu aka iko
Das Vordere hat im Auge die Geister
Das Mittlere ist Günstling des Glücks
Das Hintere hat krumme Finger
Wieso bezeichnen die Igbo das Mittelding als glücksbringend? Was birgt diese Position an Glück? Anders gefragt: Welches Unheil bannt sie? Die Antwort, würde ich meinen, lautet: Fanatismus. Die Gefahr des Einen Wegs, der Einen Wahrheit, der Einen Lebensart. Den Schrecken, der alleine steht. So allein, dass die Igbo dafür die Bezeichnung Ajo-ife-na-onu-oto kennen: Das Böse und der blanke Hals. Denken Sie sich die Sache so allein, so ausnehmend entsetzlich, dass sie nicht einmal den Trost einer Halskette kennt. Die Igbo ziehen Dualismen der Singularität vor. Wo etwas steht, steht ihm etwas zur Seite.
Beim Mittelding handelt es sich weder um den Urgrund der Dinge noch um die Letzten Dinge, denn es kennt voraus eine Zukunft, und es kennt den Rückhalt einer Vergangenheit, es ist die Heimat von Zweifeln und Unschlüssigkeit, der willentlichen Aussetzung von Ungläubigkeit, des Als-ob, des Spielwitzes, des Unvorhergesehenen, der Ironie. Lassen Sie mich die Lebenswelt der Igbo kurz umreißen.
Sehen sich die Igbo mit Zwist und Streitigkeiten konfrontiert, gilt ihr erster Impuls nicht der Beantwortung der Frage, wer im Recht sei, sondern der Wiederherstellung des Gleichgewichts. In meinem Heimatort Ogidi gibt es den Spruch Ikpe Ogidi adi-ama ofu onye: Ogidi entscheidet nie gegen eine Seite. Wir sind mehr Sozialmanager als Normgeber. Wir arbeiten nicht am grünen Tisch, sondern in einer chaotischen Werkstatt. In jedem Haus gibt es kluge wie dumme Köpfe, darüber wird sich niemand empören.
Die Igbo machen sich über die Welt kaum Illusionen. Ihre Lieder feiern keine romantische Liebe. Es gibt ein Sprichwort (das meiner Frau sehr widerstrebt), demzufolge eine Frau erklärt, sie verlange nicht, dass ihr Mann sie liebe, solange er mittags die Yams auf den Tisch bringt. Trübe Aussichten für die Frau! Aber Moment, was ist mit dem Mann? Ein Dorfältester sagte einmal zu mir (und das ist jetzt kein Sprichwort, sondern Realität): »Meine Lieblingssuppe ist egusi. Also sage ich zu meiner Frau, sie solle es unter meinem Dach ja nicht wagen, mir jemals egusi vorzusetzen. Und schon gibt es jeden Abend egusi!« So sieht es aus. Die Frau verzichtet für ihr Essen auf Liebe, der Mann lügt für sein Leibgericht!
Eine Ehe ist wahrlich kein Zuckerschlecken; sie ist größer als Mann oder Frau. Die Igbo verlangen weder, dass man sie – womöglich Spruchbänder schwenkend – frontal angeht, noch dass man sich aus dem Staub macht. Sie verlangen, dass man einen Weg findet. Feigheit? Da kennen Sie die Igbo schlecht.
Die Kolonialherrschaft war stärker als jede Ehe. Die Igbo zogen gegen sie in die Schlacht und verloren. Sie errichteten jede erdenkliche Straßenblockade und verloren. Gelegentlich fragen mich Menschen, die Romane wie Geschichtsbücher lesen, weshalb die Bekehrung meines Volkes zum christlichen Glauben in Alles zerfällt so leicht vonstatten ging.
Leicht? Ich versichere Ihnen, es war nicht leicht, weder im realen Zeitlauf noch im Buch. Nur kann ein Roman historische Zeit nicht abbilden; notgedrungen wird alles gerafft. In Wirklichkeit fegte das Christentum nicht wie ein Flächenbrand über das Land der Igbo hinweg. Dazu vielleicht nur dieses eine Beispiel: Die ersten Missionare erreichten den am Ufer des Niger gelegenen Ort Onitsha 1857. Von diesem Brückenkopf aus drangen sie schließlich 1892 bis zu meinem Geburtsort Ogidi vor. Von Onitsha nach Ogidi sind es gerade mal sieben Meilen. Sieben Meilen in fünfunddreißig Jahren; alle fünf Jahre eine Meile. Wohl kaum ein Wirbelwind.
Aber ich habe versprochen, nicht über den Kolonialismus zu dozieren. Ich begnüge mich daher mit meinem grundlegenden Einwand gegen die Kolonialherrschaft.
Für mich ist es ein schlimmes Verbrechen, sich anderen aufzuzwingen, sich ihres Landes und ihrer Geschichte zu bemächtigen und dann zu allem Überfluss so zu tun, als wären die Opfer Mündel oder Minderjährige, die Schutz benötigten. Das ist gar zu durchsichtig. Und da dies offenbar selbst der Aggressor weiß, verschleiert er seine Raubzüge gern mit dreister Scheinheiligkeit.
Noch am Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts konnte der belgische König Leopold II., dessen Vorgehen im Kongo zum Inbegriff kolonialer Schrecken wurde, sich ungeniert folgendermaßen äußern:
»Mit großer Genugtuung nehmen Wir zur Kenntnis, dass Unsere Handelsagenten, größtenteils Freiwillige aus Unserem belgischen Heere, stets der hohen Verantwortung ihres Auftrags eingedenk bleiben, beseelt von Vaterlandsliebe, bereit, hierfür ihr eigenes Blut zu opfern, indes mehr als bereit, dasjenige der Eingeborenen zu schonen, auf dass diese in ihnen die allmächtigen Schutzherren über Leben und Besitz erkennen, gütige Lehrmeister, deren sie so dringend bedürfen.«[1]
Es wäre blanker Unfug, zwischen dem skandalösen Gebaren Seiner Durchlaucht, der Königlichen Majestät Leopold II., im Kongo und der britischen Kolonialherrschaft in Nigeria Parallelen ziehen zu wollen. Und doch dürfen wir die Prämisse nicht außer Acht lassen, die alle europäischen Mächte bei ihrem Run auf Afrika leitete. Denn ebenso, wie ganz Europa seinen Beitrag zu der Schreckensfigur des Mr Kurtz in Joseph Conrads Herz der Finsternis geleistet hatte, wirkte ganz Europa an der Entstehung eben jenes Afrika mit, das Kurtz zu erlösen trachtete, stattdessen aber dem Grauen preisgab.
Die hochtrabenden Worte Leopolds verraten uns allerdings, dass auch der Kolonisator an dem System Schaden nahm, das er schuf. Zwar verlor er, anders als seine kolonisierten Opfer, nicht Land und Freiheit, doch er zahlte eine Reihe nur scheinbar geringer Preise: den Verlust des Sinns für das Absurde, des Sinns für Maß, des Sinns für Humor. Oder glauben Sie etwa, Leopold hätte zu sich selbst gesagt: »Jetzt mach aber mal halblang, Freundchen – alles Humbug! Du weißt genau, weshalb deine Agenten dort unten morden und metzeln. Weil nämlich deine Staatskassen die Einnahmen aus dem Kautschuk- und Elfenbeinhandel brauchen!«? Ein Schuldeingeständnis spricht noch keinen Täter frei, verkürzt aber womöglich Aufzählung und Aufreißen schmerzlicher Wunden.
Wie steht es um die Opfer? Enteignung ist natürlich keineswegs zum Lachen, dem Humor nicht eben förderlich. Und doch lässt sich erstaunlicherweise beobachten, dass der Entrechtete aus seiner Ohnmacht oft das Beste macht, »trotzdem« lacht und sich somit über Not und Verzweiflung erhebt. Seine Menschlichkeit mit knapper Not rettet, denn nichts ist menschlicher als der Humor!
Als meine Mutter um die Jahrhundertwende meinem Katechistenvater versprochen war, schickte man sie auf die nahe gelegene, neu gegründete Mädchenschule St. Monica’s, die erste ihrer Art im Igboland. Ihr wurde die besondere Ehre zuteil, ins Haus der Schulleiterin Miss Edith Ashley Warner und ihrer treuen Schar britischer Lehrerinnen ziehen zu dürfen, wo sie als Gegenleistung für Kost, Logis und Unterricht Haushaltspflichten übernahm. Als Tochter eines Dorfschmieds fand sie dieses neue Leben entsprechend kurios, es war aufregend bis furchterregend. Das schlimmste Erlebnis der ersten Zeit bescherte ihr eines Abends der unerwartete Anblick der Zahnprothese der Schulleiterin – oder mit den Worten meiner Mutter ihres »Kinnladens« – in einem Wasserglas.
Gut dreißig Jahre später hing das Porträt Miss Warners immer noch im Haus meiner Eltern. Eigentlich war sie eine gut aussehende Frau, fand ich als Junge, und mit ihrem Kinnladen schien soweit auch alles in Ordnung. Eine »vollständige Dame«, wie es bei Amos Tutuoala heißt.
Eines Abends hatte diese Dame meine Mutter angewiesen, aufzuessen und ihren Teller dann sorgfältig abzuspülen. Da sie sich zu dieser Zeit mühte, Igbo zu lernen, sagte sie es in der afrikanischen Sprache, nämlich: »Awakwana afele« und meinte eigentlich: »Zerbrich den Teller nicht«, nur können Igbo-Verben recht heikel sein. Meine Mutter hatte nicht an sich halten können und prustete los – ein schwerer Fehler. Die viktorianische Dame zeigte sich »not amused«. Sie griff einen Rohrstock und vertrimmte sie. Später rief sie sie zu sich und hielt ihr eine Gardinenpredigt zu Anstand und Manieren. »Sollte ich mich in deiner Sprache ungeschickt ausdrücken, wäre es angebracht, mich zu verbessern statt auszulachen.« So in der Art.
»Awakwana afele«