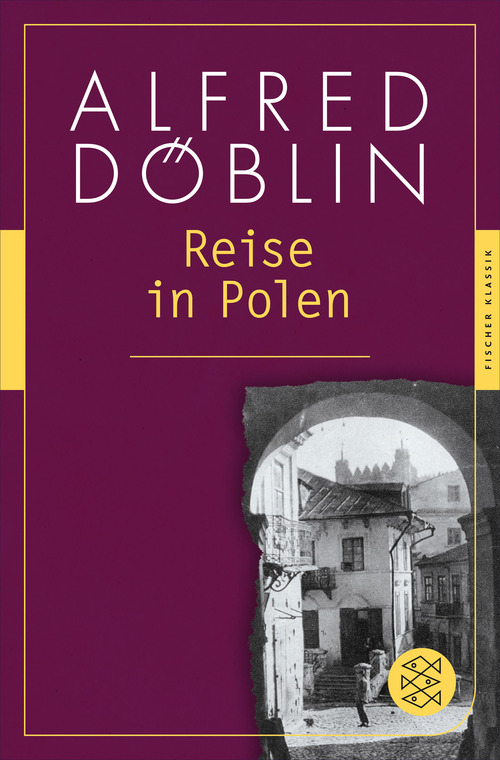
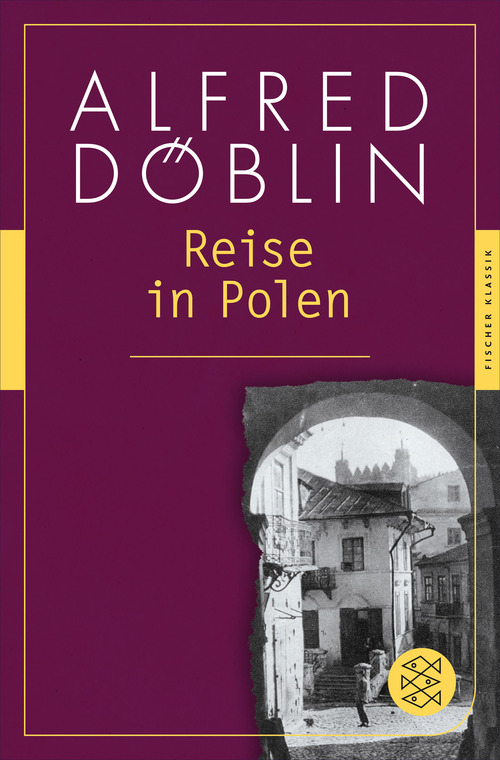
Alfred Döblin
Reise in Polen
FISCHER E-Books
Mit einem Nachwort neu herausgegeben von Marion Brandt

Im Exil erinnerte sich Alfred Döblin an seine ›Reise in Polen‹: »[I]ch fand, ich müßte mich einmal über die Juden orientieren. […] Ich fragte also mich und fragte andere: Wo gibt es Juden? Man sagte mir: In Polen.« Finanziert wurde seine Reise vom S. Fischer Verlag, in dem das Polenbuch erscheinen sollte, und der Vossischen Zeitung, die schon während der Reise einige Impressionen abdruckte. Döblin stieg am Abend des 25. September 1924 in Berlin am Schlesischen Bahnhof (dem heutigen Ostbahnhof) in den Zug, der ihn nach Warschau bringen sollte.
Döblins ›Reise in Polen‹, die hier erstmals auf der Grundlage einer textkritischen Sichtung aller relevanten Überlieferungsträger ediert wird, ist dann in der Tat eine reichhaltige, bewegende ›Orientierung‹ über das jüdische Leben in Polen geworden. Darüber hinaus aber ist es auch das vielschichtige Porträt einer jungen Republik. Döblins Reisebericht bot Schriftstellern und Publizisten Inspiration, die Polen noch viele Jahrzehnte nach Döblin bereisten – unter ihnen Hans Magnus Enzensberger und Reto Hänny. Mit seinem Reichtum an Informationen und Bildern aus einer heute nicht mehr existierenden Welt, aber auch mit seiner polemischen Subjektivität wird Döblins Polenbuch sicherlich weiterhin inspirierend wirken.
Alfred Döblin wurde am 10. August 1878 in Stettin an der Oder geboren. Nach dem Studium der Medizin arbeitete er fünf Jahre lang als Assistenzarzt und eröffnete 1911 in Berlin eine eigene Praxis. Nach der Veröffentlichung erster Erzählungen, darunter ›Die Ermordung einer Butterblume‹, erschien Döblins erster großer Roman, ›Die drei Sprünge des Wang-lun‹, im Jahr 1915/16 bei S. Fischer. Sein größter internationaler Erfolg war der 1929 ebenfalls bei S. Fischer publizierte Roman ›Berlin Alexanderplatz‹. 1933 flüchtete Döblin vor dem Nationalsozialismus nach Zürich. Die meiste Zeit seiner Jahre im Exil verbrachte er in Frankreich und den USA. Aus dem Exil zurückgekehrt, lebte Döblin zunächst wieder in Deutschland, zog dann aber 1953 mit seiner Familie nach Paris. Alfred Döblin starb am 26. Juni 1957.
Covergestaltung: bilekjaeger
Coverabbildung: Jan Bulhak, ›Burgtor in Lublin‹, 1921/Ośrodek Brama Grodzka - Theatre NN Centre Collection
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2016
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403305-1
»Denn eine Grenze hat Tyrannenmacht«:
Allen Staaten gesagt
Und dem Staat überhaupt
Sie sitzen jetzt in
ihren eigenen Häusern.
Im langen Eisenbahnwagen schaukle ich über die Schienen. Der Zug ist wie ein Pfeil von Berlin losgelassen. Der Schienenstrang ist unendlich. Nun schieße ich, schaukle mit Holz- und Eisenwerk, in einer gurgelnden Röhre, in die Nacht hinein. Die Wagen federn. Ein Durcheinander von Geräuschen hat angefangen, rhythmische Stöße, von den Rädern herauf, Vibrieren, Rollen, Fensterklirren, Sausen, hohles Schleifen, Schurren, kurzes, helles Aufschmettern.
Ich – bin nicht da. Ich – bin nicht im Zug. Wir prasseln über Brücken. Ich – bin nicht mitgeflogen. Noch nicht. Ich stehe noch am Schlesischen Bahnhof. Sie stehen um mich herum, aber ich bin dann eingestiegen, sitze auf dem grünen Polster, zwischen Lederkoffern, Handtaschen, Plaids, Mänteln, Schirmen. Ich bin gefangen. Der Zug trägt mich fort, hält mich fest, schwankt mit mir über die Schienen in die Nacht.
Aus dem Fenster, über diese Metallstange, hatte ich hinausgesehen. Jetzt – stehen zwei junge Männer da, ziehen den Vorhang herunter, stecken sich Zigaretten in den Mund, rauchen, plaudern in einer fremden Sprache. Haben hellgraue Zwirnhandschuhe an, Reisemützen über den beweglichen dunklen Augen, lächeln. Einer zeigt auf die Zeitung, die er unter dem Arm hat. Ein älterer kommt hinzu, beleibt. Das fremde Parlieren, Zungen-R, Zischlaute, geht weiter. Jetzt machen sie Platz. Ein kleines Mädchen, die Beine weißnackt bis zur Mitte der Oberschenkel, feine Lackschuhe, loses kurzes Samtkleid, offenes Schwarzhaar, geht vorüber, hält sich rechts und links im Gang. Sehr ernst, traurig blickt sie vor sich.
Ich – bin nicht da. Die Zeitung liegt auf meinen Knien. »Der Triumphzug des Zeppelin«, lese ich, mit aufsteigendem heftigen Bangen, beinah mit Schmerz. Der Zug, das hallende Gebäude, fährt mich nach Osten. Dies ist noch Deutschland, ich bin doch noch fast zu Hause, hier kommt Frankfurt an der Oder: – ich kann es nicht glauben, erkenne das Land nicht wieder. Sie fahren alle. Das sind die Menschen, mit denen ich fahre. Der junge Mann, der an der Stange geplaudert hat, schlendert in mein Coupé, setzt sich neben mich. Er spricht. Eine Stimme, die sich an mich wendet. Meine Stimme kommt zu mir. Ich rücke die Koffer für die Nacht. Beklommen denke ich an Polen, lasse ihn davon sprechen. Ich denke an meine Absichten. Aber es sind jetzt nicht meine Absichten, ich erkenne sie nicht.
Nacht. Der Zug wogt um uns. Die Grenze kommt, drei Stunden östlich von Berlin. Die drei eleganten Herren sprechen gelegentlich eine andere Sprache als vorhin. Mir fallen eigentümlich suchende Augenbewegungen auf, eine Art, mit den Schultern zu zucken: sie gurren und singeln jiddisch. Stecken die Köpfe zusammen mit den englischen Reisemützen. Da hält der Zug. Ein feierlicher Akt beginnt. Die Tür am Ende des Waggons hat sich geöffnet, alle Reisenden sind aus dem Gang getreten. Zwei Männer in grünen Uniformen sind in den Waggon gestiegen, einer hinter ihnen in Zivil mit einem Heft. Sie nehmen die Paßbüchlein ab, notieren. Einer tritt in das Abteil, läßt die Koffer öffnen. Alles sehr still. Von Coupé zu Coupé wandern die Beamten. Der Zug rollt weiter. Schwarze Mitternacht ist geworden. Der Zug hält; ist es ein Bahnhof? Gespannte Stille. Wieder über den Teppich her drei Männer. Jetzt aber an der Spitze ein schwarz uniformierter Soldat, ein Polizist mit ungeheurem lackierten Kavalleriesäbel. Für den Paß gibt er Blechmarken. Das sind Polen, Männer, wohlgenährt, von gesunder Farbe, gutmütige Gesichter. Als wäre es Krieg, ergießen sich Scharen der Passagiere aus dem Zug. Wir müssen über finstere Bahnsteige, Treppen ab und auf, in Riesenholzschuppen, zur Zollstelle. Das ist schon Ausland. Der Zug hat die Grenze überfahren. Ich gehe schon auf fremdem Boden. So rasch ging das. Eben habe ich es noch erwogen, vor zwei Wochen, drei Wochen, zu Hause, es hin und her gehalten. Es war mein Plan. Jetzt steht es da, bewegt sich, ist nicht mehr in meinem Kopf, rollt um mich ab. Ich steige darin herum. Es ist jetzt gewaltiger als ich. Schrecklich diese Überführung eines Gedankens in die Sichtbarkeit.
Die Schilder an den Wänden auf der Treppe tragen Worte, Silben, deren Sinn ich nicht ahne. Heißen wahrscheinlich nur: der und der Zug fährt von dem Bahnsteig; aber in der fremden Sprache erregen, spannen sie mich. Wie sollte es nicht. Jetzt fange ich ja an zu verstummen, taub zu werden. – Weiter. Ich liege, dämmere – Stunden oder Minuten – zwischen der Leinewand des Schlafwagens. Graues Licht durch eine Vorhangslücke. Ich richte mich auf. Flache Felder huschen vorbei, kleine Wälder. An ein Wasser, unten an einer Holzbrücke, geht barfüßig eine Bäuerin, weißes Kopftuch. Was ist das? Rinderherden. Neue Ackerflächen. Viele weiße Gänse. Das ist Polen. Ein Trupp buntröckiger Weiber zieht über einen Weg, Ein alter grauer Bahnhof; man läuft über Schienen an den Zug heran. Mein Herz krampft sich zusammen. Ich schüttele mich.
Das Gesicht der Polinnen: breite Stirn, nicht hoch, das ganze Gesicht voll. Die Nasenwurzel tief ansetzend, manchmal mit fast sattelförmiger Vertiefung. Die Nase flach sich abdachend nach den Wangen; sehr kräftige Nüstern; die dunklen Öffnungen aufgestülpt. Der Mund breit und fleischig. Die Augen, unter starken, fast wagerechten Augenbrauen gerade nebeneinander, ziemlich weit voneinander abstehend. Ihre Figuren groß. Auf der Straße, unter dem Hut, sind sie von einer außerordentlichen Pikanterie. Die jungen Mädchen, Fräulein, jungen Frauen bevölkern in Scharen die Straßen, Arm in Arm, neben jungen Herren, steigen aus Droschken, spiegeln sich vor hellen Schaufenstern. Sie gleiten mit hellen und fleischfarbenen Strümpfen, eleganten Schuhen sehr graziös aus den Konditoreien, Restaurants, gehen die Kirchentreppen herunter. Gepudert, geschminkt, bemalt sind sie alle. Sie bewegen sich absichtslos auf den Trottoirs; es ist sicher, sie wissen die Pfeile des Kupido zu zielen. Im geschlossenen Raum verlieren sie.
Männer wie Frauen, vom reinen Typus, mit hellen und braunen Haaren. Die Männer massiv, kräftig, ja, es sind ganz gewaltige Exemplare darunter. Neben dem Hotel Bristol liegt ein Ministerpalais mit tiefem grünen Vorgarten. War früher Magnatenschloß, der Radziwill, dann Sitz des russischen Gouvernements. Ein Bronzestandbild des Fürsten Paskewitsch stand davor, Paskewitsch Eriwanskij, ein Geschöpf von Härte und Grausamkeit.
Es gab eine Revolution der Polen im Jahre 1830/31.
Großfürst Konstantin, der russische Oberbefehlshaber der polnischen Armee, sollte ermordet werden, die fremden Soldaten entwaffnet, das Land von Rußland losgerissen. Mißlang alles; in der Nähe Warschaus, bei Grochow, erlagen die unglücklichen Polen dem Russen Diebitsch, und noch einmal bei Ostrolenka. Auf Diebitsch folgte dieser Paskewitsch. Der gab den Rest, Warschau, Polen war hin.
Die Polen haben nichts vergessen. Sein Denkmal haben sie beseitigt. Vor dem neuen Sitz der polnischen Regierung aber stehen jetzt zwei lebendige Schutzleute in schwarzer Uniform mit großem Säbel und heruntergeschlagenem Sturmband. Lebende Kolossalgestalten. Ich betrachte sie jedesmal, wenn ich das Hotel verlasse.
»Krakauer Vorstadt« heißt eine Hauptstraße von Warschau, »Marschallstraße« die andere. Die Marschallstraße ist dicht bevölkert; in ihrem nördlichen Teil, dem Kinoviertel, überflutet. Elegante Geschäfte. Der Bahnhof wirft seine Massen aus. Die Straßenseiten zählen nach geraden und ungeraden Hausnummern. Sehr höflich nennt sich jedes Einzelhaus: eine zweiseitige Laterne springt über dem Torbogen vor, gibt Nummer und Straßennamen an, ist abends beleuchtet.
Vormittags durch die »Krakauer Vorstadt«. Viele Offiziere. In der Nähe ist der Generalstab; das Land befestigt sich stark; es hat Erinnerung. Die Offiziere grüßen mit zwei Fingern, bequem; die Untergebenen wenden salutierend den Handteller nach vorn. Ihre Mützen, lose flache Käppis auf französische Art, bauschig nach hinten gezogen und mit vier Ecken. Am Kragen vorn tragen sie silberne Raupen von wechselnder Form; auf den Achselklappen Sterne. Durchweg grünlich-gelbe Felduniformen. In den Schaukästen der Photographen der Straßen hängen Bilder von ihnen; sie tragen reichlich Orden und bunte Ordensbänder.
Die Polen haben noch nicht lange Militär, sind lecker danach. Elektrische fahren vorbei; rote Wagen mit Anhängern, gezeichnet an den Flanken mit dem Wappen Warschaus: ein Weib mit Fischleib und Fischschwanz, eine Undine, Sirene. Sie schwingt einen Säbel, hält einen Schild. An der Elektrischen hängen die Menschen, stehen auf den Trittbrettern, ja, schräg und schauerlich anzusehen, balancieren sie mit einem Bein auf dem hinteren Puffer. Sie schieben sich drin nach vorn; der Ausgang ist neben dem Führer. Was im Wagen steht, hält sich schwankend an Holzgriffen. In einer Weise, die keine deutsche Stadt kennt, jagen die Menschen hinter der Elektrischen her, springen im vollen Rasen auf und ab.
Soldatenmusik, langsam, feierlich getragen, eine Beerdigung. Und sie marschieren an mit blitzenden Blasinstrumenten; ein Soldat, barhäuptig, trägt ein großes Kreuz, Priester in weißem Ornat; der blumenbedeckte Leichenwagen. Die Menschen auf den Trottoirs ziehen die Hüte.
Ich gehe über den Damm; der ist mit Holzwürfeln gedeckt und hat tiefe Löcher. Da zeigen die Theater auf der Plakatsäule an der Ecke an, aber auch breite schwarzumrandete Todesanzeigen sind angeklebt, zu oberst das schwarze Kreuz, Palmwedel darunter. Obsthändler sitzen neben der Säule; haben ihre Äpfel und Birnen in großen aufklappbaren Glaskästen. Was tut die Bäuerin mit dem roten Kopftuch? Sie sitzt hinter ihrem Korb, hat den Kopf hängen, ist im Begriff, am hellen Tag einzuschlafen. Der Mann neben ihr hat die amtlichen Zigaretten, die »Papierosy«, in einem roten Kasten auf einem Stativ liegen.
Und wie ich an der Ecke stehe, nach rechts in die breite Querstraße schaue: welch abenteuerlicher Anblick. Diese verblüffende, ja verwirrende Erscheinung. Steht da ein ungeheures phantastisches Gebäude, eine russische Kathedrale. Noch eben fahren neben mir Droschken, flitzt ein Auto, schreien sie den »Curier Warschawski« aus, blitzen moderne Schaufenster. Und da gähnt – weiß Gott – gräßlich und lähmend die Steppe der Wolga. Es müßte alles stillhalten bei diesem Anblick. Da bäumt sich und ist erstarrt ein brustbeklemmendes Asien. Der Bau hieß Alexander-Newsky-Kathedrale. Achtzehn Jahre hat man ihn aufgerichtet. Soll fünf vergoldete Kuppeln gehabt haben; ein hoher Glockenturm stand frei daneben. Der Turm steht nicht mehr, die fünf Kuppeln sehe ich nicht. Nur mit sonderbaren turmartigen Rundbauten erhebt sich das Steingeschöpf von dem weiten Platz. Seinen großen Mittelturm, stumpf, platt, umringen kleinere. Weit greift das Wesen mit Vorbauten, Torgebäuden über den Platz vor. Ist eine Burg mit Zinnen. Bunte byzantinische Heiligenbilder hat man über die Türen gemalt. Aber tritt keiner ein. Das Haus ist im ganzen Umfang von einem Bretterzaun umgeben; Kinoplakate darauf; Schwellen liegen herum. Die Fenster des Riesenbauwerks leer, schwarz, viele mit Holz vernagelt, manche vermauert. Der Platz heißt der Sächsische Platz. Erschreckend, unheimlich finster beunruhigend wirkt die Erscheinung dieses Gebäudes, das jetzt abgerissen, abgetötet wird. Es ist etwas Schmerzlich-Ergreifendes, Rührendes im Anblick dieser Kirche, die einem Gott, einem doch tief geglaubten Gott, geweiht war, – und wie sie eben steht, zertrümmert man sie, als wäre sie böse.
Aber es ist noch etwas anderes. Ich merke es. Das hier, dieses Bauwerk, war nicht als Kirche gedacht, gewollt. Das sollte eine Faust sein, eine ganz und gar eiserne, die auf den besten Platz der Stadt niederfiel und deren Klirren man immer hören sollte. Diese Kirche war nicht zu übersehen. Das sollte noch mal ein Denkmal des Generals Paskewitsch sein. Was ist dieser Zaun? Der Käfig, das Gitter, hinter dem man ein Untier eingesperrt hat. Trauergefühl, Mitleid, aber ich kann der Lösung nicht widersprechen.
Der Stolz und das Lebensgefühl des befreiten Volkes ist groß. Nicht weit von dem Zaun steht auf einem niedrigen Steinsockel ein Poniatowski in Bronze. Man hat den polnischen Helden als Römer in abstrakter Toga formen müssen unter russischer Ägide; die alte Uniform sollte er nicht zeigen. Dann kam ein Aufstand, eine Niederlage der Polen; der siegreiche General erhielt das Denkmal geschenkt. Er nahm es auf sein Landgut nach Minsk; vorher zerlegte man den bronzenen Stolz der Nation, die Brücken waren zu schwach für das Gewicht. Auf seinem Gut in Schuppen verstaubten jahrzehntelang die Stücke; der Versailler Friedensvertrag zwang die Russen, sie herauszugeben. Jetzt glänzt der Held zu ihrer Freude wieder am Licht.
Man hat Straßen und Plätze der Stadt in Masse umbenannt, die Erinnerung an das alte Unglück und die Erniedrigung beseitigt. Nach den Dichtern Mickiewicz und Slowacki heißen vielbegangene Plätze. Eine große Straße nennt man »Traugutta«: Romuald Traugutt, Führer des dreiundsechziger Aufstandes, wurde in der Warschauer Zitadelle hingerichtet. Seit der hundertsten Wiederkehr des Todestages heißt der große Platz an der Hauptpost Napoleonsplatz.
Die »Krakauer Vorstadt« weiter nach Süden. Sonderbar das Gemisch dieser Menschen: elegante, großbürgerliche und aristokratische Geschöpfe, Studenten und Studentinnen mit weißem Stürmer und roter Schnur. Stark das Überwiegen von grobgekleideten Kleinbürgern, von Bauern und Bäuerinnen in roten geblümten Kopftüchern. Ein Mönch, barhäuptig, mit brauner Kutte und Pelerine, mit Seilen gegürtet, geht auf Sandalen, die Füße bloß, über das Trottoir; er hat einen braunschwarzen langen Bart. Am Tor der Kirche rechts, auf ihren Stufen kauern in einer Reihe alte Weiber, Bettlerinnen, auch eine junge Frau; sie streckt die linke Hand aus. Ein Schutzmann treibt eine üppige blondhaarige Dirne, mit weißem Schultertuch, über den Damm; sie spaziert gleichmütig in giftgrünen Schuhen. Flink laufen die Droschken; die Kutscher schlagen auf die Pferde ein. Langsam trotten dazwischen zwei Bauernwagen; die Seitenbretter der Wäglein stark nach außen gebogen; das Bäuerlein sitzt mit der Frau im Stroh in der Mitte, hält die Leine und zuckelt daran.
Ich stehe an einer Haltestelle, studiere die sehr höflichen Tafeln der Straßenbahn, die alle vorüberfahrenden Linien und ihre Route angeben. Da kommt im Gedränge gerade auf mich zu ein einzelner Mann mit bärtigem Gesicht, in schwarzem lumpigen Kaftan, schwarze Schirmmütze auf dem Kopf, lange Schaftstiefel an den Beinen. Und gleich dahinter, laut sprechend, in Worten, die ich als deutsch erkenne, ein anderer, ebenso schwarzrockiger, ein großer, mit breitem roten Gesicht, rote Flaumhaare an den Backen, über der Lippe. Redet heftig auf ein kleines armselig gekleidetes Mädchen ein, wohl seine Tochter; eine ältere Frau mit schwarzem Kopftuch, seine Frau, geht bekümmert neben ihr. Es gibt mir einen Stoß vor die Brust. Sie verschwinden im Gedränge. Man beachtet sie nicht. Es sind Juden. Ich bin verblüfft, nein, erschrocken.
Ich spreche auf einem Amt vor. Provisorische Räume, die Stadt ist zu klein für die Masse Behörden, die sie heranzieht. Draußen hölzerne Garderobenständer. Im Vorraum schlendern elegante Herren auf und ab, zu zweit Arm in Arm. Einer lehnt sich an einen Heizkörper, hat dann einen weißen Streifen am Rücken. Eine russische Szene: ein alter Herr sitzt am Telephon in einem Abteil, ein niederer Angestellter; ein Fremder kommt, fragt; sie verneigen sich tief voreinander. Ich gehe durch rote Vorhänge Treppen hinauf, über Gänge, an verstellten Kochherden vorbei. Ein gebildeter sehr ruhiger Mann spricht mit mir; er hat Soziologie in Berlin gehört. Er hilft mir sehr freundlich.
– Sie sitzen in ihren eigenen Häusern. Es ist ein ungeheures Ding. Garibaldi hatte die Völker Europas angerufen:
»Verlaßt Polen nicht!
Alle Völker haben die Pflicht, dieser unglücklichen Nation zu helfen, welche der Welt beweist, was die Verzweiflung vermag. Obgleich entwaffnet, ihrer besten Jünglinge beraubt, die bereits proskribiert oder eingekerkert sind, von einer großen Armee niedergehalten, erhebt sie sich wie ein Riese. Die Männer verlassen die Städte und werfen sich in die Wälder, entschlossen zu siegen oder zu sterben. Die Frauen stürzen sich auf die Schergen, welche ihnen ihre Kinder entführen, und kratzen ihnen die Augen aus.
Verlaßt Polen nicht! Wartet nicht, bis ihr wie sie zur Verzweiflung gebracht werdet – lasset nicht das Haus eures Nachbars brennen, wenn ihr wollt, daß man euch helfe den Brand löschen, der das eurige verzehrt.
Rumänen der Donau, Magyaren, Germanen, Skandinavier, ihr seid die kriegerische Vorhut der Völker in dem Kampfe bis zum Tode, welcher heute auf der ruhmreichen Erde eines Sobieski und Kosciuszko geliefert wird.
Dieser Kampf ist ein Kampf des Despotismus gegen das Recht – eine tragische Episode des Diebstahls, welcher von den drei Geiern des Nordens zum Verderben der Freiheit und des Lebens einer der bedeutendsten Nationen Europas begangen ist. Es ist ein Kampf der Unordnung, der brutalen Gewalt gegen die Ordnung des Menschen, welcher in seiner Hütte von der Arbeit seiner Hände leben will, einer Unordnung, welche so lange dauern wird, wie jeder nur an seinen Bauch denkt und seinen unglücklichen Nachbar unter der Keule des gekrönten Schlächters läßt.
Verlaßt nicht Polen! Ahmet wenigstens euren Tyrannen nach. Sie verlassen einander nicht.
Und du, Wächterin der Alpen, Sprößling der Männer vom Rütli, wirf deine republikanische Büchse in die Wagschale Europas, und du wirst wissen, was sie wiegt. Heute sind es die freien Völker, welche die Ordnung wieder in der Welt herstellen müssen, die gestört ist durch die Gelüste des Despotismus. Verlaßt Polen nicht! Wenn wir alle helfen, wie es unsere Pflicht ist, werden wir eine heilige Pflicht erfüllen, und die Welt kann sich der Wohltat der dann von Gott gesegneten menschlichen Rasse gemäß konstituieren.«
Die Polen selbst: »Und nun sprechen wir auch zu dir, du Moskowitische Nation. Unser uns überliefertes Losungswort ist Freiheit und Brüderlichkeit der Völker; deshalb verzeihen wir dir auch sogar den Mord unseres Vaterlandes, sogar das Blut von Praga und Oszmiana, die Gewalttaten auf den Straßen von Warschau, die Folterei in den Löchern der Zitadelle. Wir verzeihen dir, denn auch du bist im Elend, wirst gemordet, bist niedergedrückt, gefoltert; die Leichen deiner Kinder schaukeln auf den Galgen des Zaren, deine Propheten erfrieren im Schnee Sibiriens. Wenn du aber in dieser entscheidenden Stunde nicht Reue für die Vergangenheit und ein heiligeres Sehnen für die Zukunft in deiner Brust fühlst, wenn du in unserem Kampfe den Tyrannen, welcher uns mordet und dich zertritt, unterstützen wirst, dann wehe! Wehe dir! Denn angesichts Gottes und der ganzen Welt werden wir dich zu der Schande ewiger Untertänigkeit und zu den Foltern ewiger Knechtschaft verfluchen und dich zum schrecklichen Kampfe der Ausrottung herausfordern, zum letzten Kampfe der europäischen Zivilisation mit dem wilden asiatischen Barbarentum.«
– Sie sitzen jetzt in ihren eigenen Häusern. Denn eine Grenze hat Tyrannenmacht. – Es gilt nichts zu vergessen, auch sich nicht.
Ich habe ein amtliches Jahrbuch 1924 von Polen; ich will mich vor den Zahlen nicht fürchten. Dies Polen hat 1921 400000 Quadratkilometer Bodenfläche, und 27 Millionen Menschen sitzen darauf. Elf Millionen von diesen Menschen hat das alte Kongreßpolen gestellt, acht Österreich, vier Preußen. Fehlen noch vier: die besetzen das »Ostgebiet«, den Rayon Grodno, Wilna, Minsk, Wolhynien. Es macht 70,3 Menschen auf einen Quadratkilometer. In Deutschland sitzen sie etwa doppelt so dicht: 126,8. In England 152,8. Belgien 245,3. Ist also Platz in Polen. Immerhin staune ich, wie schwach besiedelt noch andere Staaten sind, etwa die skandinavischen, und Spanien hat auf einen Quadratkilometer gar bloß 42,2 Menschen sitzen, das europäische Rußland nur 22,1, und Finnland muß eigentlich ganz leer stehen: wohnen ganze 8,8 Menschen auf dem Quadratkilometer. Raum für alle hat die Erde.
Die polnischen Städte sind im letzten Jahrhundert lustig gewachsen: Warschau hatte 1860 etwa 150000 Menschen, nach 20 Jahren das Doppelte, und 1900 sind es an 700000. Frauen mehr als Männer: im Warschauer Gebiet 121 Frauen auf 100 Männer. Wird eine Kriegsfolge sein. Es gibt im Lande 400 katholische Kirchen mit 7000 Priestern.
Und noch eine Rubrik überfliege ich: Zahlen vom letzten Krieg. Dem dieser Staat seine Entstehung verdankt. Es gab zusammen aus allen Staaten 7 Millionen Tote, 14 Millionen Verwundete. Mobilisiert wurden 55 Millionen Männer. Es fehlen noch die Kranken, die der Krieg in der Heimat verhungern ließ. Und die Kinder, die die Millionen Männer nicht gezeugt haben. Ich zweifle nicht, die Zahlen werden rasch vergessen. Wenn nur die Toten sie nicht vergessen. Ich meine: die Toten unter den heute Lebenden. Die präsumptiven 7 Millionen von den 55, die ausrücken werden im nächsten Krieg. Oder die 70 von den 550 Millionen. Es gibt eine Befehls- und Rindviehtheorie für die menschliche Natur. Es gibt aber auch andere Theorien. Man kann auch wollen und denken. Die Gesetzbücher aller Länder sind selbst dieser Meinung; sie machen jeden für seine Taten verantwortlich. Dispensieren aber von dieser Verantwortlichkeit für gewisse Massenaktionen und gerade für solche, bei denen es um den Kopf geht. Niemand kann auf die Rechte anderer verzichten. Man soll nur für Dinge sterben, für die man auch leben will.
Aber ich mische mich nicht in die Privatsachen der Todeskandidaten.
Der einfache Straßenplan: von Norden nach Süden die großen Parallelstraßen »Krakauer Vorstadt« und Marschallstraße und ihre Verlängerungen. Im Süden Villen und Parks. Im Westen Wola, das Arbeiterviertel. Im Norden an der Weichsel die Altstadt mit dem Schloß. Westlich davon die Judenstadt.
Da ist eine alte Stadt mit Palais, Patrizierhäusern, langsam und intensiv verfallen; Russenwirtschaft hat die Zerstörung beschleunigt. Der Verfall einer alten vornehmen Welt läßt sich vom Schloß über den alten Markt in alle auslaufenden Straßen und in entfernte verfolgen. Da sind schrecklich-bröcklige Fronten, zerbrochene Fenster, dunkle Flure. Geht man aber hinein, so sieht man die Tür, die einen stutzig macht, einen Balkon mit schönem schmiedeeisernen Gitter, – Proletarierlumpen hängen darüber.
Moderne Gebäudereihen stehen einzeln, in Gruppen, sechs- bis achtstöckig. Manche Gegenden, um den Napoleonsplatz, an der Hauptpost, nach der »Neuen Welt« zu, sind im Zusammenhang modern. Dann wieder wuchten Ichthyosauren von heute und morgen neben rührenden versunkenen hinfälligen Steingroßmütterchen. Ich schlendere nach Norden die »Krakauer Vorstadt« zur Weichsel. Man hat den Strom, diese Kostbarkeit, außerhalb der Stadt gelassen; es ist vielleicht gut, denke ich mir, die Ufer liegen dann still und unberührt von diesen schrecklichen Gebäuden. Auf der Straße, im Kasten eines Photographen, betrachte ich das Bild eines Mannes ohne Schlips. Er blickt verschlagen. Das ist Witos, der ehemalige Minister. Er wollte auch als Großgrundbesitzer Bauer sein, hat so ohne Schlips die Königin von Rumänien empfangen. Drüben an der Ecke gegenüber der Buchhandlung gehen viele in ein großes Café. Sie stehen drin mit Hüten herum; früher war es schwarze Börse, was wird es jetzt sein? Es ist Mittag, warme Sonne, ich gehe ohne Mantel. Ein Sträfling in graugrünem Leinen wird geführt, ein Soldat mit Gewehr hinter ihm. Bald danach zwei Sträflinge, die Handknöchel aneinandergebunden. Auf dem Damm, hinter der Elektrischen begegnen sich zwei Männer. Sie schütteln sich heftig beide Hände. Sie küssen sich auf die Backen.
Musik von Norden vom Schloß her. Jungens laufen voraus, das Trottoir bewegt sich voll Menschen. Eine Kompagnie polnischer Infanteristen marschiert an, feldgrau, Tornister, Kochtöpfe hintenauf, Stahlhelme mit weißem Adler. Kräftige Burschen mit dem stumpfen Ausdruck aller marschierenden Soldaten.
Im Treiben zwischen den kleinen Leuten, den Bauern taucht immer wieder die polnische Frau der höheren Schicht auf, mit feinem Schuhwerk, stark bemalt, mit eleganten Bewegungen, unregelmäßige, sehr weiche bis üppige pikante Züge.
Ein mächtiges eisernes Gitter zäunt einen Rasen ab. Zwischen Bäumen und Blumenbeeten führen Treppen zum Sockel eines Denkmals. An den Seiten des Sockels schwarze geschmiedete Fackelhalter. Oben in größerer Höhe steht ein Mann, den die Inschrift nennt: Adam Mickiewicz, barhäuptig, in langem Rock, den Mantel umgeworfen, die rechte Hand sprechend vor der Brust, die linke hängend. 1885 unter der Russenherrschaft wurde das Denkmal ganz still enthüllt. Der Mann des Pan Tadeusz. Einer von denen, die die Seele des schon zerbrochenen Volkes wach hielten. Im Winter gehen die Bäume unter die Erde. Nun steht er hier, der in Konstantinopel gestorben ist. Jede polnische Stadt nennt Plätze, Straßen nach ihm.
Eine Kirche; Leute, die vorübergehen, machen das Kreuzeszeichen, ziehen den Hut. Ich gehe hinein, an dem Geistlichen vorbei, der einen Tisch mit Zetteln bewacht, lege Kleingeld hin, er scheint zu danken. Welche Pracht, Säulen, barocke Altäre, goldener Pomp. Eine ärmliche Frau kniet im Mittelgang. Das Bild einer Maria macht mich betroffen: sie schwebt auf einer Silbersichel, einem Mond. So verbinden sie ihre Seele und Gott mit der Natur; die Gottheit dämmert in die Natur hinein. Noch draußen habe ich das zauberische Bild vor Augen: die Göttin auf der Sichel, eine Mondgöttin.
Der Boulevard ist zu Ende an einem Platz mit einer hohen Steinsäule und einem alten gelblichen Bauwerk. Es ist das alte Schloß.
Ein alter kahlköpfiger feiner Konservator zeigt es mir, der französisch spricht. Wie er die Säle kennt, verliebt von den Gegenständen redet. Er läßt zurücktreten, demonstriert das schimmernde Sonnenlicht, das über den Saal herfällt. Terrassen mit hängenden Gärten sind der Pragaseite vorgelagert. Verschlampt haben die Russen das feine Gebäude, die delikaten Säle, haben Tünche, gelbe und rote, außen und innen über die Wände gegossen. Einen weiten Saturnussaal gibt es: der Metallsaturn trägt eine große Uhr tiefgebückt auf dem Rücken. Vieles haben die Russen weggenommen und nicht wiedergegeben.
Über Bretter gehe ich in den Kellerraum: eine Riesenbibliothek wird freigelegt; ein langes lichtes Gewölbe. Auf dem Hof hatten sie die alte Front verbaut, Bögen zugemauert.
Ein Wisent aus Metall, kolossales Tier, steht im Freien.
Zur Rechten schwingt sich mächtiges Eisenwerk, Brückenbögen. Das Ufer muß da sein. Elektrische schwenken herum. Das gelbliche Bauwerk, das Schloß, senkt sich zum Fluß herunter. Und das ist die Weichsel, der breite flache Strom. Keine Strömung: der Spiegel flinkert gleichmäßig. Gelbe Sandmassen treten dicht an die Oberfläche. Kleine Schiffe warten am Ufer. Die Sonne wirft den Schatten des Brückengitters über das Wasser. Das Ufer drüben ist sandig, grasbewachsen. Arbeiter lungern herum; Schienen, dampfende Lokomotiven. Lange geht man über diese Brücke, viele ärmliche Menschen wandern herüber. Ein Schutzmann thront am Ende auf seinem Braunen. In eine dürftige Gegend bin ich dann herübergekommen, die mich erfreut, wie alle trüben unordentlichen lebendigen Orte: an Kirchen, Palästen gleite ich zu rasch ab. Das ist Praga. Körbe schleppen Bäuerinnen in losen geblümten Leinenröcken. Juden in Kaftan, ihr suchender Blick, ihr schwerer latschiger wie klebriger Gang. Klobige Stiefel tragen sie, breite Hosen, von Schmutz bespritzt. Viele sind schmächtig, die meisten gebückt. Sie ziehen langsam zur Brücke.
Eine breite Allee führt rechts ab. Jämmerliches Pflaster, kleine Häuser mit unsauberen Fronten. Ein Spalt öffnet sich zwischen zwei Häusern: der Eingang zu Verkaufsständen. Es sind kleine rote Holzbuden, für Obst, Kleider, Stiefel. Die Menschen, die verkaufen, sind fast nur Juden. Manchmal steht eine ganze Familie hinter dem kleinen Tisch. Sie rufen die Käufer an. Haben oft nur einen Kasten, einen Korb. Manche Schilder nennen jüdische Frauennamen: Gitla, Freidla, Nicha, Chana, Estera. Wieviel leidende Gesichter, weißpergamentene Gesichtsfarbe, die Frauen mit unordentlichem Haar, ältere Frauen mit dicken Lippen, großen Augen, hängenden Backen von einer schrecklichen Häßlichkeit.
Im Süden der »Krakauer Vorstadt« aber dehnen sich die »Neue Welt« und die »Allee Ujazdowska«, schön, modern, mit wenigen Geschäften, Möbeln, Antiquitäten. Zuletzt ein Park und Lustschloß, das Poniatowskis. Über einen herbstlichen Teich sieht man hinüber zum Schlößchen, einer Art Sanssouci. Mitten im Wasser liegt es, nackte Rokokostatuen herum. Das Freilufttheater des Königs wird renoviert, hat eine Runde abgebrochener Säulen: man delektierte sich früher an künstlichen Ruinen. Das Amphitheater trägt einen ganzen Kranz antiker Statuen auf seiner Höhe; ich klage nicht, daß sie mit Holz verkleidet sind. Es gibt noch ein zweites Theater, das ist geschlossen. Sein Garten ist jetzt ein Café; Korbstühle, Tische auf dem lockeren gelben Sand, wenig Menschen. Sanfter Herbst. Ein junger Soldat hat seine Kappe neben sich auf den Tisch gelegt. Er hält auf dem Schoß beide Hände seiner jungen braunzöpfigen Freundin, die mich mit Glanzaugen anlächelt.
Nach Süden, an der Ecke der »Neuen Welt« und der breiten »Jerusalemer Allee«, hinter einer schönen Glasveranda ist ein Restaurant, das fällt mir abends auf. Viele kleine Glühbirnen sind in die Decke eingelassen. Das blinkt freundlich wie Sterne, erhellt die Straße. Nach links heißt der Boulevard nicht mehr »Jerusalemer Allee«, sondern »Allee des 3. Mai«. Hier wird gebaut, ein Bretterzaun sperrt die Straße ab bis auf einen Durchlaß für Passanten. Man will die Gegend regulieren, die Eisenbahn vom Hauptbahnhof hier unterirdisch eine Strecke durch die Stadt leiten, sie auf die andere Pragaseite führen. Das neue Reichstagsgebäude soll hier errichtet werden, jetzt tagt der Sejm in einem alten zaristischen Mädchengymnasium und Internat. Durch die schmale Öffnung des Bretterzaunes gehe ich, an einem langen Zaune vorbei.
»Allee des 3. Mai« heißt diese unfertige Straße. Es gab im alten Polen um die Zeit der großen französischen Revolution einen langen vierjährigen Reichstag. Unglück, Tod stand schon vor der Tür Polens. Alle Mißstände wurden schwer empfunden, diskutiert: »Die Viehrassen schlecht und entartet, die Äcker ausgesogen, voller Unkraut und Stein, Wiesen versumpft. Die Wälder unordentlich ausgehauen und gelichtet. Das Land durch unaufhörliche Kriege und Fehden der vergangenen Jahrhunderte, durch Feuersbrünste und Seuchen, durch mangelhafte Verwaltung entvölkert und entsittlicht. Der Bauernstand ganz verkommen. Ein Bürgerstand existiert kaum. Der Netzedistrikt fast entvölkert, Bromberg im Jahre 1772 mit keinen achthundert Einwohnern.« Die Konstitution vom 3. Mai 1791 hob das Wahlkönigreich auf, die Hauptquelle der Korruption im Staat, beseitigte fürchterliche Vorrechte des Adels: durch den Widerspruch eines einzelnen Beschlußfassungen zu verhindern. Das war eine schöne Konstitution; man kann schon Straßen nach ihr benennen. Das Jahr darauf fühlten sich einige polnische Fürsten bewogen, die alte »polnische Freiheit«, sie meinten ihre feudale Macht, zu schützen. Rußland applaudierte. Nach der Konföderation zu Targowice, die sie mit Rußland schlossen, hat man keine Straße benannt. Der Zar marschierte ins polnische Land, gegen den 3. Mai.
An dem Zaun schlendere ich in der Abenddämmerung entlang. Kinderwagen fahren nach Hause. Es gibt alte Leute, die Zeitungen lesen, Pärchen, die sich auf Bänken mit den Knien berühren. Der Zaun hört auf. Nun ein imposantes Bild, das mächtigste in Warschau, die »Brücke Josef Poniatowski«. Das Land unten weicht zurück. Man hat die Hügel und Erdwellen überbrückt, dann die Pfeiler und Bogen über die Weichsel geführt. Die Brücke beginnt vor mir. Von einer enormen Breite ist sie. Lange geht man schon, ehe man sich dem Wasser, der Weichsel, nähert. Diese Brücke ist des Wassers würdig. Wuchtige Torgebäude leiten sie ein, dann dehnt sich die prächtige Allee hin, die Brückentafel mit Schienensträngen, Trottoirs rechts und links. Unten klingelt die Elektrische, rechts Kohlenschuppen, dahinter in schwarzem Bogen die Silhouette eines Waldes. In der wachsenden Dämmerung steigen schwarz hinter mir und zur Linken Häuser auf, vereinzelt zuckt Licht in den Fenstern. Rauchende Fabrikschlote. Treppenhäuser führen abwärts, Frauen mit Obst sitzen darin. Ein weißer großer Stern erscheint am Himmel.
Dann ist ein Zaun quer über die Brücke gezogen; ich kann nicht weiter. Hier unten beginnt die Weichsel, und die Brücke ist zu Ende. Im Halbdunkel erheben sich mächtige nackte Brückenpfeiler aus dem schwerflüssigen Wasser. Um einige Pfeiler sind Gerüste gezogen. Die eigentliche Brücke ist gesprengt. Der Raum zwischen den Pfeilern ist leer, der große Strom zieht unbezwungen Wellen zwischen ihnen. Ich stehe lange, kehre um.
Es schlägt sechs. Furchtbar schnell, greifbar fällt die Dunkelheit herein. Rechts vor mir am Himmel ist noch helles Weiß. Den Mond hatte ich vorhin fahl, matt gesehen; jetzt steht da eine grelle, immer grellere Scheibe, ein kreisrundes blendendes Gelbweiß; Wolkenfetzen darüber. Über die Brücke sind elektrische Kandelaber gestellt. Sie hatten schon beim Hinweg weißlich geschienen, ich konnte über sie wegsehen. Jetzt lassen sie den Blick nicht los. Je mehr Dunkelheit, Schwärze hereinfällt, um so gewaltiger empört sich gegen sie ihr kugelförmiges, allseitig bedrängtes Licht. Im Raum zur Seite und vor mir ist keine Tiefe mehr. Rote Lichter blicken rechts und links aus der Stadt, auf die ich zugehe. Wo sind die Kirchtürme, Fabrikschlote?
Der alte Schlachtschitz, der feudale Mann des »Liberum veto«, ist ausgerottet in den hundert Exiljahren. Mieroslawski, ein Polenführer, sprach, bei einer Feier der Revolution von 1830, seine Landsmänner an, erst vom Zaren:
»Lernt Chemie, aber nur so viel, um Salpeter und Pulver für den Aufstand zu machen. Lernt Mechanik, aber nur so viel, damit ihr die Hebelgesetze versteht, um eure eingesargte Mutter aus dem Grabe zu heben. Lernt Musik, aber nicht, um die Saul-Wut des Zaren zu bändigen, sondern um den Sensenmännern aufzuspielen. Habt ihr Geld und Muße, so geht nicht in die Komische Oper der Lorettokirche, sondern in den Tempel Molières.« Dann aber stürzte er sich auf die gehaßten polnischen Herren: »Religion, Familie, Eigentum sind Götzen der Zivilisation; um ihn in Ansehen zu erhalten, sind die polnischen Grafen, Jesuiten, Juden aufs innigste mit dem Zaren verbunden … Spekulanten sind unsere Herren, welche durch scheinbare Emanzipierung des polnischen Volkes das Volk mit Vorsicht expropriieren, entwaffnen, immobilisieren und damit für den Nationalaufstand unfähig machen.« Er schmähte auf die westliche Scheinfreiheit.
Sogar die nationalistische Rechte nennt sich heute demokratisch.
Zum zweitenmal gehe ich an die Weichsel. Von der »Neuen Welt« zur Tamkastraße herunter, die nur teilweise bebaut ist. Den Weg ganz unten hat man nach Kosciuszko genannt, dem größten polnischen Revolutionär und Freiheitsmann; sein wilder Kopf steht auf den Banknoten.
Und rechts drüben am Wasser sehe ich dann die zerstörte Brücke, bei hellstem Tageslicht – wie ich es wünschte – vier Pfeiler, massiv steinern, zwei mit Gerüsten, ohne Bögen. Die Handschrift eines großen Faktums, des Krieges. Sehr lebendig steht die zerstörte Brücke. So ist zuletzt eine Riesengewalt, der Zar, aus dem Land gezogen. Ein immenses Bild, Historie ohne Buch, furchteinflößend, drohend und warnend.
In dem schwärzlichgrauen Wasser treten keilförmige Streifen auf vor dem Wind; sie wechseln. Greller Sonnenschein liegt auf den roten Kirchtürmen. Die Elektrische fährt drüben über die Brücke. Es geht sich schön und voller Frieden hier am Wasser. Kleine Leute spazieren mit Kindern auf dem Arm; man legt Wiesenplätze mit Bäumen, Sitzbänken an. Die schöngepflasterte Karowastraße mündet links, über Holztreppen klimmt sie zur Stadt an. Das Hygienische Institut an einer Ecke; weißbemützte Fräulein gehen hinein, Büchermappen unter dem Arm.
– Nachmittags trottet ein ärmlicher Leichenzug am Hotel vorbei. Der Sarg wird von zwei Männern auf einer einfachen Holzbahre getragen. Vor dem Hotel stürzt der vordere Träger, der Sarg ist im Kippen, Passanten springen, fassen ihn, schieben ihn zurecht. Die Elektrische hält. Die Trauernden, die mit einem Geistlichen vorangehen, merken erst allmählich, daß etwas in Unordnung ist, blicken sich um. Der vordere Träger richtet sich auf, wischt sich ab, sucht seine beschmutzte Mütze. Er dreht sich um, faßt zu. Während er widerwillig weitermarschiert, schimpft er über den andern gegen einen Arbeiter auf dem Trottoir.
– Die Stadt hat keine Musikcafés. Auch Cafés sind selten: eins gegenüber dem Hotel Bristol, ein Männer- und Geschäftscafé, ein kleines altes unten im Staatstheater, am Theaterplatz, und sonst einige; meist nur Konditoreien. Wundervolle kleine Kuchen, sehen aber nur so aus; ist oft ein unangenehmer Geschmack an ihnen. Den Kaffee servieren sie in Gläsern, gleich mit Milch und Zucker, wenn man »weißen« bestellt. Gut schmeckt er nicht; sind nicht groß darin. Die Restaurants, das ist ihr Raum. Da wird delikater musiziert und getafelt als in Deutschland. Eine rote Rübensuppe, Bartsch, trinke ich öfter, mit und ohne Ei. Alles mit Verve bereitet, schwungvoll und elegant serviert. Kellner und Boys in Rotten. Sie beginnen mit gewaltigem kalten Hors d’œuvre; haben Rendezvous mit mehreren Alkoholsorten polnischer Art, hochprozentigem Schnaps, der einem die Lippen verbrennt. Das Trinkgeld der Kellner ist abgelöst; man legt aber auf die bezahlte Rechnung noch etwas, wohl, damit das Papier nicht fortfliegt. Um drei Uhr geht das Essen los; dann wird die Musik aufgedreht, und was vorher aß, war Plebs. In der »Oase« esse ich das erstemal. Der Mund bleibt mir offen stehen bei der Musik. Mein Appetit ist schon schwach; spielt man aber so raffiniert – drei Mann, und einer blättert um –, bin ich ganz verloren. Zwischen Rehrücken und Toska komme ich um.
Wenig Rachitis auf der Straße, wenig krumme Beine bei Männern und Frauen und Mädchen. Ich frage erst ganz falsch: wer hat hierzuland die krummen Beine: Männer oder Frauen, Kinder oder Erwachsene? Die Beine krümmen sich erst im Westen.
Es ißt niemand auf der Straße, in der Elektrischen. Leute von guten Sitten rauchen nicht einmal draußen. Ein großartiges Kapitel. Nur wer das Stullenpapier kennt, weiß, was ich leide. In jede Elektrische kann man sich setzen, ohne in Furcht zu geraten, wenn ein Herr, eine Dame die Aktentasche öffnet und es, es herausnimmt, – der kauende schmatzende Mensch, die beißende, schluckende Bestie. Man flüchtet von Sitzbank zu Sitzbank, zuletzt auf den Perron, – in Deutschland. In Warschau ruht man in Gottes Hand.
Soupers nach dem Theater, Konzert, in den großen Restaurants, in die Nacht bis eins, zwei, drei. Wenige öffentliche Tanzlokale, keine Dielen. Fabelhafte Bonbons.
Kino, »Ossi Oswalda«. Ein Glück, nichts vom Text zu verstehen; sie flüstern ihn hier alle, sobald die Worte erscheinen; Rauschen, Zischen geht durch den Saal. Diese Musik beglückend; nichts als Klavier, zwei Geigen und eine Bratsche; lauter Bekanntes, auch Deutsches, aber wie vorgetragen. Schon gestern wachte ich mittags im Schlaf von solcher Musik auf. Durch das offene Fenster kam von unten Geigenmusik, erschütternd, bezwingend. Wie spielt man hier. O was können die Geigen singen. Wie klang durch den grauen Sprühregen den Hof herauf das Singen der Geigen. Und hier. Der Film gab – ich weiß nicht was. Ich sah nur ab und zu hin. Die Geigenmusik schlich mir himmlisch ins Blut. Wenn ich aufblickte, hatte die Oswalda wieder einen verführt; den Freund hatte sie verdorben, vor den Revolver getrieben; vor diesem da – wird sie rein. Einfache Liebesdinge, die »Handlungen« sind ganz gleichgültig, man kann die Situationen immer wieder sehen. Es ist das süße Leben.
Und welch schöne junge Männer, junge Mädchen sitzen neben mir, lassen sich schmeicheln von dem Film, lauschen getrieben, nachahmungssüchtig.
Nach Westen, nach Wola, in die Arbeitergegend. Am Ende der langen Chlodnastraße, die von Osten nach Westen führt, steige ich aus der Elektrischen. Die alte Stadtgrenze; zwei Torhäuschen stehen da. Die Straße stark belebt, es ist mittags zwei Uhr. Hier vor dem Torhäuschen ist ein berittener Schutzmann aufgepflanzt. Eine unordentliche große Masse Volk, Arbeiter, Bäurisches, bewegt sich herum. Wie ich rechts biege, werden die Massen dichter. Ich bin auf einem riesigen Arbeitermarkt. »Rogatka Kerceli« heißt er.
Erst zieht er sich durch eine Enge, dann hinten erweitert er sich. Am Eingang, an der Mauer drüben, stehen schon Männer mit Hosen, Pelzmänteln. Ein junger Arbeiter hält prüfend eine alte Hose in der Hand, zieht sie sich über seine. Jetzt betrachtet er eine Jacke, zieht sie auch über die eigene. Er ist zufrieden. Arbeiterfrauen in Kopftüchern kommen an, sie mischen sich unter die Frauen, die in Scharen herumstehen; die haben lebende Gänse auf dem Arm, Käfige mit Hühnern zu den Füßen. Händler tragen ganze Posten Umschlagtücher über den Schultern; andere halten lange Lederschäfte, hohe Schaftstiefel in den Händen. Die Männer haben auf dem Kopf braune und graue Schirmmützen aus Tuch. Rechts in den Häusern offene Läden; ich sehe nirgends Schaufenster; das Glas ist überall ausgehoben. Sie verkaufen Mehl und Grieß, sackweise steht es da. Mitten im Weg breiten zwei Frauen, die miteinander handeln, rote Steppdecken zwischen sich aus. Wagen, kleine und größere Handwagen, haben manche vor sich. Einer hat eine kleine Versammlung um sich; er schreit, schlägt. Hat Kämme auf der Wagenplatte; mit einem Knüppel schlägt er auf sie, daß sie wegspringen, ruft: »Sie platzen nicht«, so gut ist seine Ware. Das Gedränge, der Lärm.
Eine ganze Gasse von Händlern mit schwarzen Schaftstiefeln passiere ich, eine Allee von Obstkörben. Der Markt zieht sich tief hin, an der Mündung der Ogrodowastraße vorbei, rechts von Häusern begrenzt. Jetzt kommen Dutzende fester Verkaufsbuden: helle Brote liegen aus, riesige runde, Topfgeschirre. Zwischendurch kleine Buchläden. Frauen in bunten Kopftüchern bewegen sich draußen und sitzen in den Buden. Ganz hinten Stände mit Obst. Feigen sind da an langen Schnüren aufgereiht. Zuletzt die bunten herzerfreuenden Gemüsestände: Äpfel, rote Rüben, Mohrrüben, Bündel herabhängender Zwiebeln. Ich sehe: zwischen den Häuserreihen am Eingang bin ich auf einen viereckigen Platz geraten. Eine elegante junge Frau, mächtige Figur, im Pelz, gepudert, steht mitten in einem Gang. Ihr großer weißer Windhund hat es auf die Gans einer Bäuerin abgesehen. Sie hat den Hund an der Leine, er zerrt enorm. Die Bäuerin lacht, die Dame lacht, die Gans biegt vom Arm der Bäuerin den langen weißen Hals herunter, zuckt den gelben Schnabel nach dem Hund, der kläfft, springt hoch, ist außer Rand und Band. Eine erotische Szene, scheint mir, zwischen Bäuerin und Dame. Vorbei an Körben mit weißen Kohlköpfen.
Mitten durch den Markt dränge ich mich zurück. Buden mit Spielsachen. Musikinstrumente, Grammophone spielen; Töpferwaren, bunte Gläser. Bauern kaufen Schlösser, Seile. Von vorgestreckten Stöcken hängen Kinderjäckchen, Tücher; man muß sich bücken. Weiße Unterhosen mit Bändern, Hemden, Taschentücher, Buden mit Kleidern, Anzügen. Hier stehen schwarzbärtige Juden als Verkäufer, ältere jüdische Frauen. Massenhaft werden Lammfelle, Pelze angeboten. Man verkauft Essen aus Töpfen. Blonde plattgesichtige Bauern, schöne derbe Gesichter, auch Frauen, tauchen auf. Schokolade, Pfannkuchen werden ausgerufen. Junge polnische Mädchen spazieren suchend herum, Arbeiterinnen, Bäuerinnen, tragen feine Schuhe, aber ihre Beine sind – nackt. Erst glaube ich es nicht, dann sehe ich es oft; nach Bauernsitte laufen manche auch barfuß. Heftiger Streit zwischen zwei älteren Weibern wegen einer roten Kinderjacke. Kinder werfen mit Holzpfeilen. Im Gedränge Schutzleute, die den Kopf nach allen Seiten drehen. Einige Zivilisten, die ich treffe, scheinen Kriminalpolizisten zu sein; hier wird Dunkelerworbenes rasch verschoben.
Ich mache mich los, an dem Ausrufer mit den Kämmen vorbei, schlendre die Chlodnastraße nach Osten zurück. Ein drolliges Schauspiel an der Ecke, vor der Haltestelle der Elektrischen: ein fünfjähriger Junge hat seinen kleinen Bruder in eine sehr enge Obstkiste gesetzt. Der kann sich drin nicht bewegen, schreit, will seine Beine hochheben. Aber der Junge hat einen Strick durch ein Loch der Kiste gesteckt, gut geknotet und zieht nun das Brüderchen über das Trottoir. Der kleine Junge brüllt, der andere trottet vergnügt als Pferd. Man lacht, macht Platz.
Die Chlodna: hohe neuere Häuser, dann Lagerplätze hinter Zäunen, einstöckige verfallene Häuser, manche mit Resten von schmückenden Insignien. Die Straße kräftig mit Passanten, Wagen, Elektrischen belebt. Ein Kaftanmann schleppt einen Kasten mit Fensterscheiben: ein Glaser. Zwei große Schulmädchen in schwarzen Samtmützen, langen braunen Zöpfen, flanieren langsam vor zwei Schülern, die gestreifte Mützen tragen. Vorn kichern sie, hinten ist man ernst und unsicher. Die Mädchen verschwinden plötzlich in einem Haus. Die Jungen gucken durch ein Loch des brüchigen Haustores. Lautes Lachen drin, Grinsen draußen, Drücken an der Klinke. Dann öffnen die Jungen langsam das Tor, schlüpfen hinein. Mehr jüngere und ältere Mädchen kommen; drüben ein Mädchengymnasium. An einer Kirche vorbei.