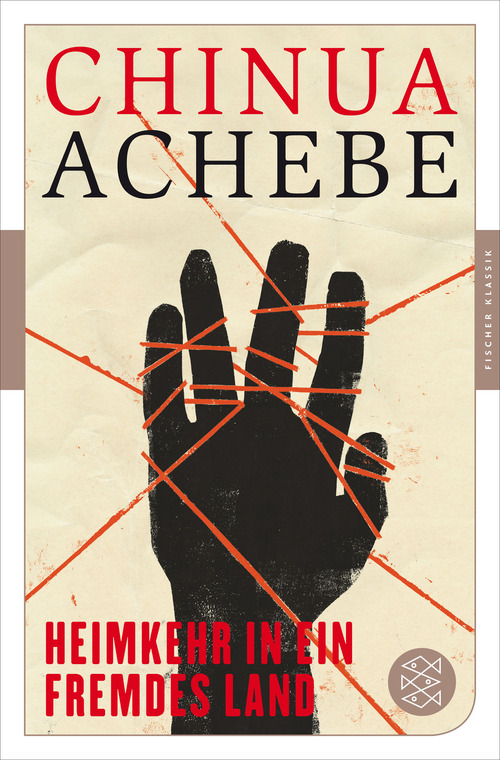
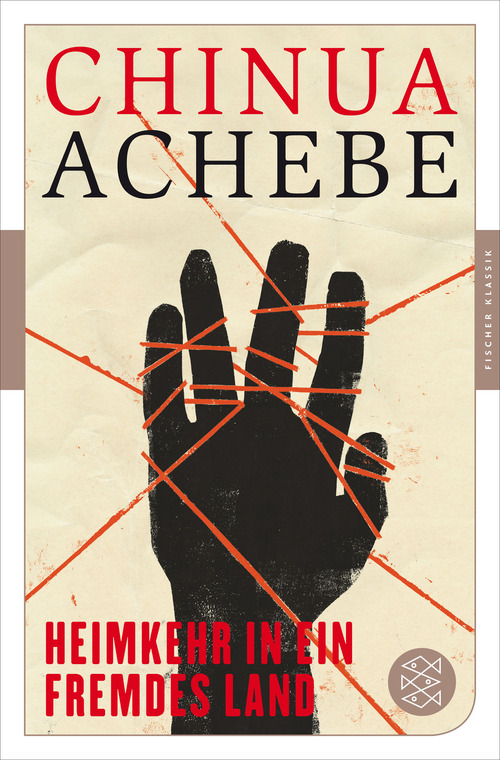
Chinua Achebe
Heimkehr in ein fremdes Land
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Koehler
FISCHER E-Books

Chinua Achebe wurde 1930 in Ogidi im Osten Nigerias als Sohn eines Katechisten aus dem Stamm der Igbo geboren. Er studierte am University College von Ibadan und lehrte seitdem als Professor an nigerianischen, englischen und amerikanischen Universitäten. 1958 erschien sein erster Roman ›Things Fall Apart‹, heute das meistgelesene Buch eines afrikanischen Autors. 2002 wurde Achebe für sein politisches Engagement mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt, 2007 erhielt er den Man Booker International Prize. Chinua Achebe starb 2013 in Boston.
Obi Okonkwo ist der Stolz seines Dorfes. Als bester Schüler des Igbo-Dorfes Umuofia im Osten Nigerias wird er von der Dorfgemeinschaft zum Studium nach England geschickt. Als Obi zurückkehrt, wartet ein Regierungsposten auf ihn. In einem korrupten Land, das ihm fremd geworden ist, gehört er nun zu einer Elite, die seine moralischen Grundsätze nicht teilt. Widerstreitende Kräfte zerren an ihm. Bedacht darauf, die Erwartungen seiner christlichen Familie zu erfüllen, der Tradition seiner Dorfgemeinschaft gerecht zu werden und den Anforderungen seines Jobs zu entsprechen, scheitert er.
»Chinua Achebe ist eine der kräftigsten und zugleich subtilsten Stimmen Afrikas in der Literatur des 20. Jahrhunderts, ein unnachgiebiger Lehrer und Moralist und vor allem ein großer Erzähler.« Börsenverein des Deutschen Buchhandels in der Begründung zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels
Abbildung: Edel Rodriguez
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1960 unter dem Titel
›No longer at ease‹ bei Heinemann, London
© Chinua Achebe 1960
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403462-1
Für Christie
Wir sind nach Haus gereist, in unser Land,
Und war’n nicht mehr zu Haus. Das Volk,
Das an den alten Göttern hängt, wie fremd war’s uns geworden.
Ich wünscht, ich war noch einmal tot.
aus: T. S. Eliot, Die Dreikönigsreise,
frei übersetzt von Egon Vietta, DIE ZEIT vom 9.1.1947
Vor drei oder vier Wochen schon hatte Obi Okonkwo begonnen, sich für diesen Augenblick zu wappnen. Als er dann an jenem Morgen auf der Anklagebank Platz nahm, war er der Meinung, auf alles vorbereitet zu sein. Er trug einen eleganten hellen Anzug und gab sich gelassen und gleichgültig. Der Verhandlung schien er wenig Interesse entgegenzubringen, abgesehen von einem kurzen Moment gleich zu Beginn der Sitzung, als einer der Anwälte eine Auseinandersetzung mit dem Richter hatte.
»Diese Gerichtsverhandlung beginnt um neun Uhr. Warum kommen Sie zu spät?« Jedes Mal, wenn Richter William Galloway, Richter am Obersten Gerichtshof von Lagos und Südkamerun, eines seiner Opfer anschaute, schien er es mit seinem Blick zu durchbohren, wie ein Sammler sein Insekt. Gleich einem angriffslustigen Hammel senkte er den Kopf und betrachtete über seine goldgeränderte Brille hinweg den Anwalt.
»Es tut mir leid, Euer Ehren«, stammelte der Mann. »Ich hatte eine Panne.«
Der Richter schaute ihn lange an und sagte dann unvermittelt: »Gut, Mr Adeyemi, ich akzeptiere Ihre Entschuldigung. Aber diese ständigen Entschuldigungen wegen angeblicher Fortbewegungsprobleme gehen mir langsam auf die Nerven.«
Unterdrücktes Lachen war von den Anwälten zu hören; ein mattes und graues Lächeln ging über Obi Okonkwos Gesicht, dann verlor er von neuem jegliches Interesse.
Der Gerichtssaal war berstend voll; überall saßen oder standen Leute. Der Prozess war seit Wochen das Stadtgespräch von Lagos, und an diesem letzten Verhandlungstag war jeder, der irgendwie seinen Arbeitsplatz verlassen konnte, hergekommen, um bei der Urteilsverkündung dabei zu sein. Einige Beamte hatten bis zu zehneinhalb Shilling für ein ärztliches Attest bezahlt, das sie für den Tag krankschrieb.
Selbst als der Richter seine Zusammenfassung des Falles vorzutragen begann, deutete nichts darauf hin, dass Obis Teilnahmslosigkeit geringer wurde. Erst als der Richter sagte: »Es ist mir unverständlich, warum ein junger Mann mit Ihrer Bildung und vielversprechenden Begabung so handeln konnte«, ging eine plötzliche und auffallende Veränderung mit Obi vor. Verräterische Tränen traten ihm in die Augen. Er holte ein weißes Taschentuch hervor und fuhr sich damit übers Gesicht, tat jedoch so, als wischte er sich den Schweiß ab. Er versuchte sogar, zu lächeln und die Tränen Lügen zu strafen. Ein Lächeln wäre ziemlich logisch gewesen, denn all das Gerede über Bildung und vielversprechende Begabung und Verrat kam für ihn nicht unerwartet. Er hatte es kommen sehen und genau diese Szene Hunderte Male durchgespielt, bis sie ihm so vertraut wie ein Freund geworden war.
Tatsächlich hatte Mr Green, sein Chef, als einer der Kronzeugen schon vor einigen Wochen, kurz nach Beginn des Prozesses, etwas über einen jungen Mann mit vielversprechender Begabung gesagt. Damals hatte es Obi völlig unberührt gelassen. Erst vor kurzem hatte er wie durch ein gnädiges Geschick seine Mutter verloren, und Clara war aus seinem Leben verschwunden. Diese beiden kurz aufeinanderfolgenden Ereignisse hatten Obi abgestumpft und einen anderen Mann aus ihm gemacht; einen Mann, den Worte wie »Bildung« und »vielversprechende Begabung« nicht berührten. Aber nun, im entscheidenden Augenblick, gaben ihn verräterische Tränen preis.
Schon seit fünf Uhr an jenem Nachmittag hatte Mr Green Tennis gespielt, und das war höchst ungewöhnlich. Normalerweise nahm ihn seine Arbeit so in Anspruch, dass er selten Zeit für ein Spiel hatte. Seine tägliche sportliche Betätigung bestand in einem kurzen Abendspaziergang. Aber heute hatte er mit einem Freund gespielt, der beim British Council arbeitete. Nach dem Spiel hatten sie sich an die Bar im Clubhaus zurückgezogen. Mr Green trug über dem weißen Hemd einen hellgelben Pullover, ein weißes Handtuch hatte er sich um den Hals gehängt. Noch viele andere Europäer waren in der Bar – einige lehnten an den Hockern, andere standen zu zweit oder zu dritt beisammen und tranken kaltes Bier, Orangenlimonade oder Gin-Tonic.
»Ich begreife nicht, warum er es getan hat«, sagte der Mann vom British Council nachdenklich. Er zeichnete mit dem Finger Linien auf sein beschlagenes, mit eiskaltem Bier gefülltes Glas.
»Doch, ich schon«, antwortete Mr Green geradeheraus. »Aber warum sich Leute wie Sie weigern, den Tatsachen ins Auge zu sehen, das kann ich wiederum nicht verstehen.« Mr Green war bekannt dafür, dass er aus seinen Ansichten keinen Hehl machte. Mit dem weißen Handtuch fuhr er sich über das rote Gesicht. »Der Afrikaner ist durch und durch korrupt.« Der Mann vom British Council schaute sich verstohlen um, mehr aus Instinkt als aus einer gegebenen Notwendigkeit heraus, denn obwohl der Club jetzt allen Afrikanern offenstand, wurde er nur von wenigen besucht. An jenem Nachmittag nun war kein einziger Afrikaner da, abgesehen natürlich von den Kellnern, die unauffällig bedienten. Es war durchaus möglich, den Club zu besuchen, etwas zu trinken zu bestellen, einen Scheck zu unterschreiben, sich mit Bekannten zu unterhalten und wieder wegzugehen, ohne die Kellner in ihren weißen Uniformen überhaupt wahrgenommen zu haben. Nahm alles seinen geregelten Gang, so übersah man sie.
»Sie sind alle korrupt«, wiederholte Mr Green. »Ich bin ganz für Gleichberechtigung und so weiter. Für mich persönlich wäre es ein Gräuel, wenn ich in Südafrika leben müsste. Aber Gleichberechtigung ändert nichts an den Tatsachen.«
»An welchen Tatsachen?«, fragte der Mann vom British Council, der noch verhältnismäßig neu im Lande war. Die allgemeine Unterhaltung verebbte ein wenig, denn viele der Anwesenden hörten unauffällig Mr Green zu.
»An der Tatsache, dass der Afrikaner seit unzähligen Jahrhunderten Opfer des schlechtesten Klimas der Welt und aller erdenklichen Krankheiten geworden ist. Dafür kann er nichts. Aber er ist deshalb geistig und körperlich ausgelaugt. Wir haben ihm westliche Bildung und Erziehung gebracht. Aber was nützt ihm das? Er ist …« Durch das Hinzukommen eines weiteren Bekannten wurde er unterbrochen.
»Hallo Peter, hallo Bill!«
»Grüß dich!«
»Hallo!«
»Darf ich mich zu euch setzen?«
»Natürlich.«
»Aber sicher. Was trinkst du, Bier? Gut. Ober! Ein Bier für den Herrn!«
»Was für eins darf es sein, Sir?«
»Heineken.«
»Sehr wohl, Sir.«
»Wir unterhalten uns gerade über den jungen Mann, der sich bestechen ließ.«
»Ach ja.«
Irgendwo im Hinterland von Lagos hielt die Progressive Union von Umuofia eine Dringlichkeitssitzung ab. Umuofia ist ein Dorf der Igbo in Ost-Nigeria und der Heimatort von Obi Okonkwo. Es ist kein besonders großes Dorf, doch für seine Bewohner ist Umuofia eine Stadt. Sie sind sehr stolz auf ihre Vergangenheit, in der Umuofia noch der Schrecken seiner Nachbarn war, ehe der weiße Mann kam und alle unterwarf und gleichmachte. Alle »Umuofianer«, wie sie sich nennen, die ihre Heimatstadt verlassen, um in den Städten ganz Nigerias Arbeit zu finden, betrachten sich dort stets als Besucher. Alle zwei Jahre kehren sie nach Umuofia zurück, um ihren Urlaub in der Heimat zu verbringen. Wenn sie genug Geld gespart haben, bitten sie ihre Verwandten zu Hause, ihnen eine Frau auszusuchen, oder sie bauen sich auf ihrem angestammten Land ein »Zinkhaus«, ein Haus mit Wellblechdach. Wo immer in Nigeria sie auch sein mögen, gründen sie einen Ortsverband der Progressiven Union von Umuofia.
In den vergangenen Wochen nun hatte die Union ihre Mitglieder mehrere Male zu einem Treffen zusammengerufen, um über den Fall von Obi Okonkwo zu beraten. Bei der ersten Zusammenkunft hatte eine Handvoll Leute die Meinung vertreten, für die Union bestünde keine Veranlassung, sich mit den Schwierigkeiten eines verlorenen Sohnes zu beschäftigen, der erst vor kurzem die Union in grober Weise missachtet habe.
»Wir bezahlten 800 Pfund für seine Ausbildung in England«, sagte einer von ihnen. »Aber anstatt dankbar zu sein, beleidigt er uns wegen eines unnützen Mädchens. Und jetzt ruft man uns wieder zusammen, um noch mehr Geld für ihn aufzubringen. Was fängt er denn mit seinem großen Gehalt an? Meiner Meinung nach haben wir schon viel zu viel für ihn getan.«
Obwohl man dieser Ansicht weitgehend zustimmte, wurde sie doch nicht allzu ernst genommen. Denn, so führte der Präsident aus, wenn ein Freund und Verwandter in Not sei, so müsse man ihm helfen und ihn nicht noch mehr schmähen. Ärger über einen Bruder schneide wohl ins Fleisch, könne aber dem Knochen nichts anhaben. Und so beschloss die Union, aus ihren Mitteln einen Rechtsanwalt zu bezahlen.
Doch an jenem Morgen hatte man den Prozess verloren, und aus diesem Grunde war erneut eine Dringlichkeitssitzung einberufen worden. Viele Menschen waren bereits im Haus des Präsidenten in der Moloney Street eingetroffen und unterhielten sich aufgeregt über das Urteil.
»Ich wusste, dass der Fall schlecht lag«, sagte der Mann, der sich von Anfang an dem Eingreifen der Union widersetzt hatte. »Wir werfen das Geld geradezu zum Fenster hinaus. Wie sagt man bei uns? Wer einem Nichtsnutz zur Seite steht, hat nichts davon als Schmutz und Unrat auf dem Kopf!«
Doch dieser Mann fand keine Anhänger. Die Männer von Umuofia waren bereit, bis zum Letzten zu kämpfen. Sie gaben sich keinerlei Illusionen über Obi hin. Er war zweifellos ein sehr törichter und eigenwilliger junger Mann, doch jetzt war nicht die Zeit, sich damit abzugeben. Zuerst muss der Fuchs verjagt werden, danach kann man das Huhn warnen, in den Busch hinauszulaufen.
Wenn die Zeit der Ermahnungen und Verwarnungen käme, würden die Männer von Umuofia dem jungen Mann gewiss ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß davon geben. Der Präsident sagte, dass es für einen Mann im höheren Dienst eine Schande sei, wegen zwanzig Pfund ins Gefängnis zu gehen. »Zwanzig Pfund«, wiederholte er und spuckte dabei aus. »Ich bin dagegen, dass Leute ernten, wo sie nicht gesät haben. Doch in einem unserer Sprichwörter heißt es, wenn einer eine Kröte fressen will, dann soll er sich wenigstens eine fette und saftige aussuchen.«
»Sein Mangel an Erfahrung ist an allem schuld«, warf ein anderer ein. »Er hätte das Geld nicht persönlich entgegennehmen dürfen. Üblicherweise wird einem zu verstehen gegeben, man solle das Geld dem Hausangestellten aushändigen. Obi versuchte, das zu tun, was alle tun, ohne die Spielregeln zu kennen.« Dann erzählte er die Fabel von der Ratte, die mit ihrer Freundin, der Eidechse, schwimmen ging und erfror, denn das Wasser drang nicht durch die Schuppen der Eidechse, und so blieb diese trocken, während der haarige Körper der Ratte nass wurde.
Als es so weit war, schaute der Präsident auf seine Taschenuhr und erklärte, dass es Zeit sei, die Versammlung zu eröffnen.
Alle standen auf, und er sprach ein kurzes Gebet. Danach bot er den Versammelten drei Kolanüsse an. Der älteste der anwesenden Männer brach eine der Nüsse und sprach dabei ein Gebet anderer Art. »Wer Kolanüsse bringt, der bringt Leben«, sagte er. »Wir trachten nicht danach, irgendjemand etwas zuleide zu tun, trachtet jedoch einer danach, uns etwas zuleide zu tun, so möge er sich den Hals brechen!« Die Gemeinde antwortete: AMEN. »Wir sind Fremde in diesem Land hier. Widerfährt ihm Gutes, so möge es uns daran teilhaben lassen.« AMEN. »Doch widerfährt ihm Böses, so soll es die Besitzer des Landes treffen; sie wissen, welche Götter es zu besänftigen gilt.« AMEN. »Viele Städte haben vier oder fünf oder sogar zehn ihrer Söhne in dieser Hauptstadt auf Posten, die früher Europäern vorbehalten waren. Umuofia hat nur einen einzigen Sohn dort. Und nun sagen unsere Feinde, dass selbst dieser eine zu viel sei. Doch unsere Ahnen werden sich damit nicht abfinden.« AMEN. »Die einzige Frucht eines Palmbaums geht selbst im Feuer nicht verloren.« AMEN.
Obi Okonkwo war in der Tat die einzige Frucht eines Palmbaums. Eigentlich hieß er Obiajulu – »Endlich hat er Frieden gefunden«; damit war freilich sein Vater gemeint, der, nachdem ihm seine Frau vier Töchter geboren hatte, bevor Obi zur Welt kam, verständlicherweise etwas besorgt war. Da er sich zum Christentum bekehrt hatte und sogar Religionslehrer war, konnte er keine zweite Frau heiraten. Doch er gehörte nicht zu den Männern, denen man die Sorgen am Gesicht ablesen konnte. Und vor allem würde er niemals die Heiden wissen lassen, dass er unzufrieden war. Er hatte seine vierte Tochter Nwanyidinma – »Ein Mädchen ist auch gut« – genannt. Doch seiner Stimme hatte es an Überzeugung gefehlt.
Der alte Mann, der in Lagos die Kolanüsse brach und Obi Okonkwo eine einzelne Palmfrucht nannte, hatte dabei allerdings nicht Okonkwos Familie im Sinn. Er dachte an das alte und kriegerische Dorf Umuofia. Vor sechs oder sieben Jahren hatten die Leute aus Umuofia ihre Union mit dem Ziel gegründet, Geld zu sammeln, um einige ihrer begabten jungen Männer zum Studium nach England schicken zu können. Sie hatten sich selbst erbarmungslos besteuert. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren war Obi Okonkwo das erste Stipendium gewährt worden. Sie bezeichneten es als Stipendium, obwohl das Geld zurückbezahlt werden musste. In Obis Fall handelte es sich um eine Summe von 800 Pfund, abzubezahlen innerhalb von vier Jahren nach seiner Rückkehr. Sie wollten, dass er Jura studierte, damit er später, wenn er wieder im Land wäre, alle gerichtlichen Auseinandersetzungen, die sie mit ihren Nachbarn um Grundbesitz führten, für sie übernehmen würde. Als Obi jedoch nach England kam, studierte er Englisch – seine Eigenwilligkeit war nichts Neues. Die Union war verärgert, doch schließlich ließen sie ihn in Ruhe. Auch wenn er kein Jurist wäre, so würde er doch einen »europäischen Posten« im Staatsdienst bekommen.
Die Auswahl des ersten Kandidaten hatte der Union keine Schwierigkeiten bereitet. Obi bot sich geradezu an. Im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren hatte er nach sechs Jahren Grundschule als Bester der ganzen Provinz das Abschlussexamen bestanden. Dann war ihm ein Stipendium für eine der besten höheren Schulen in Ost-Nigeria gewährt worden. Nach fünf Jahren bestand er das Cambridge School Certificate mit Auszeichnung in allen acht Fächern. Im Dorf war er eine richtige Berühmtheit, und in der Missionsschule, deren Schüler er einst gewesen war, beschwor man regelmäßig seinen Namen. (Heutzutage erwähnte niemand mehr, dass er einmal wegen eines Briefes, den er während des Krieges an Adolf Hitler schrieb, große Schande über die Schule gebracht hatte. Der Schulleiter hatte ihm damals fast unter Tränen klargemacht, dass er eine Schande für das Britische Empire sei und wenn er älter wäre, bestimmt für den Rest seines elendiglichen Lebens ins Gefängnis gewandert wäre. Da er aber damals erst elf Jahre zählte, kam er mit sechs Rohrstockschlägen auf die Hinterbacken davon.)
Große Aufregung hatte von Umuofia Besitz ergriffen, als Obi damals nach England ging. Einige Tage vor seiner Abreise nach Lagos beriefen seine Eltern eine große Gebetsversammlung in ihrem Haus ein. Pfarrer Samuel Ikedi von der anglikanischen Kirche St. Markus in Umuofia leitete die Versammlung. Er sagte, dieses Ereignis sei die Erfüllung des prophetischen Wortes:
Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande,
scheint es hell.
Seine Rede dauerte länger als eine halbe Stunde; dann bat er darum, dass jemand ein Gebet spräche. Mary war es, die sofort die Herausforderung annahm, noch ehe irgendjemand überhaupt Zeit gehabt hatte, aufzustehen, geschweige denn, die Augen zu schließen. Mary war eine der eifrigsten Christinnen in Umuofia und eine gute Freundin von Hannah Okonkwo, Obis Mutter. Obwohl Mary weit weg von der Kirche wohnte – es waren mindestens drei Meilen –, versäumte sie niemals den Frühgottesdienst, den der Pfarrer beim ersten Hahnenschrei abhielt. Auch mitten in der Regenzeit oder während des kalten Harmattan konnte man sicher sein, dass Mary da war. Manchmal kam sie über eine Stunde früher; dann blies sie ihre Stalllaterne aus, um Kerosin zu sparen, und legte sich auf den langen Lehmbänken in der Kirche schlafen.
»O Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs«, hob sie an, »Anfang und Ende. Ohne dich könnten wir nichts tun. Selbst der große Fluss ist für dich nicht groß genug, um deine Hände darin zu waschen. Dein ist die Yamwurzel, und dein ist das Messer – wir können nicht essen, du schneidest uns denn ein Stück ab. Wie Ameisen sind wir vor deinen Augen. Wir gleichen kleinen Kindern, die sich nur den Bauch waschen, wenn sie baden, und ihr Rücken bleibt trocken …«, und so redete sie weiter, leierte ein Sprichwort nach dem anderen herunter und entwarf ein Bild ums andere. Schließlich und endlich war sie beim Thema der Versammlung angelangt und behandelte es so ausführlich, wie es die Sache verdiente; neben vielem anderen trug sie den vollständigen Lebenslauf des Sohnes ihrer Freundin vor, der nun dorthin gehen würde, wo alles Lernen schließlich zum Ziel gelangte. Als sie fertig war, blinzelten die Leute und rieben sich die Augen, um sich wieder an das abendliche Licht zu gewöhnen.
Sie saßen auf langen, von der Schule ausgeliehenen Holzbänken. Vor dem Vorsitzenden stand ein kleiner Tisch, an dessen einer Seite Obi in Schul-Blazer und weißer Hose Platz genommen hatte.
Gebeugt unter der Last eines riesigen eisernen Kessels voll Reis, tauchten zwei Helfer aus dem Küchenbereich auf. Ein weiterer Kessel folgte. Dann brachten zwei junge Frauen einen Topf mit kochend heißem Fleischeintopf, den sie gerade vom Feuer genommen hatten. Kleine Fässchen mit Palmwein folgten und außerdem Teller und Löffel, die von der Kirche bei Hochzeiten, Geburtsfesten, Beerdigungen und anderen Ereignissen wie diesem ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden.
Mr Isaac Okonkwo hielt eine kurze Rede, mit der er seinen Gästen »diese kleine Kolanuss« überreichte. Nach den Maßstäben von Umuofia war er ein wohlhabender Mann. Fünfundzwanzig Jahre lang hatte er als Religionslehrer bei der Missionsgesellschaft gearbeitet und sich nun mit einer Pension von fünfundzwanzig Pfund im Jahr zur Ruhe gesetzt. Er war der Allererste gewesen, der in Umuofia ein »Zinkhaus« gebaut hatte. Deshalb kam es nicht unerwartet, dass er nun ein Fest gab. Doch keiner hatte etwas in diesem Ausmaß erwartet, nicht einmal von Okonkwo, der für seine Freigebigkeit, die zuweilen an Leichtsinn grenzte, bekannt war. Machte ihm seine Frau wegen seiner Verschwendungssucht Vorwürfe, so erwiderte er, ein Mann, der an den Ufern des Niger wohne, dürfe seine Hände nicht mit Spucke waschen – ein Lieblingsausspruch seines Vaters. Seltsamerweise wollte er von allem anderen, was mit seinem Vater zu tun hatte, nichts wissen; nur dieses eine Sprichwort war davon ausgenommen. Vielleicht hatte er schon lange vergessen, dass sein Vater es häufig benutzte.
Als das Fest zu Ende ging, hielt der Pfarrer wiederum eine lange Rede. Er dankte Okonkwo, dass er ihnen allen ein Fest ausgerichtet hatte, das größer war als manches Hochzeitsfest heutzutage.
Mr Ikedi war aus einer Stadtgemeinde nach Umuofia gekommen und konnte deshalb den hier Versammelten anschaulich von dem beständig fortschreitenden Verfall der Hochzeitsfeste in den Städten berichten, der mit der Erfindung von Einladungskarten begonnen hatte. Viele seiner Zuhörer pfiffen ungläubig, als er erzählte, dass man nur dann zur Hochzeit seines Nachbarn gehen konnte, wenn man eines dieser Papiere erhalten hatte, auf denen R.S.V.P. geschrieben stand – Reis und Soße, Verpflegung Prima –, was ausnahmslos übertrieben war.
Dann wandte er sich an den jungen Mann zu seiner Rechten. »In vergangenen Zeiten«, sagte er zu ihm, »hättest du für Umuofia in den Krieg ziehen müssen, um Menschenköpfe als Beute nach Hause zu bringen. Doch das waren Zeiten der Finsternis, aus denen uns das Lamm Gottes mit seinem Blut erlöst hat. Heute senden wir dich aus, um Weisheit zurückzubringen. Denke daran: Die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Aus anderen Städten habe ich von jungen Männern gehört, die in das Land des Weißen Mannes reisten, doch anstatt sich ihrem Studium zu widmen, jagten sie den süßen Verlockungen des Fleisches nach. Einige heirateten sogar weiße Frauen.« Heftiges Gemurmel bekundete die Entrüstung der Anwesenden über ein derartiges Verhalten. »Ein Mann, der so handelt, ist für sein Volk verloren. Er gleicht dem Regen, der sich an den Wald verschwendet. Ich hätte es gerne gesehen, dass man dir vor deiner Abreise eine Frau ausgesucht hätte. Aber dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Wie dem auch sei, ich weiß, dass wir in diesem Punkt bei dir nichts zu befürchten haben. Wir senden dich aus, um die Weisheit der Bücher zu erlernen. Das Vergnügen kann warten. Du hast keine Eile, dich in die Freuden der Welt zu stürzen – es könnte dir sonst wie der jungen Antilope ergehen, die sich lahmgetanzt hatte, ehe der Festtanz überhaupt begann.«
Er dankte Okonkwo erneut und auch den Gästen für ihr Erscheinen. »Wenn ihr seiner Einladung nicht gefolgt wäret, wäre unser Bruder in einer Situation wie der König in der Bibel gewesen, der zu einem Hochzeitsfest eingeladen hatte.«
Kaum hatte er sein letztes Wort gesprochen, als Mary auch schon ein Lied anstimmte, das die Frauen in ihrer Gebetsstunde eingeübt hatten.
Lass mich nicht allein, Jesus, warte auf mich, wenn ich aufs Feld gehe.
Lass mich nicht allein, Jesus, warte auf mich, wenn ich zum Markt gehe.
Lass mich nicht allein, Jesus, warte auf mich, wenn ich esse.
Lass mich nicht allein, Jesus, warte auf mich, wenn ich mein Bad nehme.
Lass mich nicht allein, Jesus, warte auf mich, wenn er in das Land des Weißen Mannes geht. Lass ihn nicht allein, Jesus, warte auf ihn.
Die Versammlung schloss mit dem gemeinsamen Lied »Lobet den Herren …«. Dann bedachten die Gäste Obi mit ihren Abschiedsgrüßen, und viele wiederholten all die guten Ratschläge, die man ihm bereits reichlich erteilt hatte. Sie schüttelten ihm die Hände und steckten ihm dabei ein kleines Geschenk zu – damit er einen Bleistift kaufen könne oder ein Schreibheft oder auch einen Laib Brot für die Reise; einen Shilling hier und einen Penny da – bedeutende Geschenke in einem Dorf, in dem Geld äußerst knapp war, in dem sich Männer und Frauen Jahr um Jahr abmühten, der unwilligen und erschöpften Erde ein mageres Auskommen abzuringen.
Obi hatte nicht ganz vier Jahre in England verbracht. Manchmal fiel es ihm schwer, zu glauben, dass es nur eine so kurze Zeitspanne gewesen war. Die vier Jahre waren ihm eher wie ein ganzes Jahrzehnt erschienen, zumal dann, wenn er wegen der Widerwärtigkeiten des Winters sein Heimweh als physischen Schmerz spürte. In England bedeutete ihm Nigeria zum ersten Mal mehr als ein Name, und das war das erste wirklich Wesentliche, was England für ihn tat.
Doch das Nigeria, in das er zurückkehrte, unterschied sich in vielerlei Hinsicht von dem Bild, das er während der vier Jahre in sich getragen hatte. Es gab vieles, das er nicht wiedererkennen konnte, und anderes – wie die Slums in Lagos –, das er zum ersten Mal sah.
Als Dorfjunge in Umuofia hatte er von einem Soldaten, der aus dem Krieg gekommen war und seinen Urlaub zu Hause verbrachte, zum ersten Mal von Lagos erzählen hören. Diese Soldaten waren Helden, die die große, weite Welt gesehen hatten. Sie redeten von Abessinien, Ägypten, Palästina, Burma und so weiter. Einige waren früher notorische Tunichtgute im Dorf gewesen, doch nun waren Helden aus ihnen geworden. Sie hatten haufenweise Geld, und die Dorfleute saßen ihnen zu Füßen und ließen sich Geschichten erzählen. Einer von ihnen ging regelmäßig ins Nachbardorf auf den Markt und bediente sich dort nach Belieben. Er zog in voller Uniform los, zerstampfte die Erde mit seinen Stiefeln, und keiner wagte es, ihn anzurühren. Es ging das Gerücht, man bekäme es mit der Regierung zu tun, wenn man einem Soldaten etwas antun würde. Außerdem war es ja bekannt, dass die Soldaten wegen der Spritzen, die sie in der Armee bekamen, stark wie Löwen waren. Von einem dieser Soldaten stammten Obis erste Eindrücke von Lagos.
»Dunkelheit gibt es dort nicht«, erzählte der Soldat seinem bewunderungsvoll lauschenden Publikum, »denn bei Nacht scheint das elektrische Licht so hell wie die Sonne. Die Leute spazieren ständig umher, das heißt, wenn sie zu Fuß gehen wollen. Möchte man nicht zu Fuß gehen, so winkt man nur mit der Hand, und sofort hält ein Luxusauto.« Verwunderung wurde unter den Zuhörern laut. Dann schweifte er ab und sagte: »Wenn du einem weißen Mann begegnest, musst du den Hut vor ihm ziehen, denn er kann alles. Er kann zwar keine menschlichen Wesen herstellen, aber sonst alles.«
Noch lange Jahre danach verband Obi die Vorstellung von Lagos stets mit elektrischer Beleuchtung und Autos. Selbst nachdem er endlich die Stadt besucht und vor seinem Flug in das Vereinigte Königreich einige Tage dort verbracht hatte, änderte sich seine Ansicht kaum. Freilich lernte er Lagos damals nicht wirklich kennen. Sein Denken war sozusagen auf Höheres gerichtet! Die wenigen Tage in der Stadt verbrachte er mit seinem »Landsmann« Joseph Okeke, einem Büroangestellten im Staatlichen Vermessungsamt. Obi und Joseph waren Klassenkameraden in der Hauptschule der Christlichen Missionsgesellschaft – CMS – in Umuofia gewesen. Doch Joseph hatte danach nicht die höhere Schule besucht, denn er war schon zu alt dafür gewesen, und seine Eltern waren arm. Er hatte im Ausbildungskorps der 82. Division gedient und war nach Kriegsende in den Staatsdienst getreten.
Joseph war zum Busbahnhof von Lagos gekommen, um seinen vom Glück begünstigten Freund abzuholen, der auf seinem Weg ins Vereinigte Königreich in Lagos haltmachte. Er brachte ihn in seine Wohnung in Obalende. Diese Wohnung bestand nur aus einem einzigen Zimmer. Ein hellblauer Vorhang teilte den Raum in seiner ganzen Breite und trennte das »Allerheiligste« (wie Joseph sein Doppelbett mit Sprungfedermatratze nannte) vom Wohnbereich. Seine Kochutensilien, Schachteln und andere persönliche Dinge lagen gut versteckt unter dem Allerheiligsten. Den Wohnbereich nahmen zwei Sessel, ein Sofa (lief auch unter dem Namen »mein Mädchen und ich«) und ein runder Tisch ein, auf dem Joseph sein Fotoalbum liegen hatte. Nachts schob der Hausdiener den runden Tisch beiseite und breitete seine eigene Schlafmatte auf dem Fußboden aus.
Joseph hatte Obi an diesem ersten Abend in Lagos so viel zu erzählen, dass es bereits nach drei Uhr war, als sie endlich einschliefen. Er berichtete ihm alles Wissenswerte über Kinos, über Tanzlokale und über politische Versammlungen.
»Tanzen ist heutzutage äußerst wichtig. Kein Mädchen dreht sich nach dir um, wenn du nicht tanzen kannst. Joy habe ich in der Tanzschule kennengelernt.« »Wer ist Joy?«, fragte Obi, der von allem, was er über diese fremde und sündige Welt erfuhr, fasziniert war. »Sie war – Moment mal …«, er zählte die Monate an den Fingern ab, »… März, April, Mai, Juni, Juli – sie war fünf Monate lang meine Freundin. Diese Kissenbezüge hier hat sie mir gemacht.«
Wie von selbst erhob sich Obi, um das Kissen zu betrachten, auf dem er lag. Es war ihm schon früher am Tag aufgefallen. Das seltsame Wort KNUTSCHKISSEN war darauf gestickt, jeder Buchstabe in einer anderen Farbe.
»Sie war ein nettes Mädchen, zwar manchmal etwas dumm, aber ich wünschte, wir wären nicht auseinandergegangen. Ganz verrückt war sie nach mir, und als ich sie kennenlernte, war sie noch Jungfrau, das ist hier selten.«
Joseph redete und redete, bis seine Worte schließlich immer mehr an Zusammenhang verloren; dann verwandelte sich sein Gerede übergangslos in tiefes Schnarchen, das bis zum Morgen andauerte.
Gleich am nächsten Tag machte Obi einen unfreiwilligen Spaziergang auf der Lewis Street. Joseph hatte eine Frau mit nach Hause gebracht, und es war eindeutig, dass Obis Anwesenheit nicht erwünscht war. Deshalb ging er spazieren und wollte sich dabei ein wenig umsehen. Das Mädchen war eine von Josephs neuesten Eroberungen, wie dieser ihm später erzählte. Sie war dunkelhäutig und groß, mit einem riesigen, aufgeblasenen Busen unter einem engen, rot und gelb gemusterten Kleid. Ihre Lippen und langen Fingernägel waren von leuchtendem Rot, ihre Augenbrauen feine schwarze Linien. Sie ähnelte den hölzernen Masken, die man in Ikot Ekpene herstellt. Ihre ganze Erscheinung hinterließ einen schlechten Geschmack in Obis Mund, genauso wie das vielfarbene Wort KNUTSCHKISSEN auf dem Bettbezug.
Als Obi einige Jahre später, kurz nach seiner Rückkehr aus England, eines Abends in einem der nicht ganz so heruntergekommenen Slumgebiete von Lagos neben seinem Wagen auf Clara wartete, die viele Meter Kleiderstoff zu ihrer Näherin brachte, erinnerte er sich an seine früheren Eindrücke von der Stadt. Er hatte sich damals nicht vorstellen können, dass es ein Nebeneinander von Stadtteilen wie diesem hier und den schönen Autos, der elektrischen Beleuchtung und den buntgekleideten Mädchen geben könne.