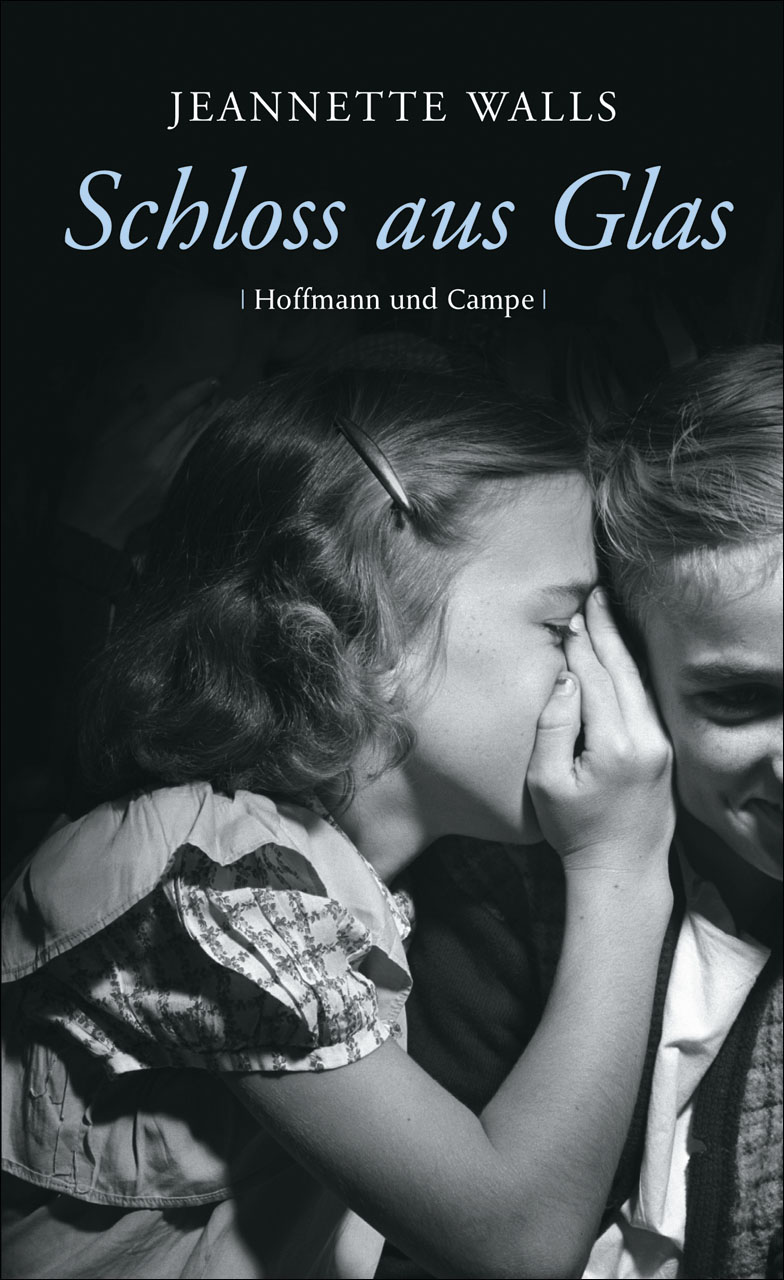
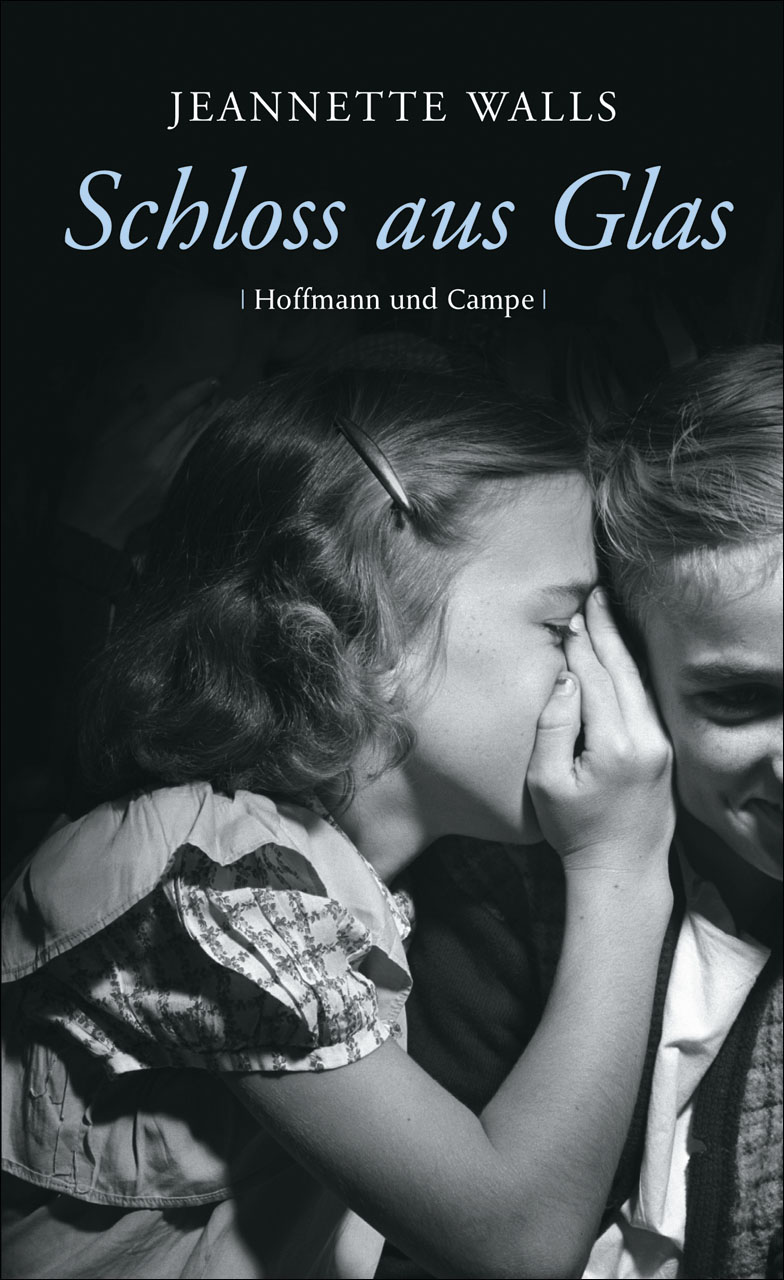

Foto: John Taylor
Jeannette Walls wurde in Phoenix, Arizona, geboren. Sie studierte am Barnard College und arbeitete über zwanzig Jahre als Journalistin in New York. 2005 erschien ihr internationaler Bestseller Schloss aus Glas, der in dreiundzwanzig Sprachen übersetzt wurde. Eine Kinoverfilmung ist in Arbeit. Ein ungezähmtes Leben, die 2009 veröffentlichte Romanbiographie über ihre Großmutter, belegte jahrelang die deutschen Bestsellerlisten. Im Herbst 2013 erschien von ihr bei Hoffmann und Campe der Roman Die andere Seite des Himmels. Walls lebt mit ihrem Mann in Virginia.
Für John, der mich davon überzeugt hat,
dass jeder, der interessant ist, eine Vergangenheit hat.
Dunkel ist ein Weg und Licht ist ein Ort,
Himmel, der niemals war
Noch jemals sein wird, ist immer wahr.
Dylan Thomas
Ich nestelte an meiner Perlenkette und fragte mich, ob ich nicht doch zu elegant für die Party angezogen war, als ich aus dem Taxifenster schaute und Mom sah, die gerade einen Mülleimer durchwühlte. Es war ein stürmischer Märzabend, und es dämmerte schon. Der Wind peitschte den Dampf, der aus den Kanaldeckeln aufstieg, und die Menschen hasteten mit hochgeklappten Mantelkrägen über die Bürgersteige. Ich steckte im Stau, zwei Häuserblocks von dem Restaurant entfernt, wo die Party stattfand, zu der ich eingeladen war.
Mom stand höchstens vier Meter weg von mir. Zum Schutz gegen die Frühjahrskälte hatte sie sich Lumpen um die Schultern gewickelt, und sie inspizierte den Abfall, während ihr Hund, ein schwarzweißer Terriermischling, zu ihren Füßen spielte. Moms Bewegungen waren mir so vertraut – die Art, wie sie den Kopf schief legte und die Unterlippe vorschob, wenn sie irgendetwas aus dem Mülleimer gefischt hatte und auf seinen Wert hin untersuchte, die Art, wie ihre Augen vor kindlicher Freude ganz groß wurden, wenn sie etwas gefunden hatte, das ihr gefiel. Ihr langes Haar hatte graue Strähnen und war ungekämmt und verfilzt, ihre Augen lagen tief in den Höhlen, aber sie erinnerte mich noch immer an die Mom, die sie für mich als Kind gewesen war, die Kopfsprünge von Klippen machte, in der Wüste malte und laut Shakespeare las. Ihre Wangenknochen waren hoch und kräftig, doch die Haut war von all den Wintern und Sommern, die sie ungeschützt den Elementen ausgesetzt gewesen war, ausgedörrt und gerötet. Für die Menschen, die an ihr vorbeigingen, sah sie wahrscheinlich genauso aus wie die unzähligen Obdachlosen, die durch die Straßen von New York streiften.
Es war Monate her, dass ich Mom gesehen hatte, und als sie aufblickte, überkam mich Panik, die Furcht, dass sie mich entdecken und meinen Namen rufen würde und dass jemand, der zu derselben Party unterwegs war, uns zusammen sehen könnte, dass Mom sich vorstellen würde und mein Geheimnis kein Geheimnis mehr wäre. Ich rutschte auf dem Sitz nach unten und sagte dem Fahrer, er solle wenden und mich zurück zur Park Avenue bringen.
Das Taxi hielt vor dem Haus, in dem ich wohnte, der Portier öffnete mir die Tür, der Fahrstuhlführer brachte mich hinauf zu meiner Etage. Mein Mann arbeitete noch, wie fast jeden Abend, und die leere Wohnung war still, bis auf das Klackern meiner Absätze auf dem glänzenden Parkettboden. Ich war noch immer aufgewühlt von der unerwarteten Begegnung mit meiner Mutter, von dem Anblick, wie sie munter den Mülleimer durchstöberte, und ich legte eine Vivaldi-CD auf, hoffte, dass mich die Musik beruhigen würde.
Ich ließ den Blick durch die Wohnung wandern. Über die bronze- und silberfarbenen Vasen aus der Jahrhundertwende und die alten Bücher mit abgegriffenem Ledereinband, die ich auf Flohmärkten erstanden hatte. Über die alten Landkarten von Georgia, die ich gerahmt hatte, die persischen Teppiche und den wuchtigen Ledersessel, in den ich mich abends so gern fallen ließ. Ich hatte versucht, mir hier ein Zuhause zu schaffen, hatte versucht, die Wohnung so zu gestalten, wie der Mensch, der ich sein wollte, sie gern hätte. Aber es gelang mir nicht, mich hier wohl zu fühlen, ohne mir Gedanken um Mom und Dad zu machen, die auf irgendeinem U-Bahn-Schachtgitter kauerten. Ich sorgte mich um sie, aber sie waren mir auch peinlich, und außerdem schämte ich mich dafür, dass ich Perlen trug und auf der Park Avenue wohnte, während meine Eltern damit beschäftigt waren, irgendwo ein warmes Plätzchen und etwas zu essen zu finden.
Aber was sollte ich machen? Ich hatte schon zahllose Male versucht, ihnen unter die Arme zu greifen, aber Dad beharrte stets darauf, dass sie nichts brauchten, und Mom bat immer nur um irgendwelche albernen Kleinigkeiten wie einen Parfümzerstäuber oder ein Fitnessstudio-Abo. Beide beteuerten, dass sie genauso lebten, wie sie leben wollten.
Doch nachdem ich im Taxi den Kopf eingezogen hatte, damit Mom mich nicht sah, empfand ich so einen Abscheu vor mir selbst – meinen Antiquitäten, meinen Kleidern und meiner Wohnung –, dass ich irgendwas tun musste. Ich rief eine Freundin von Mom an und hinterließ eine Nachricht für sie. Das war unser System, wie wir in Kontakt blieben. Es dauerte immer ein paar Tage, bis Mom zurückrief, und die Woche war fast um, als sie sich meldete. Sie klang wie immer gut gelaunt und locker, als hätten wir uns erst tags zuvor zum Lunch getroffen. Ich sagte, dass ich mich mit ihr treffen wolle, und lud sie zu mir nach Hause ein, aber sie wollte lieber in ein Restaurant. Sie ging für ihr Leben gern essen, also verabredeten wir uns zum Lunch bei ihrem Lieblingschinesen.
Mom saß schon da und studierte die Speisekarte, als ich eintraf. Sie hatte sich extra ein bisschen zurechtgemacht. Sie trug einen sackartigen grauen Pullover, der nur ein paar helle Flecken hatte, und schwarze Herrenschuhe aus Leder. Sie hatte sich das Gesicht gewaschen, doch Hals und Schläfen waren noch immer dunkel von Schmutz.
Sie winkte begeistert, als sie mich sah. »Da ist ja meine Kleine!«, rief sie. Ich küsste sie auf die Wange. Mom hatte die ganzen Plastikpäckchen mit Sojasauce und Ketchup und Senfsauce vom Tisch in ihrer Handtasche verschwinden lassen. Nun kippte sie auch noch eine Holzschale mit Trockennudeln hinein. »Ein kleiner Happen für später«, erklärte sie.
Wir bestellten, und Mom nahm etwas mit Meeresfrüchten. »Du weißt ja, ich liebe Meeresfrüchte«, sagte sie.
Mom fing an, über Picasso zu reden. Sie hatte sich eine Retrospektive von ihm angesehen und fand, dass er völlig überbewertet wurde. Das ganze kubistische Zeug sei ihrer Meinung nach nichts als Firlefanz. Nach seiner rosa Periode habe er nichts Nennenswertes mehr zustande gebracht.
»Mom, ich mache mir Sorgen um dich«, sagte ich. »Sag mir, wie ich dir helfen kann.«
Ihr Lächeln erstarb. »Wie kommst du darauf, dass ich deine Hilfe brauche?«, sagte sie.
»Ich bin nicht reich«, sagte ich. »Aber ich habe etwas Geld. Sag mir, was du brauchst.«
Sie überlegte einen Moment.
»Ich könnte eine Elektrolysebehandlung gebrauchen.«
»Sei doch mal ernst.«
»Ich bin ernst. Wenn eine Frau gut aussieht, fühlt sie sich auch gut.«
»Bitte, Mom.« Ich spürte, dass sich meine Schultern verkrampften, wie immer bei diesem Thema. »Ich meine irgendwas, das dir helfen könnte, dein Leben zu ändern, es zu verbessern.«
»Du willst mir helfen, mein Leben zu ändern?«, fragte Mom. »Mir geht’s gut. Du bist es, die Hilfe braucht. Deine Werte sind total durcheinander geraten.«
»Mom, ich hab dich neulich im East Village gesehen, wie du im Müll herumgestochert hast.«
»Tja, in diesem Land wird viel zu viel weggeschmissen, und das ist meine Art von Recycling.« Sie aß eine Gabel von ihren Meeresfrüchten. »Wieso hast du mich nicht begrüßt?«
»Es war mir einfach zu peinlich, Mom. Ich hab mich versteckt.«
Mom zeigte mit ihren Essstäbchen auf mich. »Da siehst du’s«, sagte sie. »Ganz klar. Genau das hab ich gemeint. Du schämst dich viel zu schnell. Dein Vater und ich sind, wie wir sind. Akzeptier das endlich.«
»Und was soll ich sagen, wenn man mich nach meinen Eltern fragt?«
»Sag einfach die Wahrheit«, sagte Mom. »Ganz einfach.«
Ich stand in Flammen.
Das ist meine früheste Erinnerung. Ich war drei Jahre alt, und wir wohnten in einem Wohnwagenpark in irgendeiner Stadt, irgendwo in Südarizona. Ich trug ein rosa Kleid, das meine Großmutter mir gekauft hatte, und stand auf einem Stuhl vor dem Herd. Rosa war meine Lieblingsfarbe. Das Kleid hatte einen kurzen Rock, der abstand wie ein Tutu, und wenn ich es anhatte, drehte ich mich gern vor dem Spiegel im Kreis und stellte mir vor, ich wäre eine Ballerina. Doch in dem Augenblick trug ich das Kleid, um Hot Dogs zu kochen. Ich sah zu, wie sie im kochenden Wasser nach oben trieben und tanzten, während die Vormittagssonne durch das winzige Küchenfenster des Wohnwagens drang.
Ich hörte Mom nebenan singen, während sie an einem ihrer Gemälde arbeitete. Juju, unser schwarzer Hund, schaute mir zu. Ich spießte eins von den Hot Dogs mit einer Gabel auf, bückte mich und hielt es ihm hin. Das Würstchen war heiß, deshalb leckte Juju zögernd daran, aber als ich mich aufrichtete und wieder im Topf rührte, spürte ich einen Hitzeschwall an meiner rechten Seite. Ich wandte den Kopf und merkte, dass mein Kleid brannte. Starr vor Schrecken sah ich zu, wie die gelbweißen Flammen eine gezackte braune Linie durch den rosa Kleiderstoff fraßen und an meinem Bauch emporstiegen. Dann sprangen die Flammen hoch und erreichten mein Gesicht.
Ich schrie. Ich roch Brandgeruch und hörte ein grässliches Knistern, als das Feuer meine Haare und Wimpern versengte. Juju bellte. Ich schrie wieder.
Mom kam ins Zimmer gerannt.
»Mommy, Hilfe!«, kreischte ich. Ich stand noch immer auf dem Stuhl, schlug mit der Gabel, die ich zum Rühren benutzt hatte, nach dem Feuer.
Mom rannte hinaus und kam mit einer von den Armeedecken zurück, die ich nicht ausstehen konnte, weil die Wolle so kratzte. Sie warf die Decke um mich und erstickte die Flammen. Dad war mit dem Auto unterwegs, deshalb packte Mom mich und meinen Bruder Brian und lief zu dem Wohnwagen nebenan. Die Frau, die dort wohnte, hängte gerade Wäsche auf. Sie hatte Wäscheklammern im Mund. Mom erklärte ihr mit unnatürlich ruhiger Stimme, was passiert war, und fragte, ob sie uns bitte zum Krankenhaus fahren könnte. Die Frau ließ ihre Wäscheklammern und die Wäsche an Ort und Stelle auf den Boden fallen und rannte wortlos zu ihrem Auto.
In der Notaufnahme wurde ich auf eine Trage gelegt. Die Krankenschwestern sprachen in lautem, besorgtem Flüsterton, während sie mit einer glänzenden Schere alles abschnitten, was von meinem schönen rosa Kleid noch übrig geblieben war. Dann hoben sie mich hoch, legten mich auf ein großes Metallbett voller Eiswürfel und verteilten auch noch Eis über meinen Körper. Ein Arzt mit silberweißem Haar und schwarzer Brille führte meine Mutter aus dem Zimmer, und als sie hinausgingen, hörte ich ihn sagen, dass es sehr ernst sei. Die Krankenschwestern blieben da und kümmerten sich weiter um mich. Ich merkte, dass ich alle in Aufregung versetzt hatte, und war ganz still. Eine von ihnen drückte mir die Hand und sagte, ich würde wieder gesund werden.
»Ich weiß«, sagte ich, »aber wenn nicht, ist das auch okay.«
Die Schwester drückte mir noch einmal die Hand und biss sich auf die Unterlippe.
Das Zimmer war klein und weiß, mit hellen Lampen und Metallschränken. Ich starrte eine Zeit lang auf die Reihen winziger Punkte in den Deckenpaneelen. Eiswürfel waren über meinen Bauch und den Brustkorb verteilt und drückten gegen meine Wangen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie eine kleine, schmutzige Hand dicht neben meinem Gesicht nach oben griff und eine Hand voll Eiswürfel nahm. Ich hörte ein lautes, knirschendes Geräusch und blickte nach unten. Mein Bruder Brian kaute Eis.
Die Ärzte sagten, ich hätte großes Glück gehabt. Sie nahmen Hautteile aus meinem Oberschenkel und pflanzten sie auf die am schlimmsten verbrannten Stellen an Bauch und Brustkorb. Sie sagten, dass nenne man Hauttransplantation. Als sie fertig waren, bandagierten sie die gesamte rechte Seite meines Körpers.
»Kuck mal, ich bin eine Halbmumie«, sagte ich zu einer der Schwestern. Sie lächelte und schob meinen rechten Arm in eine Schlinge, die sie am Kopfende des Bettes befestigte, sodass ich ihn nicht mehr bewegen konnte.
Die Schwestern und Ärzte stellten mir viele Fragen. Wie hatte ich mich verbrannt? Haben deine Eltern dir schon mal wehgetan? Woher hast du die vielen Prellungen und Schürfwunden? Meine Eltern tun mir nie weh, sagte ich. Die Schürfwunden und Prellungen hatte ich vom Draußen-Spielen und die Verbrennungen vom Hot-Dogs-Kochen. Sie fragten, wieso ich mit nur drei Jahren schon allein Hot Dogs kochte. Weil es leicht war, sagte ich. Du tust einfach die Hot Dogs ins Wasser und kochst sie. Ohne eins von den komplizierten Rezepten, die man erst verstand, wenn man schon in die Schule ging. Wenn der Topf voll Wasser war, konnte ich ihn nicht mehr heben, erklärte ich ihnen, deshalb schob ich einen Stuhl ans Waschbecken, stieg drauf und füllte ein Glas Wasser, dann stieg ich auf einen Stuhl am Herd und goss das Wasser in den Topf. Das tat ich so lange, bis genug Wasser im Topf war. Dann machte ich den Herd an, und wenn das Wasser kochte, warf ich die Hot Dogs rein. »Mom sagt, ich bin schon reif für mein Alter«, erzählte ich ihnen, »und sie lässt mich oft allein kochen.«
Zwei Schwestern tauschten Blicke, und eine von ihnen schrieb irgendwas auf ein Klemmbrett. Ich fragte, was denn los sei. Nichts, sagten sie, nichts.
Alle zwei Tage wechselten die Schwestern den Verband. Der alte Verband, der verklebt und voll mit Blut und gelbem Zeugs und kleinen Stückchen verbrannter Haut war, wurde entfernt. Dann kam ein neuer Verband, ein breiter Gazestreifen, auf die Verbrennungen. Nachts strich ich mit der linken Hand über die raue, verschorfte Oberfläche der Haut, die nicht von dem Verband bedeckt war. Manchmal pulte ich den Schorf ab. Die Schwestern hatten mir das verboten, aber ich konnte nicht anders, ganz langsam zog ich möglichst große Stücke Schorf ab, und wenn ich dann mehrere abhatte, tat ich so, als würden sie sich mit Piepsstimmchen unterhalten.
Das Krankenhaus war sauber und blitzblank. Alles war weiß – die Wände und Laken und Schwesterntrachten – oder silbern: die Betten und Tabletts und medizinischen Instrumente. Alle sprachen mit höflicher, ruhiger Stimme. Es war so leise, dass man die Gummisohlen der Schwesternschuhe über den ganzen Gang hinweg quietschen hörte. Ich war Ruhe und Ordnung nicht gewohnt, und es gefiel mir.
Mir gefiel auch, dass ich ein eigenes Zimmer hatte. Im Wohnwagen musste ich mir nämlich eins mit meinem Bruder und meiner Schwester teilen. Mein Krankenhauszimmer hatte sogar oben an der Wand einen Fernseher. Zu Hause hatten wir keinen Fernseher, also kuckte ich viel fern. Am liebsten Red Buttons und Lucille Ball.
Die Schwestern und Ärzte fragten mich dauernd, wie ich mich fühlte und ob ich Hunger hätte oder irgendwas brauchte. Dreimal am Tag brachten mir die Schwestern leckeres Essen mit Obstsalat oder Wackelpudding zum Nachtisch, und sie wechselten die Bettwäsche sogar schon, wenn sie noch ganz sauber aussah. Manchmal las ich ihnen was vor, und sie sagten, ich wäre sehr schlau und könnte so gut lesen wie eine Sechsjährige.
Einmal kaute eine Krankenschwester mit welligem gelbem Haar und blauem Augen-Make-up auf irgendwas. Ich fragte sie, was sie da im Mund hätte, und sie sagte, Kaugummi. Ich hatte noch nie etwas von Kaugummi gehört, deshalb ging sie los und kaufte mir eine ganze Packung. Ich zog einen Streifen heraus, machte das weiße Papier und die glänzende Silberfolie darunter ab und betrachtete den pudrigen, kittfarbenen Gummi. Ich schob ihn in den Mund und war überwältigt von der würzigen Süße. »Das schmeckt aber gut!«, sagte ich.
»Dann kau schön – aber nicht runterschlucken«, sagte die Schwester lachend. Sie strahlte übers ganze Gesicht und holte die anderen Schwestern, damit sie miterleben konnten, wie ich den ersten Kaugummi meines Lebens kaute. Als sie mir das Mittagessen brachte, sagte sie, ich müsse den Kaugummi aus dem Mund nehmen, aber ich könne nach dem Essen einen neuen nehmen, und wenn die ganze Packung alle wäre, würde sie mir eine neue kaufen. Das war das Tolle am Krankenhaus. Man musste keine Angst haben, dass man nichts mehr zu essen oder kein Eis oder Kaugummi bekam. Ich wäre furchtbar gern für immer im Krankenhaus geblieben.
Wenn meine Familie mich besuchen kam, dann hallten ihre Streitereien und ihr Lachen und Singen und Rufen durch die stillen Gänge. Die Krankenschwestern machten zischende Geräusche, und Mom und Dad und Lori und Brian waren ein Weilchen leise, und dann wurden sie allmählich wieder laut. Immer drehten sich alle nach Dad um und starrten ihm hinterher. Ich wusste nicht, ob es damit zu tun hatte, dass er so gut aussah oder dass er die Leute »Kumpel« und »Partner« nannte und beim Lachen den Kopf in den Nacken warf.
Eines Tages beugte sich Dad über mein Bett und fragte, ob die Schwestern und Ärzte auch nett zu mir wären. Wenn nicht, sagte er, würde er hier mal ordentlich auf den Tisch hauen. Als ich erwiderte, dass alle lieb und freundlich zu mir waren, sagte er: »Kein Wunder. Schließlich wissen sie, dass du die Tochter von Rex Walls bist.«
Als Mom sich erkundigte, was die Ärzte und Schwestern denn Nettes machten, erzählte ich ihr von dem Kaugummi.
»Igitt«, sagte sie. Sie war gegen Kaugummikauen, erklärte sie. Es sei eine widerliche Angewohnheit der Unterschicht, und die Schwester hätte sie fragen sollen, ehe sie mir etwas so Vulgäres beibrachte. Sie sagte, sie würde der Frau ordentlich die Meinung geigen. »Schließlich bin ich deine Mutter«, sagte Mom, »und für deine Erziehung zuständig.«
»Vermisst du mich?«, fragte ich meine Schwester Lori, als sie mich besuchten.
»Nicht so richtig«, sagte sie. »Es ist immer so viel los.«
»Was denn?«
»Bloß das Übliche.«
»Auch wenn Lori dich nicht vermisst, Schätzchen«, sagte Dad. »Ich vermisse dich sehr. Du solltest nicht hier in diesem aseptischen Laden sein.«
Er setzte sich auf mein Bett und fing an, mir die Geschichte zu erzählen, wie Lori mal von einem giftigen Skorpion gebissen worden war. Ich hatte sie schon x-mal gehört, aber ich konnte nicht genug davon kriegen. Mom und Dad waren auf Erkundungstour in der Wüste, als Lori, die damals vier war, einen Stein umdrehte und der Skorpion, der sich darunter versteckt hatte, sie ins Bein biss. Sie hatte Krämpfe bekommen, und ihr Körper war ganz steif und schweißnass geworden. Aber Dad hatte kein Vertrauen in Krankenhäuser, deshalb brachte er sie zu einem Navajo-Medizinmann, der die Bissstelle aufschnitt und eine dunkelbraune Paste darauf schmierte und ein paar Sprüche herunterleierte, und im Handumdrehen war Lori wieder quietschfidel. »An dem Tag, als du dich verbrannt hast, hätte deine Mutter dich zu dem Medizinmann bringen sollen«, sagte Dad, »nicht hierher zu diesen studierten Quacksalbern, die nichts als Scheiße im Hirn haben.«
Als sie das nächste Mal zu Besuch kamen, hatte Brian einen schmutzigen weißen Verband mit getrockneten Blutflecken um den Kopf. Mom sagte, er wäre von der Couchlehne gefallen und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen, aber sie und Dad hätten beschlossen, ihn nicht ins Krankenhaus zu bringen.
»Es hat stark geblutet«, sagte Mom, »aber ein Kind im Krankenhaus reicht.«
»Außerdem«, sagte Dad, »bei Brians hartem Schädel hat der Fußboden wahrscheinlich noch mehr abbekommen.«
Brian fand das zum Schreien komisch und kriegte sich nicht mehr ein.
Mom erzählte, dass sie unter meinem Namen bei einer Tombola auf der Kirmes mitgespielt hatte, und ich hätte einen Hubschrauberflug gewonnen. Ich war ganz aus dem Häuschen. Ich war noch nie mit einem Hubschrauber oder Flugzeug geflogen.
»Wann darf ich fliegen?«, fragte ich.
»Och, das haben wir schon gemacht«, sagte Mom. »War toll.«
Dann bekam Dad Streit mit dem Arzt. Es ging darum, dass Dad meinte, ich sollte keine Verbände tragen. »Brandwunden müssen atmen«, erklärte er dem Arzt.
Der Arzt sagte, die Verbände wären notwendig, um Infektionen zu vermeiden. Dad starrte den Arzt an. »Infektionen, so ein Blödsinn«, sagte Dad. Er schnauzte den Arzt an, er sei schuld, wenn ich für den Rest meines Lebens vernarbt wäre, aber ich würde nicht die Einzige mit Narben sein, das könne er ihm garantieren.
Dad hob die Faust, als wollte er den Arzt schlagen, der die Hände hob und zurückwich, doch ehe irgendwas passieren konnte, tauchte ein Wachmann in Uniform auf und sagte, Mom und Dad und Lori und Brian müssten sofort gehen.
Hinterher fragte mich eine Schwester, ob mit mir alles in Ordnung wäre. »Na klar«, sagte ich. Ich erklärte ihr, es würde mir nichts ausmachen, wenn ich irgend so eine blöde Narbe hätte. Das sei gut, sagte sie, es sähe nämlich ganz danach aus, als hätte ich noch andere Sorgen.
Ein paar Tage später, als ich etwa sechs Wochen im Krankenhaus lag, stand Dad auf einmal allein in der Tür zu meinem Zimmer. Er sagte mir, ich würde entlassen – à la Rex Walls.
»Geht das denn?«, fragte ich.
»Vertrau einfach deinem alten Herrn«, sagte Dad.
Er nahm meinen rechten Arm aus der Schlinge über meinem Kopf. Als er mich an sich zog, atmete ich den vertrauten Geruch von Vitalis-Haarwasser, Whiskey und Zigarettenrauch ein. Ich fühlte mich an zu Hause erinnert.
Dad trug mich hastig in seinen Armen den Gang entlang. Hinter uns schrie eine Schwester, wir sollten stehen bleiben, aber Dad rannte los. Er stieß eine Notausgang-Tür auf, lief die Treppe hinunter und hinaus auf die Straße. Unser Auto, ein verbeulter Plymouth, den wir Blaue Gans nannten, parkte mit laufendem Motor gleich um die Ecke. Mom saß auf dem Beifahrersitz, Lori und Brian mit Juju auf der Rückbank. Dad schob mich zu Mom hinüber und setzte sich hinters Steuer.
»Du musst keine Angst mehr haben, Kleines«, sagte Dad. »Jetzt bist du in Sicherheit.«
Wenige Tage nachdem Mom und Dad mich nach Hause geholt hatten, kochte ich mir ein paar Hot Dogs. Ich hatte Hunger, Mom arbeitete an einem Gemälde, und es war sonst keiner da, der sie mir hätte kochen können.
»So ist es richtig«, sagte Mom, als sie mich am Herd stehen sah. »Immer gleich wieder in den Sattel steigen. Vor so normalen Sachen wie Feuer darfst du keine Angst haben.«
Hatte ich auch nicht. Im Gegenteil, Feuer faszinierte mich jetzt erst recht. Auch Dad fand, dass ich mich meinem Feind stellen sollte, und er zeigte mir, wie ich mit dem Finger durch eine Kerzenflamme fahren konnte. Ich tat es immer und immer wieder, wurde von Mal zu Mal langsamer, beobachtete, wie mein Finger die Flamme regelrecht zu zerteilen schien, probierte aus, wie viel Flamme mein Finger aushalten konnte, ohne sich zu verbrennen. Ich hielt ständig Ausschau nach größeren Feuern. Wenn Nachbarn Müll verbrannten, rannte ich sofort hin und schaute zu, wie die lodernden Flammen versuchten, der Mülltonne zu entkommen. Dann schob ich mich näher und näher heran, bis die Hitze auf meinem Gesicht unerträglich wurde, und wich dann gerade so weit zurück, dass ich sie aushalten konnte.
Die Nachbarin, die mich zum Krankenhaus gefahren hatte, staunte, dass ich nicht vor jedem Feuer Reißaus nahm. »Zum Donnerwetter, warum sollte sie?«, dröhnte Dad mit stolzem Grinsen. »Sie hat doch schon mal gegen Feuer gekämpft, und sie hat gewonnen.«
Ich fing an, Streichhölzer von Dad zu stibitzen. Dann ging ich hinter den Wohnwagen und zündete sie an. Ich mochte das Geräusch, wenn das Streichholz über den schmirgelpapierartigen braunen Streifen kratzte und wenn die Flamme mit einem Ploppen und Zischen aus der rot betupften Spitze sprang. Wenn ich die Hitze dicht an den Fingerspitzen spürte, wedelte ich es triumphierend aus. Ich zündete Papierstücke und Häufchen aus dünnen Zweigen an, wartete dann mit angehaltenem Atem, bis die Flammen fast außer Kontrolle gerieten. Dann trat ich sie aus und rief dabei die Schimpfworte, die Dad benutzte, wie »dämliches Arschloch!« und »Schleimscheißer!«.
Einmal ging ich mit meinem Lieblingsspielzeug Tinkerbell, einer Plastikpuppe, die aussah wie die kleine Fee aus Peter Pan, hinter den Wohnwagen. Sie war nur fünf Zentimeter groß, trug das blonde Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden und hatte die Hände, was mir besonders gefiel, selbstbewusst und herausfordernd in die Hüften gestemmt. Ich zündete ein Streichholz an und hielt es nah vor Tinkerbells Gesicht, um ihr zu zeigen, wie sich das anfühlte. Im Schein der Flamme sah sie schöner aus denn je. Als das Streichholz ausging, machte ich noch eins an, und diesmal hielt ich es ihr ganz dicht ans Gesicht. Plötzlich weiteten sich ihre Augen wie vor Angst, und dann sah ich zu meinem Entsetzen, dass ihr Gesicht zu schmelzen anfing. Ich löschte das Streichholz, doch zu spät. Tinkerbells einst vollkommene kleine Nase war komplett verschwunden, und dort, wo ihre kecken roten Lippen gewesen waren, hatte sie nun einen hässlichen, schiefen Fleck. Ich versuchte ihre Gesichtszüge wieder zurechtzudrücken, machte aber alles nur noch schlimmer, und dann war die Masse auch schon abgekühlt und wieder erstarrt. Ich wickelte einen Verband darum. Ich hätte Tinkerbell gern eine Hauttransplantation verpasst, aber dazu hätte ich sie in Stücke schneiden müssen. Obwohl ihr Gesicht zerschmolzen war, blieb sie mein Lieblingsspielzeug.
Wenige Monate nach meiner Rückkehr aus dem Krankenhaus kam Dad mitten in der Nacht nach Hause und holte uns alle aus dem Bett.
»Zeit, unsere Zelte abzubrechen und dieses Drecksloch hinter uns zu lassen«, donnerte er.
Wir hatten fünfzehn Minuten, um unsere Sachen zu packen und ins Auto zu klettern.
»Ist alles in Ordnung, Dad?«, fragte ich. »Ist jemand hinter uns her?«
»Nur keine Bange«, sagte Dad. »Überlass das ruhig mir. Pass ich nicht immer gut auf euch auf?«
»Doch, das tust du«, sagte ich.
»Braves Mädchen!«, sagte Dad und nahm mich in die Arme. Dann befahl er lautstark, wir sollten uns beeilen. Er selbst nahm die wichtigsten Sachen – eine große, schwarze, gusseiserne Pfanne und den Bratentopf, ein paar Blechteller aus Armeebeständen, ein paar Messer, seine Pistole und Moms Pfeile und Bogen – und verstaute alles im Kofferraum der Blauen Gans. Er sagte, wir sollten möglichst wenig mitnehmen, bloß das, was wir zum Überleben brauchten. Mom eilte in den Garten und fing an, im Mondlicht Löcher zu graben. Sie suchte nach dem Einmachglas mit unserem Bargeld. Sie hatte vergessen, wo sie es vergraben hatte.
Eine Stunde verging, bis wir schließlich Moms Gemälde aufs Autodach schnallten, den Kofferraum bis oben hin voll packten und den Rest auf Rückbank und Wagenboden verteilten. Dad steuerte die Blaue Gans durch die Dunkelheit, ganz langsam, damit keiner merkte, dass wir »türmten«, wie Dad gern sagte, und er knurrte, dass er einfach nicht begreifen könne, warum zum Teufel wir immer so lange brauchten, um das Notwendigste zu schnappen und unseren Hintern ins Auto zu bewegen.
»Dad!«, sagte ich. »Ich hab Tinkerbell vergessen!«
»Tinkerbell kommt auch allein zurecht«, sagte Dad. »Sie ist wie mein kleines, tapferes Mädchen. Du bist doch tapfer und abenteuerlustig, oder nicht?«
»Doch«, sagte ich. Ich hoffte, dass derjenige, der Tinkerbell fand, sie trotz ihres zerschmolzenen Gesichts lieb haben würde. Zum Trost wollte ich Quixote an mich drücken, unseren grauweißen Kater, dem ein Ohr fehlte, aber er fauchte und kratzte mir ins Gesicht. »Ganz ruhig, Quixote!«, sagte ich.
»Katzen reisen nicht gern!«, erklärte Mom.
Wer nicht gern reiste, sei bei unserem Abenteuer fehl am Platze, meinte Dad. Er hielt das Auto an, packte Quixote am Nackenfell und warf ihn aus dem Fenster. Quixote landete mit einem kreischenden Miauen und einem dumpfen Aufprall, Dad gab Gas, und ich brach in Tränen aus.
»Sei nicht so gefühlsduselig«, sagte Mom. Sie erklärte, wir könnten jederzeit eine andere Katze haben und dass Quixote nun eine Wildkatze werden würde, was viel mehr Spaß machte, als bloß eine Hauskatze zu sein. Brian, der Angst hatte, dass Dad auch Juju aus dem Fenster werfen könnte, hielt den Hund ganz fest.
Um uns Kinder abzulenken, sang Mom mit uns Lieder wie »Don’t Fence Me In« und »This Land Is Your Land«, und Dad stimmte eine schwungvolle Version von »Old Man River« und seinem Lieblingssong »Swing Low, Sweet Chariot« an. Nach einer Weile dachte ich nicht mehr an Quixote und Tinkerbell und die Freundinnen, die ich in dem Wohnwagenpark zurückgelassen hatte. Dad erzählte, was wir für aufregende Dinge unternehmen würden und dass wir reich werden würden, wenn wir erst an unserem neuen Wohnort angekommen wären.
»Wohin fahren wir denn, Dad?«, fragte ich.
»Dahin, wo wir landen«, sagte er.
Später in der Nacht hielt Dad mitten in der Wüste, und wir schliefen unterm Sternenhimmel. Wir hatten keine Kissen, aber Dad sagte, das gehöre dazu. Er wolle uns nämlich eine gute Körperhaltung beibringen. Die Indianer benutzten auch keine Kissen, erklärte er, und seht euch an, wie gerade die sich halten. Wir hatten ja unsere kratzigen Armeedecken, die breiteten wir aus und legten uns darauf, den Blick auf das Sternenmeer gerichtet. Ich sagte zu Lori, was für ein Glück wir doch hätten, draußen im Freien zu schlafen wie Indianer.
»Ich könnte immer so leben«, sagte ich.
»Ich glaube, das werden wir auch«, sagte sie.
Wir türmten ständig, meistens mitten in der Nacht. Manchmal hörte ich, wie Mom und Dad über die Leute redeten, die hinter uns her waren. Dad nannte sie Handlanger, Blutsauger und die Gestapo. Manchmal machte Dad komische Andeutungen über Manager von Standard Oil, die das Land stehlen wollten, das Moms Familie in Texas gehörte, und über FBI-Agenten, die Dad wegen einer dunklen Sache verfolgten, von der er uns nichts erzählte, um uns nicht auch noch in Gefahr zu bringen.
Weil Dad sich so sicher war, dass ein ganzes Aufgebot von FBI-Leuten hinter uns her war, rauchte er seine filterlosen Zigaretten vom falschen Ende an. Auf diese Weise, so erklärte er uns, verbrannte der aufgedruckte Markenname, und falls die Leute, die uns verfolgten, in seinen Aschenbecher kuckten, würden sie nur unidentifizierbare Kippen finden statt der Pall Mall, die ihn verraten könnten. Aber Mom erzählte uns, dass das FBI gar nicht hinter Dad her war, er sagte das bloß, weil es mehr Spaß machte, vom FBI gesucht zu werden als von Geldeintreibern.
Wir zogen umher wie Nomaden. Wir lebten in staubigen Bergarbeiterstädtchen in Nevada, Arizona und Kalifornien, meistens bloß eine spärliche Ansammlung von traurigen, baufälligen Hütten, einer Tankstelle, einem Laden und ein oder zwei Kneipen. Sie hatten Namen wie Needles and Bouse, Pie Town, Goffs und Why und lagen in der Nähe von Orten wie den Superstition Mountains, dem ausgetrockneten Soda Lake und dem Old Woman Mountain. Je verlassener und entlegener, desto besser gefiel es Mom und Dad.
Dad suchte sich meist Arbeit als Elektriker oder Ingenieur in einem Gips- oder Kupferbergwerk. Mom sagte immer richtig stolz, dass Dad das Blaue vom Himmel herunterlügen könne. Er ließ sich Jobs einfallen, die er nie gehabt, und Universitätsabschlüsse, die er nie gemacht hatte. Auf diese Weise kriegte er so ziemlich jeden Job, den er haben wollte, nur dass er keine große Lust verspürte, ihn lange zu behalten. Manchmal gewann er beim Glücksspiel oder verdingte sich als Gelegenheitsarbeiter. Wenn er sich dann langweilte oder rausgeschmissen wurde oder wenn sich die unbezahlten Rechnungen türmten oder ein Störungssucher von den Stadtwerken rausfand, dass Dad unseren Wohnwagen an einen Strommast angeschlossen hatte – oder wenn das FBI zu nah kam –, packten wir mitten in der Nacht unsere Sachen und machten uns aus dem Staub, fuhren so lange, bis Mom und Dad eine andere Kleinstadt gefunden hatten, die ihnen auf Anhieb gefiel. Dann kurvten wir herum und hielten nach Häusern mit einem »ZU-VERMIETEN«-Schild Ausschau.
Hin und wieder wohnten wir eine Weile bei Grandma Smith, Moms Mom, die in einem großen weißen Haus in Phoenix lebte. Grandma Smith war ein westtexanisches Urgestein, sie tanzte und fluchte gern und liebte Pferde über alles. Sie war bekannt dafür, dass sie die wildesten Wildpferde einreiten konnte, und hatte auf Grandpas Ranch mitgeholfen, oben am Fish Creek Canyon in Arizona, westlich von Bullhead City, nicht allzu weit vom Grand Canyon. Ich fand Grandma Smith toll. Aber nach ein paar Wochen kriegten sie und mein Dad sich immer schrecklich in die Haare. Auslöser konnte sein, dass Mom erwähnte, wie knapp wir mit Geld waren. Dann machte Grandma eine abfällige Bemerkung darüber, dass Dad nicht arbeitete. Und dann sagte Dad irgendwas über selbstsüchtige alte Weiber, die mehr Geld hatten, als sie je würden ausgeben können, und in null Komma nichts trugen sie den reinsten Schimpfwettstreit aus.
»Du verkommener Saufbold!«, schrie Grandma dann.
»Du gottverdammtes, hartherziges Miststück!«, brüllte Dad zurück.
»Du nutzloser, armseliger Schlappschwanz!«
»Du niederträchtige, Unglück bringende Kastrationshexe!«
Dads Wortschatz war kreativer, aber Grandma Smith konnte lauter brüllen als er. Außerdem hatte sie Heimvorteil, und irgendwann reichte es Dad, und er befahl uns Kindern, ins Auto zu steigen. Grandma schrie dann Mom an, sie solle nicht zulassen, dass dieser faule Pferdearsch ihre Enkelkinder mitnahm. Mom zuckte daraufhin die Achseln und sagte, dagegen könne sie nichts machen, er sei ihr Mann. Und schon waren wir wieder unterwegs und fuhren hinaus in die Wüste auf der Suche nach einem weiteren Haus, das in einem weiteren kleinen Bergarbeiterstädtchen zu vermieten war.
Manche von den Leuten, die in diesen Städtchen wohnten, lebten schon seit Jahren dort. Andere waren ungebunden wie wir – nur auf der Durchreise. Es waren Spieler oder Exknackis oder Kriegsveteranen oder lose Frauen, wie Mom sie bezeichnete. Es gab alte Goldsucher mit runzligen Gesichtern, sonnengegerbt wie vertrocknete Äpfel. Die Kinder waren mager und abgehärtet, mit Schwielen an Händen und Füßen. Wir freundeten uns mit ihnen an, aber nicht sehr eng, weil wir wussten, dass wir früher oder später weiterziehen würden.
Manchmal wurden wir in der Schule angemeldet, aber nicht immer. Meistens gaben Mom und Dad uns Unterricht. Dank Mom konnten wir alle schon mit fünf Jahren Bücher ohne Bilder lesen, und Dad brachte uns Mathe bei. Er brachte uns auch die Sachen bei, die wirklich wichtig und nützlich waren, zum Beispiel Morsen und dass man niemals die Leber von einem Eisbären essen sollte, weil das viele Vitamin A einen umbringen könnte. Er zeigte uns, wie man mit seiner Pistole zielte und feuerte, wie man mit Moms Pfeil und Bogen schoss und wie man ein Messer an der Klinge fasste und es so warf, dass es mit einem satten Tschwock mitten im Ziel stecken blieb. Als ich vier Jahre alt war, konnte ich schon ziemlich gut mit Dads Pistole umgehen, einem sechsschüssigen Revolver: Auf dreißig Schritt Entfernung traf ich fünf von sechs Bierflaschen. Ich hielt die Waffe mit beiden Händen, zielte über den Lauf und zog langsam und gleichmäßig am Abzug, bis der Revolver mit einem lauten Knall nach oben schnellte und die Flasche zerplatzte. Das war lustig. Dad meinte, meine Künste als Scharfschützin würden uns zugute kommen, falls das FBI uns je umzingeln sollte.
Mom war in der Wüste aufgewachsen. Sie liebte die trockene, knisternde Hitze, den Himmel, der bei Sonnenuntergang aussah wie ein brennendes Laken, und die überwältigende Leere und Rauheit des weiten Landes, das einmal ein riesiges Ozeanbett gewesen war. Den meisten Menschen fiel es schwer, in der Wüste zu überleben, doch Mom blühte regelrecht auf. Sie wusste, wie man sich mit so gut wie nichts durchschlug. Sie zeigte uns, welche Pflanzen essbar waren und welche giftig. Sie konnte Wasser finden, wenn kein anderer es konnte, und sie wusste, mit wie wenig man wirklich auskam. Sie brachte uns bei, dass man sich mit nur einer Tasse Wasser einigermaßen sauber waschen kann. Sie sagte, es täte uns gut, ungereinigtes Wasser zu trinken, sogar Abwasser, vorausgesetzt, die Tiere tränken davon. Das mit Chlor versetzte Wasser in den Städten wäre was für Weicheier, sagte sie. Wasser aus der Natur würde dafür sorgen, Antikörper aufzubauen. Auch Zahncreme war ihrer Meinung nach was für Weicheier. Vor dem Schlafengehen schütteten wir ein bisschen Natron in eine Hand, gaben einen Spritzer Wasserstoffsuperoxid dazu und benutzten dann die Finger, um uns mit der schäumenden Paste die Zähne zu putzen.
Ich liebte die Wüste ebenfalls. Wenn die Sonne am Himmel stand, war der Sand so heiß, dass er dir die Füße verbrannte, wenn du zu den Kindern gehörtest, die normalerweise Schuhe trugen, aber da wir immer barfuß liefen, waren unsere Fußsohlen so zäh und dick wie Leder. Wir fingen Skorpione und Schlangen und Krötenechsen. Wir suchten nach Gold, und als wir keins fanden, sammelten wir andere kostbare Steine wie Türkise und Granate. Wenn die Sonne unterging, wurde es kühl, und dann kamen die Moskitos in so dichten Wolken, dass sie die Luft verdunkelten, und bei Einbruch der Nacht wurde es so kalt, dass wir Decken brauchten.
Es gab schlimme Sandstürme. Mal kamen sie ohne Vorwarnung, und mal erkannte man an den Staubteufeln, die wirbelnd durch die Wüste tanzten, dass einer im Anmarsch war. Sobald der Wind dann den Sand hochpeitschte, konnte man kaum die Hand vorm Gesicht sehen. Wenn kein Haus oder Auto oder Schuppen da war, in dem man Schutz suchen konnte, musste man sich hinkauern, Augen und Mund ganz fest zusammenpressen, die Ohren zuhalten und das Gesicht in den Schoß legen, bis der Sturm vorüber war. Ab und zu wurde man von einem Tumbleweed getroffen, einem dieser Gestrüppballen, die durch die Wüste kullern, aber die waren leicht und taten nicht weh. Wenn der Sandsturm besonders stark war, riss er einen mit, und man rollte weiter, als wäre man selbst ein Tumbleweed.
Wenn endlich der Regen kam, wurde der Himmel dunkel und die Luft schwül. Dann prasselten Regentropfen so groß wie Murmeln herab. Manche Eltern fürchteten, ihre Kinder könnten vom Blitz getroffen werden, aber Mom und Dad hatten keine Angst um uns, und sie ließen uns draußen in dem warmen, strömenden Wasser spielen. Wir planschten herum und sangen und tanzten. Mächtige Blitze zuckten aus den tief hängenden Wolken, und Donner ließ die Erde erbeben. Staunend schauten wir dem Spektakel zu, als wäre es ein Feuerwerk. Nach dem Unwetter ging Dad mit uns zu den sonst trockenen Flussbetten, den Arroyos, wo wir uns die Springfluten ansahen, die durch sie hindurchrauschten. Am nächsten Tag waren die Saguaro-Kakteen und die Feigenkakteen ganz dick, weil sie sich richtig voll getrunken hatten, um die vielleicht lange Zeit bis zum nächsten Regen zu überstehen.
Wir mochten die Kakteen irgendwie. Wir aßen unregelmäßig, und wenn wir aßen, dann stopften wir uns den Bauch voll. Einmal, als wir in Nevada lebten, entgleiste ein mit Melonen beladener Zug. Ich hatte noch nie eine Melone gegessen, aber Dad brachte zahllose Kisten mit Melonen nach Hause. Wir aßen frische Melonen, gedünstete Melonen, sogar gebratene Melonen. Und in Kalifornien streikten einmal die Traubenpflücker. Die Winzer gaben die Trauben für fünf Cent das Pfund an Selbstpflücker ab. Wir fuhren rund hundert Meilen zu den Weinbergen, wo die zum Bersten reifen Beeren in prallen Trauben hingen, die größer waren als mein Kopf. Wir füllten den ganzen Wagen mit grünen Beeren, den Kofferraum, sogar das Handschuhfach, und Dad häufte sie so hoch auf unseren Schoß, dass wir kaum darüber schauen konnten. Danach aßen wir wochenlang Weintrauben, morgens, mittags und abends.
Dieses ständige Unterwegssein war bloß vorübergehend, erklärte Dad. Er hatte einen Plan. Er würde nämlich Gold finden.
Alle sagten, dass Dad ein Genie sei. Er konnte alles bauen oder reparieren. Einmal, als der Fernseher eines Nachbarn kaputt war, der den Apparat schon wegwerfen wollte, schraubte Dad das Gerät hinten auf und benutzte eine Makkaroni, um ein paar Platinen zu isolieren. Der Nachbar war völlig von den Socken. Er erzählte im ganzen Ort herum, was Dad alles mit einer gewöhnlichen Nudel anstellen konnte. Dad begeisterte sich für Mathe und Physik und Elektrizität. Er las Bücher über Algebra und Logarithmen, und er war fasziniert von der Poesie und Symmetrie der Mathematik, wie er sagte. Am meisten interessierte sich Dad für Energie: Thermalenergie, Kernenergie, Sonnenenergie, elektrische Energie und Windenergie. Er sagte, es gäbe so viele ungenutzte Energiequellen auf der Welt, dass es einfach lächerlich sei, die ganzen fossilen Brennstoffe zu verpulvern.
Außerdem war Dad Erfinder. Eine seiner wichtigsten Erfindungen war eine komplizierte Apparatur, die er »Goldsucher« nannte. Sie sollte uns helfen, Gold zu finden. Der Goldsucher hatte eine große, glatte, schräge Oberfläche, etwa ein Meter zwanzig hoch und ein Meter achtzig breit. Auf dieser Fläche befanden sich in regelmäßigen Abständen waagerechte Holzleisten. Der Goldsucher konnte Erde und Steine aufnehmen und sie durch dieses Holzleistengitter sieben. Anhand des Gewichts konnte er feststellen, ob ein Stein aus Gold war oder nicht. Er würde alles Wertlose rausschmeißen und die Goldnuggets auf einen Haufen schichten, und immer wenn wir was einkaufen wollten, würden wir uns einfach ein Nugget nehmen. Zumindest würde der Goldsucher das können, sobald Dad ihn fertig gebaut hatte.
Brian und ich durften ihm bei der Arbeit daran helfen. Das hieß, wir hielten die Nägel fest, wenn Dad sie einschlug. Manchmal durfte ich die ersten Hammerschläge machen, und dann trieb er den Nagel mit einem einzigen festen Schlag ins Holz. Die Luft war erfüllt von Sägemehl, dem Duft von frisch gesägtem Holz, dem Geräusch des Hammers und von Dads Pfeifen; er pfiff immer bei der Arbeit.
Für mich war Dad vollkommen, außer manchmal, wenn er sein Alkoholproblem hatte, wie Mom es nannte. Dad hatte seine »Bierphasen«, aber damit kamen wir alle ganz gut klar. Dann fuhr er zu schnell Auto und sang aus vollem Halse, die Haare fielen ihm ins Gesicht, und das Leben war ein bisschen beängstigend, aber immer noch lustig. Doch wenn Dad eine Flasche von dem »harten Zeug«, wie Mom sagte, hervorholte, dann wurde sie ein bisschen nervös, denn wenn Dad sich eine Weile mit der Flasche beschäftigt hatte, verwandelte er sich in einen wütend blickenden Fremden, der herumbrüllte, Möbel durch die Gegend schmiss und nicht nur Mom mit Prügel drohte, sondern jedem, der ihm in die Quere kam. Wenn er dann vom Fluchen und Toben und Sachen-Zerschlagen genug hatte, kippte er um. Aber Dad trank nur dann Hochprozentiges, wenn wir Geld hatten – was nicht oft der Fall war –, deshalb verlief das Leben damals meist friedlich.
Jeden Abend vor dem Einschlafen erzählte Dad Lori, Brian und mir eine Gutenachtgeschichte. Sie handelte immer von ihm. Wir lagen in unseren Betten oder unter Decken in der Wüste, und die Welt war duster bis auf das orangerote Glühen seiner Zigarette. Wenn er einen tiefen Zug nahm, leuchtete sie gerade so hell auf, dass wir sein Gesicht sehen konnten.
»Erzähl uns eine Geschichte von dir, Dad!«, bettelten wir.
»Ach was, ihr wollt doch bestimmt nicht schon wieder eine Geschichte über mich hören«, sagte er dann.
»Doch, wollen wir wohl! Wollen wir wohl!«, beteuerten wir.
»Na gut«, sagte er. Dann hielt er meistens inne und lachte leise, weil ihm irgendwas einfiel. »Euer alter Herr hat ja schon viele tolldreiste Sachen angestellt, aber das, was ich euch jetzt erzähle, war selbst für einen so durchgeknallten Hund wie Rex Walls ein starkes Stück.«
Und dann erzählte er uns, wie er mal, als er in der Air Force war und der Motor von seinem Flugzeug ausfiel, auf einer Viehweide notgelandet war und dadurch sich und seine Crew gerettet hatte. Oder wie er es mit einem Rudel Wildhunde aufgenommen hatte, das einen lahmenden Mustang umzingelt hatte. Und dann war da noch die Geschichte, wie er ein kaputtes Schleusentor am Hoover-Damm repariert und damit Tausende von Menschen gerettet hatte, die ertrunken wären, wenn der Damm gebrochen wäre. Und die, wie er sich in der Air Force unerlaubt von der Truppe entfernt hatte, um ein Bier zu trinken, und in der Kneipe einen Irren erwischte, der vorhatte, den Luftwaffenstützpunkt in die Luft zu sprengen; was mal wieder zeigte, dass es sich manchmal auszahlte, die Regeln zu brechen.
Dad war ein sehr dramatischer Geschichtenerzähler. Er fing immer ganz langsam an, mit vielen Pausen. »Erzähl weiter! Was ist dann passiert?«, fragten wir, auch wenn wir die Geschichte schon kannten. Mom kicherte ein bisschen und verdrehte die Augen, wenn Dad seine Geschichten erzählte, und er blickte sie strafend an. Wenn jemand ihn unterbrach, wurde er richtig ärgerlich, und wir mussten ihn anbetteln, damit er weitererzählte, und versprechen, dass ihn keiner mehr unterbrechen würde.
Dad war stets ein besserer Kämpfer, ein schnellerer Flieger und clevererer Pokerspieler als alle anderen in seinen Geschichten. Und ganz nebenbei rettete er Frauen und Kinder und sogar Männer, die nicht so stark und schlau waren wie er. Dad weihte uns in die Geheimnisse seiner Heldentaten ein – er zeigte uns, wie man sich rittlings auf einen Wildhund setzte und ihm das Genick brach und wo man einen Mann an der Kehle treffen musste, um ihn mit einem kraftvollen Schlag zu töten. Aber er beruhigte uns, dass wir uns nicht selbst verteidigen müssten, solange er bei uns war, denn, so schwor er, er würde jedem, der irgendeinem von Rex Walls’ Kindern auch nur ein Haar krümmen wollte, so fest in den Hintern treten, dass man Dads Schuhgröße auf der Arschbacke ablesen könnte.
Und wenn Dad uns nicht von den unglaublichen Sachen erzählte, die er schon vollbracht hatte, dann erzählte er von den Sachen, die er noch vorhatte. Wie zum Beispiel das Glasschloss bauen. Sein ganzes handwerkliches Geschick und mathematisches Genie vereinigten sich zu einem einzigen besonderen Projekt – einem wunderbaren, großen Haus, das Dad in der Wüste für uns bauen würde. Es würde eine Glasdecke und dicke Glaswände und sogar ein Treppe aus Glas haben. Das Glasschloss würde obendrauf Solarzellen haben, die die Sonnenstrahlen auffangen und in Strom umwandeln würden, zum Heizen und Kühlen und für alle anderen Elektrogeräte. Es würde sogar eine eigene Kläranlage bekommen. Dad hatte die Baupläne und die meisten mathematischen Berechnungen schon fertig. Überall, wo wir hinfuhren, hatte er die Entwürfe für das Glasschloss dabei, und manchmal breitete er sie aus, und wir durften an den Plänen für unsere Zimmer arbeiten.
Jetzt müssten wir nur noch Gold finden, sagte Dad, und wir waren ganz knapp davor. Sobald er den Goldsucher fertig hatte und wir richtig reich geworden waren, würde er mit der Arbeit an unserem Glasschloss anfangen.
Dad tat sich schwer, von seinen Eltern zu erzählen oder von dem Ort, wo er zur Welt gekommen war, aber wir wussten, dass er aus einem Städtchen namens Welch in West Virginia stammte, wo es viel Kohlenbergbau gab. Sein Vater war bei der Eisenbahn gewesen und hatte Tag für Tag in einem kleinen Bahnhofshäuschen gesessen, wo er Nachrichten auf Blätter schrieb, die er dann an einem Stock für die durchfahrenden Lokomotivführer hochhielt. So ein Leben interessierte Dad nicht, deshalb verließ er Welch mit siebzehn und ging zur Air Force, um Pilot zu werden.
Eine von seinen Lieblingsgeschichten, die er uns bestimmt hundert Mal erzählt hat, war die, wie er Mom kennen lernte und sich in sie verliebte. Dad war in der Air Force, und Mom war in der United Service Organization, einer Betreuungsorganisation für amerikanische GIs, aber als sie sich kennen lernten, hatte sie Urlaub und besuchte gerade ihre Eltern, Grandpa und Grandma Smith, auf ihrer Viehranch am Fish Creek Canyon.
Dad und ein paar von seinen Air-Force-Kumpeln standen auf einer Klippe des Canyon und waren dabei, ihren ganzen Mut zusammenzunehmen, um zwölf Meter tief in den See zu springen, als Mom und eine Freundin angefahren kamen. Mom trug einen weißen Badeanzug, der ihre Figur und ihre von der Arizonasonne gebräunte Haut zur Geltung brachte. Sie hatte hellbraunes Haar, das im Sommer blond wurde, und sie trug nie irgendwelches Make-up außer dunkelrotem Lippenstift. Sie sah aus wie ein Filmstar, sagte Dad immer, aber verdammt, er war in seinem Leben schon vielen schönen Frauen begegnet, und bei keiner hatte er weiche Knie bekommen. Mom war etwas Besonderes. Er sah sofort, dass sie Mumm hatte, und er verliebte sich auf der Stelle in sie.
Mom ging zu den Soldaten und sagte, es sei nichts dabei, von der Klippe zu springen, sie hätte das schon als Kind getan. Die Männer glaubten ihr kein Wort, also trat Mom einfach an den Klippenrand und machte einen perfekten Kopfsprung ins Wasser.
Dad sprang gleich hinterher. So eine Klassebraut würde er sich doch nicht durch die Lappen gehen lassen.
»Was für einen Sprung hast du gemacht, Dad?«, fragte ich immer, wenn er die Geschichte erzählte.
»Einen Fallschirmsprung. Ohne Fallschirm«, antwortete er immer.
Dad schwamm hinter Mom her und sagte ihr noch im Wasser, dass er sie heiraten würde. Dreiundzwanzig Männer hätten ihr schon einen Heiratsantrag gemacht, entgegnete Mom, und sie habe jedes Mal Nein gesagt. »Wie kommst du darauf, dass ich deinen Antrag annehme?«, fragte sie.
»Ich hab dir keinen Antrag gemacht«, sagte Dad. »Ich hab gesagt, dass ich dich heiraten werde.«
Sechs Monate später heirateten sie. Für mich war das die romantischste Geschichte, die ich mir vorstellen konnte, aber Mom mochte sie nicht. Sie fand sie überhaupt nicht romantisch.