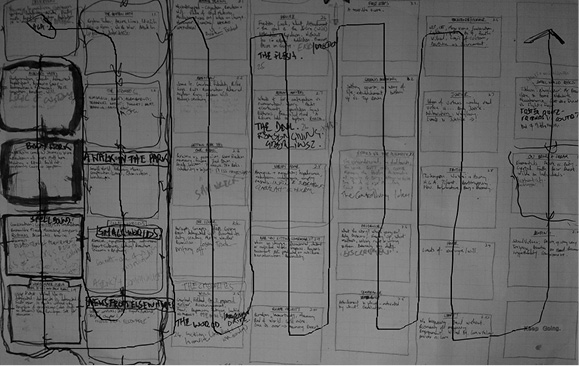
Der Schlachtplan
Vincent Deary
Wie wir sind
Leben. Eine Anleitung
Aus dem Englischen von
Gabriele Gockel und Bernhard Jendricke
Knaur e-books
Vincent Deary hat über zwanzig Jahre in London als Psychotherapeut praktiziert. Er lehrt heute an der University of Northumbria in Newcastle. Seine Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Humanwissenschaften wird vom National Institute of Health Research gefördert.
Die englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
»How We Are« bei Allen Lane, London.
Copyright © 2014 by Vincent Deary
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe bei
Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit
Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Übersetzer Gabriele Gockel und Bernhard Jendricke
gehören dem Kollektiv Druck-Reif an.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
ISBN 978-3-629-32080-3
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Noch mehr eBook-Programmhighlights & Aktionen finden Sie auf
www.droemer-knaur.de/ebooks.
Sie wollen über spannende Neuerscheinungen aus Ihrem Lieblingsgenre auf dem Laufenden gehalten werden? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter.
Sie wollen selbst Autor werden? Publizieren Sie Ihre eBooks auf unserer Akquise-Plattform www.neobooks.com und werden Sie von Droemer Knaur oder Rowohlt als Verlagsautor entdeckt. Auf eBook-Leser warten viele neue Autorentalente.
Wir freuen uns auf Sie!
»Hingabe – weil sie anfangs schwierig ist.« Hören Sie da den Werbespruch heraus?
Keine Sorge, jedes ist in sich abgeschlossen. Sie müssen sich nicht für die ganze Reise verpflichten.
Die namenlose Heldin in Daphne du Mauriers Roman Rebecca, darum bemüht, sich in die Oberschicht einzugewöhnen.
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Die Weltalter, Erstes Buch, Druck I (1811), München 1966, S. 24.
Edith Wharton, Das Haus der Freude, Stuttgart 1988, S. 420.
Gerhard Roth, »The Quest to Find Consciousness« (2004), Scientific American, Sonderausgabe, Mind 14 (I), S. 33–40.
Times Literary Supplement, 30. Januar 2004.
Trends in Cognitive Sciences, Bd. 4, Nr. 1, Januar 2000.
J. A. Hobson, Dreaming: A very short introduction, Oxford University Press, 2005.
Hans Christian von Baeyer, Information: The New Language of Science, Harvard University Press, 2004.
Gilles Deleuze und Félix Guattari, Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin 1997.
R. Menary (Hg.), The Extended Mind, MIT Press, 2010.
Stephen King, Shining, Köln 2013.
Daphne du Maurier, Rebecca, Frankfurt/M. 2006, S. 278. (Übersetzung ergänzt).
Rudolf Otto, Das Heilige, Breslau 1917.
Daniel Wegner, The Illusion of Conscious Will, MIT Press, 2002.
Isaac Marks, »Behavioural (non-chemical) addictions«, British Journal of Addiction, Bd. 85, Ausgabe 11, S. 1389–1394 (November 1990).
Andy Clark, Being There: Putting Brain, Body and World Together Again, MIT Press 1997.
Terry Pratchett, Schweinsgalopp. Ein Roman von der bizarren Scheibenwelt. München 2003, S. 393. (Übersetzung leicht gekürzt und verändert).
William Sumner, Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Ginn and Co., 1906.
Nichts ändert sich.
Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte, München 2000, S. 87.
Offenbar ermöglicht Facebook seinen Usern etwas Ähnliches.
Joyce Carol Oates, Ausgesetzt, Frankfurt am Main 2007, S. 24.
http://anthrowiki.at/Jiddu_Krishnamurti.
George Eliot, Silas Marner, Cadolzburg (Ars vivendi 1994), S. 26f.
P. Jayakar, J., Krishnamurti, A Biography, Arkana Penguin, 1986.
Gershwin starb am 11. Juli 1937.
Slavoj Žižek.
Alain Badiou.
John Kerr, Jump Britain, Dokumentarfilm, Channel 4 (2005).
Carol Shields, Die Geschichte der Reta Winters, München 2006.
Douglas Dunnan, aus Vorlesungsaufzeichnungen zum Thema Drehbuchschreiben, Edinburgh.
John Kerr, Jump Britain, Dokumentarfilm Channel 4 (2005).
Daniel C. Dennett, Freedom Evolves, Allen Lane, 2003.
Ebd.
Zitiert in Jean-Noël Kapferer, Gerüchte. Das älteste Massenmedium der Welt, Kiepenheuer, 1996, S. 15.
Nick Johnstone, »Beyond belief«, Observer, 12. Dezember 2004.
Anonym, irische Ballade aus dem 18. Jahrhundert, ins Englische übertragen von Lady Augusta Gregory, Donal Og (Der junge Daniel), in Seamus Heaney und Ted Hughes (Hg.), The School Bag, Faber & Faber, 1997.
David Rudrauf und Antonio Damasio, »A Conjecture Regarding the Biological Mechanism of Subjectivity and Feeling«, Journal of Consciousness Studies (2005) 12 (8–10), S. 236–262.
John Kerr, Jump Britain, Dokumentarfilm Channel 4 (2005).
David Rudrauf und Antonio Damasio, »A Conjecture Regarding the Biological Mechanism of Subjectivity and Feeling«, Journal of Consciousness Studies (2005) 12 (8–10), S. 236–262.
Holger Ursin, »Press Stop to Start: The Role of Inhibition for Choice and Health«, Psychoneuroendocrinology (2005) 30 (10), S. 1059–1065.
Testicle Tim in einer Diskussion über den Dokumentarfilm Jump Britain auf dem Mountain Bike UK Forum: http://mbuk.com/forum/default.asp.
Philip Larkin, »Dockery and Son«, 1963.
Aus The Foure Prentices of London von Thomas Heywood (ca. 1592), zitiert in: Tiffany Stern, Rehearsal from Shakespeare to Sheridan, Clarendon Press, 2000.
Aus Richard Hawkins, Vorwort zur vierten Auflage von Beaumont und Fletcher, Philaster (1628), zitiert in Tiffany Stern, Rehearsal from Shakespeare to Sheridan, Clarendon Press, 2000.
Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, de Gruyter, Berlin 1966, S. 224.
Simon Smith, Image, Persona and Law, 2. Aufl., Sweet & Maxwell, 2008.
Ebd.
Tiffany Stern, Rehearsal from Shakespeare to Sheridan, Clarendon Press, 2000.
Ebd.
Charakter in dem Sinne, wie Henry James den Begriff in einem Satz seines Romans Porträt einer jungen Dame verwendet: »Mrs. Touchett [konnte sich] eine ganze Stunde lang ungestört mit ihrer Nichte unterhalten, für die sie als ein wunderlicher und außergewöhnlicher Charakter von Interesse war, tatsächlich als eine der wenigen Charakterpersönlichkeiten, die sie bisher kennengelernt hatte.« Hier wird »Charakter« als Eindruck definiert, den eine Person bei uns hinterlässt, ein Kennzeichen, die Figur, die sie macht.
George und Ira Gershwin, They Can’t Take That Away From Me (1937).
Shaun Gallagher, How the Body Shapes the Mind, Clarendon Press, 2005.
Gallagher gehört der Richtung in der Psychologie an, die die Theorie der verkörperten Kognition vertritt, also eins der vier E der 4E-Kognition (extended, enacted, embodied and embedded), der wir im dritten Kapitel begegnet sind.
Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, de Gruyter, Berlin 1966, S. 224 u. 229.
George Eliot, Romola, Lübbe, Bergisch-Gladbach 1998, S. 307.
George Eliot, Romola, Lübbe, Bergisch-Gladbach 1998, S. 226.
George Eliot, Romola, Lübbe, Bergisch-Gladbach 1998, S. 475.
George Eliot, Adam Bede, Reclam o.J.
Daniel Dennett, Freedom Evolves, Viking Penguin, 2003.
Zitiert in Literary Supplement, 2. Juli 2004.
Lynda Milito in Zusammenarbeit mit Reg Potterton, Mafia Wife: My Story of Love, Murder and Madness (HarperCollins, 2003), zitiert in: Times Literary Supplement, 2. Juli 2004.
An dieser Stelle kommt mir ein Hinweis von Simone de Beauvoir in den Sinn: »Man wird nicht als Frau geboren – man wird es.«
Blaise Pascal, Gedanken, 252, zitiert nach Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Frankfurt a.M. 1993.
Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Frankfurt a. M. 1993.
Ebd.
Marcel Proust, Im Schatten junger Mädchenblüte, übersetzt von Eva Rechel-Mertens, Frankfurt a. M. 2003, S. 446f.
Proklos, zitiert nach Psellos, in Édouard des Places, Oracles chaldaïques, 3. Aufl., A. Segonds, Paris 1996.
Der Bericht über diese Transformation stammt aus »Steppin’ out of Whiteness« von Black Hawk Hancock, Ethnography (Dezember 2005), Bd. 6, Nr. 4, S. 427–61.
Siehe Kapitel 4, »Cosa Nostra«, der Abschnitt über den Film Freaks.
Black Hawk Hancock, American Allegory: Lindy Hop and the Racial Imagination, University of Chicago Press, 2013.
Ebd.
Shaun Gallagher, How the Body Shapes the Mind, Clarendon Press, 2005, S. 83: »Das Neugeborene achtet nicht auf die äußere Erscheinung von Personen, sondern eher auf ihre Handlungen und ihren Ausdruck … eine andere Person präsentiert mir ›Themen möglicher Aktivität für meinen eigenen Körper‹ … Der Säugling nimmt Personen weniger als Objekte wahr, als er auf der Ebene des Verhaltens und der Bewegungen spürt, dass er ihren Ausdruck nachahmen kann.«
Interessante Wesen, diese heterosexuellen Männer, die sich den habitus von Schwulen zulegen. Aber vielleicht eine gute Strategie, einen Partner zu finden?
Will Durant, The Story of Philosophy, Simon&Schuster, 1926, in einer Zusammenfassung der Gedanken der Nikomachischen Ethik.
Die namenlose Ich-Erzählerin des Romans Rebecca stellt über eine solche Zeit des Unbehagens fest: »Haltung, Anmut und Sicherheit waren mir nicht angeboren, diese Eigenschaften musste ich mir erst allmählich und mühevoll erwerben.«
Dies ist am Jom Kippur geschrieben.
Maximos der Bekenner, in: Philokalie der heiligen Väter der Nüchternheit. Verlag Der Christliche Osten Würzburg 2007, Bd. 2, S. 247.
Yayā ibn ’Adī, The Reformation of Morals, Brigham Young University Press, 2002.
Zitiert in Slavoj Žižek, The Parallax View, MIT Press, 2006. Žižek ist der Ansicht, dass das mangelnde Zusammenspiel dieser Vermögen weniger ein Problem darstellt als vielmehr der Grund der menschlichen Emotionen ist. Mensch zu sein, das heißt für ihn, bis zu einem gewissen Grad sich selbst in die Quere zu kommen und im Widerspruch zu seiner unmittelbaren Umgebung zu stehen.
Die kognitive Verhaltenstherapie nennt diese Gedanken-Gefühls-Handlungs-Ketten »Schemata«. Ansonsten beschreibt sie in etwa dasselbe mit moderneren Worten.
Wie wir im zweiten Kapitel gesehen haben, gibt es im menschlichen Leben keine Verminderung, nur stets ein Mehr an beherrschenden Gewohnheiten/Schemata/logismoi.
Noël Burch, ein Kollege des amerikanischen Psychologen Thomas Gordon.
Und nur für den Fall, dass es noch nicht hinreichend klargeworden ist: Diese Phase erhöhten Bewusstseins ist von Natur aus von Erschöpfung, Sorgen und Ängsten geplagt. Wer sich also dauernd Sorgen macht, sich schlapp und unsicher fühlt, der ist höchstwahrscheinlich noch im zweiten Akt.
Das ruft mir das Freud-Diktum »Wo Es war, soll Ich werden« in Erinnerung. Das Mantra der Besessenheit und der Gewohnheitsbildung ist dagegen: »Wo Ich war, soll Es werden.«
Rimbaud meinte: »Ich glaube nicht, dass Gewohnheiten dazu angetan sind, Trost an trostlosen Tagen zu spenden.«
Slavoj Žižek, Liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques Lacans Psychoanalyse und die Medien, Berlin 1991.
Rainer Maria Rilke, Leipzig 1923.
François de La Rochefoucauld, Maximen und Reflexionen, Nr. 527.
»Mit ›Muselmann‹ bezeichneten die Lagerveteranen aus mir unerfindlichen Gründen die schwachen, untauglichen und selektionsreifen Häftlinge.« Primo Levi, Ist das ein Mensch? Ein autobiographischer Bericht. Aus dem Italienischen von Heinz Riedt. München 1992, S. 84f.
Sartre über Sartre. Interview mit Perry Anderson, Ronald Fraser und Quintin Hoare, in: Sartre über Sartre: Aufsätze und Interviews 1940–1976; Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1977, S. 144–145.
Thomas Mann, Mario und der Zauberer.
Erich Auerbach, Dante als Dichter der irdischen Welt, Berlin/New York, De Gruyter, 2001 (Erstauflage 1929), S. 107.
Antonio Damasio, Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen, List, Berlin 2007.
Das ist vielleicht die wesentliche Aufgabe des Bewusstseins – zu entscheiden, was neu ist, was es bedeutet, wie wir damit umgehen sollten. Die Anstrengung der Unterscheidung und Überlegung, die Arbeit des Bewusstseins, sollte so bald wie möglich vollendet sein. Dann können wir wieder auf normal umschalten, auf eine neue Normalität.
Die dritte Welle der kognitiven Verhaltenstherapeuten, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie praktizieren und predigen.
»Das Dilemma des Tausendfüßlers«, Katherine Craster zugeschrieben.
Folgt man den Buddhisten, überleben uns die Sankharas, darin stimmen sie mit Dante überein. Die Wiedergeburt ist kein abstrakter Vorgang, es sind unsere Sankharas, unsere Gewohnheiten, die wiedererscheinen – unsere Wiederholungen wiederholen sich, bis sie schließlich verblassen.
Also muss man es genießen, solange es noch neu ist.
Michael Greenberg, Times Literary Supplement, 5. Dezember 2008.
Jacques Lacan, Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, in: Schriften I, S. 67.
Alain Badiou, Ethik. Versuch über das Bewusstsein des Bösen, Wien 2003.
Chris Rock, Bigger & Blacker-Tournee 1999.
John Keats, 22. Dezember 1817 in einem Brief an seine Brüder George und Thomas.
Zitiert nach P. D. Ouspensky, In Search oft the Miraculous, Harcourt, Inc., 1949.
Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer – Eine Zeit in der Hölle, Reclam 1970, S. 67.
Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung, Fink, München 2007.
You keep saming when you ought to be changing.
(Statt dich zu ändern, machst du weiter, als ob nichts wäre.)
Lee Hazlewood,
These Boots Are Made for Walkin’
Wir leben in kleinen Welten. Die meisten Filme fangen damit an, dass sie uns einen Normalzustand zeigen, genauer gesagt einen status quo ante bellum – die Lage der Dinge vor einem Krieg. Wir sehen ein von Routine und Beschaulichkeit geprägtes Leben, eine kleine Welt, um die es jedoch bald geschehen ist. Im Jargon der Drehbuchautoren heißt diese normale, dem baldigen Untergang geweihte Welt »Erster Akt«. Irgendein Ereignis, das »auslösende Moment«, wird die Handlung beschleunigen und in den »Zweiten Akt« überleiten – in den Krieg um Veränderung und Neuanpassung. Wir ziehen es gewöhnlich vor, im Status quo, in der vorhersehbaren Beschaulichkeit, zu verharren. Ohne triftigen Grund und zwingende Notwendigkeit bewegen wir uns nicht vom Fleck. Wir brauchen einen Anstoß. So etwas kommt vor. Die Dinge ändern sich. Die Filmemacher beenden den ersten Akt gern ziemlich schnell und konzentrieren sich auf das Spektakel der Veränderung und Neuanpassung. Genau darin liegt das Drama, und eben dafür zahlen wir das Geld an der Kinokasse.
Aber im Leben wie in diesem Buch ist die Gewichtung anders. Unser erster Akt, unser normales Leben, dauert in der Regel länger, und das gefällt uns auch so. Als Gewohnheitsmenschen leben wir in Welten, die für uns so überschaubar und vertraut genug sind, um immer wieder auf dieselbe Weise zu agieren und zu reagieren. Solange uns nicht unbehaglich zumute ist und uns inner- oder außerhalb dieser Welt nichts stört, belassen wir alles am liebsten so, wie es ist. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich der erste Akt dieses Buchs – Verharren: Wie wir Gewohnheitsmenschen uns bemühen, unsere Lebensweise zu entwickeln und an ihr festzuhalten.
Unsere Lebensweise und unsere Routinehandlungen beruhen zum guten Teil auf Denkmustern und immer gleichen Handhabungen. Unsere Gewohnheiten sind jedoch nicht nur innerlich, in Muskeln und Nerven, festgeschrieben. So wie Vögel ihre Nester auspolstern, betten wir unsere Lebensweise in die Orte ein, an denen unser Leben stattfindet. Wir schlagen Pfade durch unsere Umwelt und umgeben uns mit Menschen, die uns wie in einem Spiegel gewahr werden lassen, wer wir sind und was wir tun. Somit besteht unsere kleine Welt aus Gewohnheiten, Routinen, Menschen, Orten und Dingen, die uns vertraut und angenehm sind. Das ist das Themenfeld des ersten Teils dieses Buchs, der Ausgangspunkt unserer Reise. Um einen wissenschaftlichen Begriff zu verwenden – keine Angst, ich werde es damit nicht übertreiben –, könnte man das als homöostasis, als Selbstregulation, bezeichnen. Aber kehren wir zum Kino zurück. Wie in einem Spielfilm zeigt uns der erste Akt dieses Buchs die Beschaffenheit der Welt, bevor eine Störung oder Unruhe uns zwingt, die schwierige Aufgabe des Überlegens und der Neuanpassung anzupacken.
Unweigerlich werden irgendwelche »Nachrichten aus aller Welt« unser Routineleben durchkreuzen. Und schon beginnt der Krieg. Für das Ende unserer kleinen Welt kann es vielerlei Ursachen geben. Es muss nicht gleich der Weltuntergang sein wie in so vielen Filmen. Wahrscheinlicher ist, dass unsere alte Welt endet, weil wir einen neuen Job ergreifen oder unseren bisherigen verlieren, eine neue Beziehung eingehen oder die alte beenden. Aber zu Ende gehen wird sie. Und so werden wir mit einer tiefverwurzelten physiologischen Schwerfälligkeit und widerwillig den mühsamen Prozess des Wandels anpacken – den zweiten Akt, mit dem sich die zweite Hälfte dieses Buchs beschäftigt.
Der zweite Akt – Veränderung – beginnt immer mit den schwierigen ersten Schritten der Neuanpassung, durch die man sich allmählich an eine neue Seinsform gewöhnt. Weil das zunächst wirklich hart ist, wehren wir uns dagegen. Jedem Anfang wohnt ein Schrecknis inne, nicht weniger als jedem Ende. Jetzt befinden wir uns im Prozess der allostasis, dem Versuch, angesichts der Veränderung wieder Stabilität zu gewinnen und einen neuen Normalzustand der Behaglichkeit und Vertrautheit zu finden. Erhöhte Erregung und Konzentration kennzeichnen diese Zeit des Übergangs. Sie sind stets präsent, wenn wir versuchen, uns an den Rhythmus des Neuen anzupassen, und setzen uns innerlich konstant unter Druck, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren, zu einer neuen Normalität. In derart schwierigen Zeiten ist es oft einfacher, in alten Gewohnheiten Trost zu suchen, auch wenn sie nichts zur Veränderung beitragen. Aber genau das verschafft uns einen kurzen Blick auf die Ursachen vieler unserer Leiden: Manchmal bemühen wir uns zu sehr, das Ende des Veränderungsprozesses zu erreichen, ihn erst gar nicht anzupacken oder ihn überhaupt zu vermeiden, während wir schon mitten in ihm stecken. Wir begnügen uns mit unseren alten Antworten, obwohl neue erforderlich wären; wir verharren, obwohl wir uns verändern sollten.
Dieses Problem, den Spannungsbogen im Drama der Veränderung, werden wir im zweiten Akt erörtern, bevor wir den dritten Akt betrachten, die Herstellung einer neuen Normalität, einer neuen kleinen Welt.
Keine kleine Aufgabe: Ein ganzes Buch liegt vor mir – vor uns. Für meine Reise habe ich wie ein Kletterer, der einen Berg erklimmen will, oder wie ein General vor der Schlacht einen detaillierten Plan ausgearbeitet. Schon früh war mir klar, dass ich den Akt der Hingabe hervorheben will, der nötig ist, wenn man etwas so grundsätzlich Unwahrscheinliches beginnen und durchhalten will, wie es das Bücherschreiben ist. Erst kürzlich kam mir dazu ein Bild in den Sinn: gegen den Strom schwimmen, gegen die Flut des Zerfalls und Untergangs, gegen die langsame, schleichende Zerrüttung der Ordnung ankämpfen. Sich dagegenstemmen, dass wir, Sie und ich, uns jeden Tag und in jeder Hinsicht verschlechtern, unser Gedächtnis, die Zähne und den Kampf darum verlieren, einfach so zu bleiben, wie wir sind, geschweige denn uns zu verbessern. Dabei dreht sich doch alles darum, sich zu verbessern. Ich könnte mein Buch sogar mit »Besser werden« betiteln, das wäre treffend. Denn Menschen und Verhältnisse werden tatsächlich besser. Das klingt unwahrscheinlich und widerspricht dem zweiten Gesetz der Thermodynamik – der zwangsläufig zunehmenden Unordnung –, aber gelegentlich bessern sich die Verhältnisse. Ich jedenfalls glaube daran.
Als Therapeut habe ich Menschen begleitet, die gegen den Strom schwammen und sich mühsam hochkämpften. Diese Metaphern treffen genau ins Schwarze. Um gegen die vorherrschenden Kräfte der Gewohnheit, der Trägheit und des allmählichen Verfalls anzuarbeiten, ist tatsächlich eine gewisse Anstrengung erforderlich. Sie aufzubringen ist nicht einfach – zumindest nicht von Beginn an. Die ersten Schritte sind nichts als Anstrengung, ohne Belohnung. Durchhalten erfordert eine hartnäckige Mischung aus Glauben an den Prozess, Hoffnung auf Veränderung und das Engagement für ein Ziel, das nicht von den vorherrschenden Bedingungen bestimmt ist. Mit einem Wort: Hingabe. Das ist anfangs in der Tat schwierig.[1]
Also warum sich plagen? Was bringt uns dazu, uns zu ändern? Nun, manchmal müssen wir es, und manchmal sehen wir einfach, dass Dinge besser sein könnten, als sie sind. Wir erfassen mit einem kurzen Blick die Zukunft; wir haben eine Vision, die nicht bloß eine Weiterführung der Gegenwart ist. Und wenn diese Vision verlockend ist, kommt Begehren ins Spiel – die Sehnsucht nach anderen Verhältnissen als den jetzigen. Mit der Vision und dem Begehren haben wir eine gute Ausgangssituation. In ihrem Gefolge ergibt sich eine Beschleunigung der Energie, der Beginn einer Dringlichkeit, der Impuls zur Veränderung. Vision, Begehren und Dringlichkeit – das ist bereits ein Motivationstrio. Aber selbst dann noch könnte man einen Rückzieher machen und den Impuls verhallen, das Begehren verebben und die Vision verblassen lassen. Wenn man es lange genug ignoriert, hört das Trio irgendwann auf, einen zu quälen. Auf die Frage, ob wir dabei eine Wahl haben, werden wir später noch kommen; vorläufig wollen wir festhalten, dass es anscheinend kleine Momente gibt, in denen alles vorhanden ist und wir nichts anderes tun müssten als handeln. Mach was draus. »Also, wenn du dich so fühlst, warum änderst du dann nichts?« Jeder kennt solche Momente aus eigener Erfahrung oder aus dem Fernsehen. Den Moment der Entscheidung. »Na schön, ich mach’s.« Und dann tut man es, weil man will. Wenn man seinen Willen durch Handeln bekundet, tritt eine Veränderung ein. Anfangs vielleicht nicht so sehr, letzten Endes aber doch. Dann ist aus etwas Möglichem etwas Wirkliches geworden; man hat etwas Neues begonnen und in die Welt gebracht. Ein magischer Moment – ein seltener Moment. Jeder Anfang ist schrecklich, jedes Ende ebenfalls.
Der Streckenverlauf auf meinem Schlachtplan ist so aufregend wie herausfordernd. Allein in diesem Buch sind zehn Kapitel zu durchqueren und danach, in weiter Ferne, warten zwei weitere Bücher auf mich.[2] Hoffentlich gerate ich nicht ins Straucheln. Ich widme mich diesem Projekt über die Veränderung in der Hoffnung, dass es Veränderung bewirkt. Ich widme mich der Vorstellung, dass – so unwahrscheinlich und naturwidrig es scheinen mag – Menschen besser werden, besser, was ihre Lebenseinstellung angeht, besser in dem, wer sie sind, und besser darin, das Leben mit Anstand, Humor und Mut zu meistern. Manche Leute meistern ihr Leben auf bewundernswerte Art, anderen hingegen gelingt es ganz und gar nicht. Manche verharren in schlimmen, belastenden Verhältnissen und Haltungen und verkümmern immer mehr. Das ist kein Zufall – Menschen stecken fest oder bleiben wandlungsfähig, weil Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich mit dem Verharren und der Veränderung umgehen.
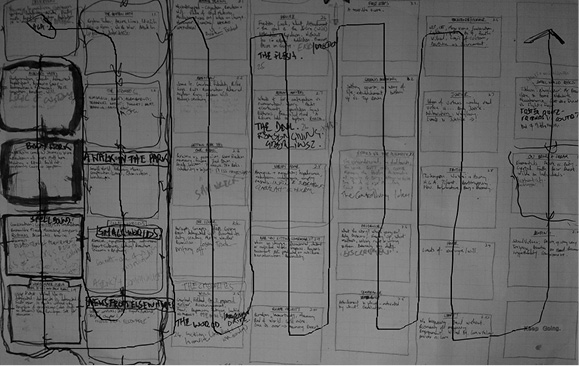
Der Schlachtplan
Beruflich und persönlich habe ich einen Logenplatz im Theater der Veränderung. Mir dämmert allmählich, wie sie vonstatten geht und warum die einen Menschen feststecken und die anderen freikommen. Darüber wissen wir eigentlich schon eine ganze Menge, denn seit Jahrhunderten, seit den frühesten Schriften zur Ethik und Moral bis hin zu den Publikationen heutiger Therapieschulen, wird über die Methoden der Veränderung nachgedacht. Parallel dazu gibt es die Studien zur Natur des Menschen, von der antiken Seelenkunde über die frühmodernen Analysen zum Ich und zur Identität bis hin zu den aktuellen Modellen neuronaler Netzwerke der Hirnwissenschaft: Beschreibungen dieses besonderen Lebewesens, dem »Steckenbleiben« und Veränderung widerfährt. Meine Vision ist, all dies nahtlos und klar zusammenfassen und zu einer kohärenten Version dessen, was Menschsein bedeutet, bündeln zu können, um zu zeigen, was den Menschen ausmacht und warum und wie er schlechter oder besser wird, steckenbleibt oder es schafft, sich zu befreien. Ich hoffe, damit eine Hilfestellung zu geben – das ist mein Begehren. Und ich weiß, ich will das für mich tun, mitten in der Reise des Lebens Inventur machen und herausfinden, wie viel Lebenserfahrung ich erworben habe, um sie für meinen zukünftigen Weg zu nutzen, bevor es zu spät ist. Das ist es, was mich Dringlichkeit verspüren lässt. Den bisherigen Lebensweg zu rekapitulieren und bewusster weiterzugehen heißt: Lass dich weniger treiben, verbessere dich. Deshalb widme ich mich diesem Buch.
Und ich widme dieses Buch Lenny, Sara, Sarah und Ben und Jamie, James, Andrea, Charlotte, Ish, Lilian, Isobelle und Hughie, Elayne, Stevie und Ian, Abhi und Vicky.
Aber zuerst, noch vor dem ersten Akt, ein kurzes Vorspiel – »Der ausgetretene Pfad«. Das Anlegen von Wegen ist das zentrale Thema dieses Buchs: wie unsere bewährten Pfade uns definieren, wie wir auf ihnen steckenbleiben und uns mühen, neue zu schaffen. Dabei haben wir hauptsächlich die individuelle Ebene im Blick und beschäftigen uns damit, wie gewöhnliche Menschen das Verharren und die Veränderung erleben. In diesem einleitenden Vorspiel richten wir unsere Kamera darauf, wie das Anlegen von Wegen den Großteil unseres Lebens bestimmt.
Der ausgetretene Pfad
Eine Art Ouvertüre, in der sämtliche Themen aus dem Buch anklingen. Vor allem konzentrieren wir uns auf den Prozess, durch wiederholte Handlungen Lebenspfade anzulegen. Dies betrachten wir auf der Ebene des Individuums, anhand banaler Vorgänge wie etwa dem Erlernen des Autofahrens, aber auch im weiteren Sinne am Beispiel der Herausbildung der Kultur und am Evolutionsprozess. Abschließend untersuchen wir, wie wichtig für unser Selbstgefühl das Anlegen von solchen Lebenspfaden sein könnte.
Wie legt man in jungfräulichem Schnee eine Straße an? Ein Mann geht voraus, schwitzend, fluchend, und bewegt dabei kaum die Füße …
Fünf bis sechs Leute folgen Schulter an Schulter der engen, schlingernden Fährte des ersten Manns.
Warlam Schalamow,
aus Erzählungen aus Kolyma (1978)
Seltsame Wechselwirkung:
Die Verhältnisse, von uns geschaffen,
Sie schaffen am Ende uns.
Philip Larkin, »The Daily Things We Do« (1979)
Es gibt ein Phänomen, das Stadtplanern und Landschaftsarchitekten zeigt, was die Menschen wirklich wollen, wünschen und begehren – ein System von Linien, das man auch schlicht als »Trampelpfade« bezeichnen kann. Der neue Park unweit meines Hauses bietet dafür ein Musterbeispiel. In diesem Park wurden elegant geschwungene, beidseits von jungen Büschen und Bäumen gesäumte Pfade angelegt, die den Spaziergänger an frisch eingesäten Rasenflächen vorbeileiteten. Die Parkbesucher waren gehalten, diese malerischen Umwege nicht zu verlassen. Von der Hauptstraße führte einer der Pfade zum Eingang eines großen Supermarkts. Der Supermarktbetreiber selbst hatte die Parkanlage in Auftrag gegeben, um seinen unansehnlichen Kommerzklotz ein wenig aufzuhübschen. Der besagte Pfad war geschwungen wie ein Bogen, er schnitt eine graue, sanfte Schneise durch das junge wuchernde Gras, lud die Passanten zu einem Spaziergang auf ihrem Weg zum Supermarkt und zurück ein, ermutigte sie, stehenzubleiben und den Duft der Rosen zu schnuppern. Was wir, die Kunden, natürlich nicht taten. Auf dem Hinweg mit Wünschen, Wollen und Begehren und auf dem Rückweg mit Einkaufstüten beladen, zogen wir die Zweckmäßigkeit dem vorgeschriebenen Umweg vor. Wir stimmten mit den Füßen ab. So zeichnete sich allmählich eine Linie mitten im Gras ab, die die beiden Enden des Bogens wie seine Sehne miteinander verband. Im Laufe der Zeit trat sie immer deutlicher hervor und verlor ihre grüne Farbe. Bald war daraus ein fester Trampelpfad entstanden – eine straffe, muskulöse Bahn, eingekerbt von Wünschen, Wollen, Begehren und Notwendigkeit. Man könnte diesen Pfad auch als Zeugnis einer Entscheidung der Nutzer bezeichnen, aber nicht nur als Zeugnis, sondern als einen neuen Vorschlag, eine neue Anweisung und einen neuen Lösungsweg für das Problem, zum Supermarkt und wieder zurück zu kommen, der im Widerspruch zur offiziellen Vorschrift stand.
So kann sich das Begehren in die Landschaft einschreiben und ein großes Zeichen setzen. Niemand hatte es geplant oder genehmigt, dennoch kam es zustande. Das Begehren vieler hatte sich zum Ausdruck gebracht. Das ist keineswegs außergewöhnlich. Alle Pfade, die von hier nach dort führen, alle Orte, die sie verbinden, sind samt und sonders Ausformungen des Begehrens. Unter politischem Aspekt würde man fragen, um wessen Begehren es sich handelt – cui bono? –, das heißt, wem ist diese spezielle Ausformung von Nutzen? Im Fall des Parks ist der besagte Trampelpfad insofern bemerkenswert, als er eine eminent anarchische Geste darstellt, obwohl er gleichzeitig einen Herdentrieb verrät – den Wunsch, möglichst rasch auf die Weide des Konsums zu gelangen. Auch Schafe legen Trampelpfade, Wunschlinien, zu ihren Trögen an. Die offiziellen Chausseen und Parkwege unserer wohldurchdachten Welt sind also das genaue politische Gegenteil dieses primitiven Herdenverhaltens. Es gibt eine urbane Legende, die von solchen Wunschlinien oder Trampelpfaden handelt, eine Fabel, in der es darum geht, wie wir uns Stadtplanung eigentlich wünschen: Irgendwo in Amerika wurde einmal ein neues College gebaut. Die Gebäude waren über eine große Fläche verteilt, also brauchte man Verbindungswege. Anstatt sie einfach vorzugeben oder zu mutmaßen, wo die Menschen entlanggehen wollten, beschlossen die Planer, erst einmal das Verhalten der Studenten abzuwarten. Also säten sie den Campus mit frischem Rasen ein, legten aber keine Wege an. Die Studenten konnten umherlaufen, wie es ihnen gefiel. So entstanden im Laufe eines Jahres Trampelpfade des natürlichen Begehrens und der Notwendigkeit. Erst dann wurden sie gepflastert, erst dann wurde ihre anarchische Spontaneität in Stein festgehalten. Vielleicht enthält diese Legende aber doch einen Kern an Wahrheit darüber, wie unsere Welt insgesamt entstanden ist – aus einer seltsamen Wechselbeziehung zwischen den Kräften unseres ganz natürlichen menschlichen Begehrens und den Kräften, die sie kontrollieren und eindämmen wollen. In der Anfangsphase jeder Kultur wird es erste Schritte gegeben haben, durch die Begehren und Notwendigkeit ihre rudimentäre Form in die Landschaft skizzierten. Diese Form wiederum lenkte das nachfolgende Begehren wie ein Flussbett das Wasser. Dadurch wurden die ausgetretenen Pfade immer dauerhafter und zwingender und die Bewegungen des Kollektivs immer zusammenhängender. Bewusstes menschliches Wirken – also die Entscheidung, den Pfad richtiggehend anzulegen oder besser die gemeinsame Nutzung des Pfads gutzuheißen – ist in diesem Prozess erst ziemlich spät vonnöten.
Hierbei ist eine Dialektik von Kraft und Form am Werk. Die rohe Kraft der menschlichen Zwänge, der Mängel und Notwendigkeiten, die uns antreiben – Hunger, Wut, Sex, Freude, Neugier –, wird in Bewegungen und Handlungen übersetzt. Diese Bewegungen und Handlungen sind nicht wahllos, denn manche befriedigen unsere Bedürfnisse effektiver als andere. Ein paar willkürliche Beispiele: Bestimmte Handelsrouten sind profitabler als andere; an einer bestimmten Stelle ist der Fluss besser zugänglich, wenn man ihn befahren oder an seinem Ufer angeln will; ins Nachbardorf gibt es eine »beste« Strecke. So werden bestimmte Bewegungen und Handlungen öfter wiederholt als andere, dadurch festgeschrieben und zur Routine. Diese Routinen, die rudimentären Ausformungen des Begehrens, beginnen Zeichen zu hinterlassen, entäußern sich als Pfade oder sogar als Geschichten darüber, wie man sie am besten anlegt. Und diese Zeichen – die dauerhaften Formen und greifbaren Manifestationen des Begehrens – sind das, was wir Kultur nennen.
In La Rabbia (Der Zorn) und in seinen Filmen insgesamt geht der italienische Dichter und Filmemacher Pier Paolo Pasolini der Frage nach, wie die Erde ausgesehen hatte, bevor sie mit den Zeichen des Begehrens überlagert wurde. Das ist, als würde man im zusammengetretenen Matsch zur Mittagszeit den Neuschnee des frühen Morgens erkennen wollen. Eine Frage zieht sich durch Pasolinis Werk: Wie würden wir aussehen, wären wir nicht überflutet von Kultur, die er in La Rabbia als »die alten, blutenden Straßen der Erde« bezeichnet? So drehte er einen Kurzfilm über seine Suche nach den Schauplätzen des Ersten Evangeliums – Matthäus, das zu einer makellosen, schlichten Nacherzählung der Heilsbotschaft geriet. In diesem Film sehen wir, wie Pasolini zusammen mit einem Priester die Christuskirche in Jerusalem besucht. Pasolini ist beeindruckt von dem Kontrast zwischen der Pracht des Gotteshauses und dem schlichten Felsen, auf dem er errichtet ist, zwischen der grandiosen Architektonik der Christenheit und ihrem Fundament der Bescheidenheit und Einfachheit. Es ist das Jahr 1964, und Pasolini, Marxist und Atheist, war zwei Jahre zuvor wegen eines Films zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. In der Schlussszene stirbt ein armer Bursche, gespielt von einem Laiendarsteller, am Kreuz. Der katholischen Kirche missfiel diese Gleichsetzung des Subproletariats mit Christus und verklagte Pasolini wegen Gotteslästerung. Deshalb war er vorsichtig geworden. Bei seinen Überlegungen zu diesem neuen kinematographischen Leben Christi beschloss er, vor Beginn der Dreharbeiten einen Experten des Vatikans zu Rate zu ziehen. Seine Frage lautete: Dürfte er dieses Prachtbauwerk der Christenheit abtragen und den schlichten Felsen zeigen, auf dem es errichtet war? Oder es zumindest versuchen? Darf ich das tun, fragt er den Priester, als sie vor dem Heiligtum stehen, darf ich den Tempel abreißen, darf ich die blanke, einfache, schlichte Wahrheit zeigen, bevor sie überlagert und überbaut wurde mit all dieser Grandiosität? Ja, sagt der Priester, das darfst du. Du bist dazu befugt.
Ähnlich Rimbaud, jenem anderen visionären Poeten, misstraute Pasolini unserem gedankenlosen Erbe der Trampelpfade, die wir jeden Tag einschlagen, diesen alten, blutenden Straßen der Erde. Die Zukunft wird nicht aus dem Nichts herbeigezaubert. Die Zukunft ist die wiederaufgefrischte Vergangenheit mit ihren Pfaden, nunmehr verstärkt, verschönert, tiefer eingekerbt mit starker und immer stärkerer Hand. Die Gegenwart ist eine Art Denkmal der Vergangenheit, sowohl ein lebendiges Monument, das die Erinnerung an sie bewahrt, als auch ein totes Gewicht, das sie verdunkelt. Die Gegenwart bewahrt und löscht zugleich aus. Eltern wissen das, so wie jeder es weiß, der schon einmal etwas hat heranwachsen sehen. Jede neue Version löscht die vorherige aus: Das Kind mit fünf Jahren tilgt das Kind mit vier, der Heranwachsende löscht den Knirps aus, bewahrt aber auch einen Wesenskern, von dem wir meinen, wir würden sehen, wie er sich vor uns entwickelt und reift. Das Gesicht wird klarer konturiert, die Gesten sicherer, die Stimme stärker. Die Gegenwart als Vergangenheit – noch einmal, mit Gefühl.
Erst heidnischer Tempel, dann Kirche und heute Versammlungsraum für Yoga und Meditation: Unsere spirituellen Gemeinschaften finden sich in der Regel immer an denselben Orten zusammen, auf denselben Flecken geheiligter Erde. Wie mit Gott, so verhält es sich auch mit dem Mammon. Geld hat die Tendenz, sich nicht vom Fleck zu rühren. Man beachte, wie die Einkaufsviertel der Städte unablässig renoviert werden. Die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der Infrastruktur und des Designs werden eiligst dem Geld dargebracht wie der Tribut dem Monarchen, während die Technologie von dem Begehren angetrieben wird, das Geld zu besänftigen und ihm das Leben zu erleichtern. Diese Teile des Stadtkörpers, diese Stadtbezirke, sind vermutlich die absolut modernsten, strahlendsten und neuesten, aber zugleich gehören sie zu den ältesten und dauerhaftesten. Genau genommen funktionieren sie eben dank ihres Alters so reibungslos. Die Pfade des Geldes sind gut ausgetreten und werden laufend gepflegt. »Unter dem Pflaster liegt der Strand!«, lautet die alte Parole der Situationisten, die uns wie zuvor schon Pasolini und Rimbaud daran erinnern, dass es ein Vorher gab vor all diesem Bauen und all dieser Enkulturation, die wir als Gemeinschaft und als Individuen erfahren haben. Unter dem Pflaster liegt eine gut befestigte Straße, unter ihr eine Trasse, darunter ein Pfad und unter diesem eine ausgetretene Spur. Unter dem Pflaster ist das Begehren, sich zu bewegen, in die Erde eingekerbt.
Interessant, die neuen Technologien bei ihrem Wirken zu beobachten. Man beachte, wie durch das Internet ein völlig neues Netz von Pfaden geschaffen wurde und das alte Begehren auf diesem neuen Terrain wiedererstrahlt. Geschwätz und Sex, Geld und Gewalt, das unstillbare Begehren nach Gemeinschaft, all die alten Triebe auf neuen elektronischen Pfaden.
Aufwendig, die Spuren des Begehrens zu löschen. Man denke nur an die Schwulenviertel in den Großstädten, einst Jagdreviere hinterhältiger Krimineller und Schlupfwinkel der Gesetzlosen. Aber sie bestanden viele Jahre an gleicher Stelle fort, bis das Gesetz einstweilen dieses besondere Begehren legitimierte und es nach und nach ans Licht der Öffentlichkeit trat. Heute können Schwule speziell auf sie zugeschnittene Stadtpläne kaufen. Wie viele Leben hätten solche Stadtpläne vor nicht allzu vielen Jahren geändert, als noch kaum jemand wusste, dass es inmitten der Städte solche exotischen Länder überhaupt gab? Denken Sie nur an all die verschlüsselten, immer noch geheimen Geographien, die unterirdischen, marginalen oder illegalen Ströme, die unsere unmittelbare Nachbarschaft durchziehen. Von den Drogen bis zur Freimaurerei, von Elvis-Fans bis zu den Swingern und Doggern hat jedes Begehren seine eigne Landkarte und hinterlässt seine Zeichen für jene, die sie finden und lesen können. Es bedarf einer wirklichen Zerstörung, um die Spuren des Begehrens zu löschen. Auch die Erde hat ihre festen Gewohnheiten.
Ich werde bald den Führerschein machen. In meiner Vorstellung geben sich die Teile meines Körpers dem Fahren hin, als wäre es ein Feld mit jungfräulichem Schnee, eine Landschaft, die noch nicht vom Begehren gezeichnet ist. Das wird Mühe kosten, willentliche und bewusste Mühe – zumindest anfangs. Bei ersten Schritten ist das immer so. Denn es müssen Handlungsabfolgen erlernt werden, Routinen der Kombination und Koordination grober und feiner Muskelbewegungen mit einer ganzen Reihe neuer sensorischer und wertender Prozesse. Zuerst muss ich intensiv nachdenken und überlegen. Meine Bewegungen werden sehr bewusst, schwerfällig und unbeholfen sein – solange sie der Überlegung bedürfen. Erst wenn die inneren Pfade immer wieder durchschritten worden sind, erst durch reine Wiederholung und Mühe, durch willentliche, überlegte, bewusste, anstrengende, verflucht schweißtreibende, schmerzhafte und unbeholfene Wiederholung, erst dadurch werde ich gut werden, erst wenn es anfängt, mühelos, unüberlegt, unbewusst und automatisch zu sein. Ich brenne darauf.
»Ein Spaziergang im Park« ist ein Bild für Gelassenheit, denn der Park weiß, wie man spazieren geht. Er tut das für uns. Ein guter Park antizipiert unser Begehren. Antizipiertes Begehren ist der Schlüssel zum Müßiggang. Manche Leute nehmen viel Geld dafür, damit sie für uns herausfinden, was wir gerne tun möchten. Man kümmert sich um uns, damit wir selbst uns nicht kümmern müssen. Das gute Hotel, der Vergnügungspark, die Spielhalle, die Kneipe, das Kino – sie alle befreien unser Bewusstsein von der Last, darüber nachzudenken, was wir als Nächstes tun wollen. Denken Sie nur an jene schwierigen ersten Tage mit einem neuen Gegenstand – einem Computer oder einem Handy, einer Gitarre oder einem Auto, oder an eine Beziehung, in der Sie sich jetzt wohl fühlen. Dabei gilt es, die richtigen Abläufe zu erlernen, zu verstehen, was sie bedeuten, wie man sie vollführt und wann, was man wobei nicht machen darf – man muss wiederholen, üben und experimentieren: »Haltung, Anmut und Sicherheit waren mir nicht angeboren, diese Eigenschaften musste ich mir erst allmählich und mühevoll erwerben.«[3] Natürlich möchten wir die bitteren Momente rasch hinter uns lassen, Mühelosigkeit und Gelassenheit erlangen, vertraut sein mit diesem Neuen. Doch mit Hast klappt das nicht. Nur Zeit und Wiederholung bringen Gelassenheit. Dann wird das Neue zur zweiten Natur, zum Spaziergang im Park.
Zweite Natur. Eine Redensart – aber was ist denn die erste, was kommt von Natur aus als Erstes? Vieles. Denn wie es scheint, ist der Schnee eigentlich gar nicht so jungfräulich, und zahlreiche Routinen sind als Standard vorgegeben. Die alten, blutenden Straßen der Erde sind schon in uns eingegraben. Die weitverzweigte Architektur unseres Gehirns und unserer Nerven wartet auf die Welt und ahnt bereits deutlich voraus, wie sie sein wird. Sie wartet auf Raum und Zeit, ist bereit für die Sprache, sieht Bewegung und andere Menschen voraus, ist vorbereitet auf Sex und Gewalt, Angst und Schrecken. Wie die Parks und Städte öffentliche Zeugnisse für Jahrtausende von Problemlösungen sind, für ein bis zum Erreichen der Gelassenheit ermöglichtes Begehren, so sind wir das Archiv von Millionen Jahren intensiven Nachdenkens über diese Welt. Wir kennen die Welt bereits, so wie unsere Lungen die Luft kennen und unsere Nieren das Wasser. Gewicht und Form der Welt haben uns in Größe und Gestalt geprägt, ihr Licht unsere Augen erfasst, ihr Lärm nach unseren Ohren verlangt, ihre Nahrung und ihr Wasser unseren Mund, die Zähne und Eingeweide modelliert, ihre Erde, Wurzeln und Zweige unsere zupackenden Hände geformt. Wir selbst, die neueste und kürzeste Verbindung zwischen Begehren und Erfüllung, sind komplizierter von Mustern und Pfaden durchzogen als die gesamte Welt. Man stelle sich das erstmalige Auftreten von Hunger vor, wenn Materie verzweifelt ihre Struktur zu erhalten versucht, indem sie andere Materie raubt – elementare Regungen plumper, primitiver Molekularstrukturen, denen es gelingt, die Erde zu kannibalisieren, sich zu erhalten und zu reproduzieren. Stellen Sie sich die ersten Schritte des Hungers vor, die Urbewegungen des Begehrens, den Beginn des Lebens. Sehen Sie, wie gut es gelungen ist und wie leicht es uns fällt, uns zu ernähren und eine atemberaubend komplexe Struktur intakt zu halten und zu reproduzieren, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Sie wissen einfach, wie es geht; Sie sind für diese Welt, durch sie und aus ihr gemacht. Sie sind das Zeugnis, die Verkörperung des unablässigen Begehrens des Lebens und aus dem Staub und dem Wasser in winziger molekularer Schrift transkribiert, übersetzt und eingeschrieben ins Fleisch. Das Wissen einer Milliarde Jahre Leben in dieser Welt entfaltet sich in Ihnen, es ist Sie. Sie sind das neueste Modell, das jüngste Experiment des Lebens.
Die Welt fließt in unserem Blut. Der Hunger in uns ist eine Milliarde Jahre alt. Manchmal kommt dieses Urzeitliche in uns flüchtig zum Vorschein. Wir ahnen es ein wenig, wenn wir vom »Reptiliengehirn« sprechen oder lesen, dass wir nur ein Transportmittel für unsere Gene sind, die schon seit einer Milliarde Jahre existieren. Viele wichtige Teile unseres Körpers sind tatsächlich Millionen Jahre alt. Die Wissenschaft versucht zu zeigen, was lediglich ein Faktum ist, hat aber Mühe, uns das Gewicht der Jahre spürenderart gut
Reaktion,
[4]
. Die Psychoanalytikerin Melanie Klein versuchte intensiver als die meisten ihrer Zunft, sich den Beginn unseres Selbst, das prähistorische »Ich«, auszumalen. Für sie war dieser Beginn mit Monstrositäten angefüllt. Es habe weder ein Selbst noch ein Nicht-Selbst gegeben, sondern einfach nur Scheiße, Zorn, Titten, Angst, Schwanz, Milch, Neid – eine unheilige Zusammenballung von Teilen und Kräften, ähnlich jenen abgetriebenen Föten, die aus Zähnen und Haar bestehen. Für Lacan besteht der Körper aus Teilen – aus getrennten Gliedern –, die sich bemühen, ein Ganzes zu bilden. Und heute versucht die Wissenschaft vorherzusagen, wie viel ein Baby weiß, wie viel Welt bereits in uns angelegt ist und darauf wartet, sich zu entfalten. Dafür verwendet sie Begriffe wie Gesichtserkennung, Objektpermanenz, Spracherkennung – nach wie vor Begriffe von Teilen und Kräften, diesem und jenem, ohne Vorstellung von ihrem Zusammenhalt und davon, wie es ist, diese inkohärente Gewebemasse zu sein, die wir alle einst waren. Wenn wir zurückblicken, sehen wir unser Selbst nicht dort seinen Anfang nehmen, denn wir scheinen erst viel später zu beginnen. Unsere frühesten Erinnerungen beziehen sich auf Dinge außerhalb dieser Sphäre, auf Ereignisse in einer Welt der Vorkommnisse, die dieses Ich, dieses kleine Selbst, erfährt. Unser wirklicher Anfang ist in Dunkelheit gehüllt. Unter der kohärenten Ordnung der rationalen Welt, vor dem Licht der Vernunft und der Vernünftigkeit, das die Welt erhellt, wo immer wir einen Blick auf sie werfen wollen, unter dieser vertrauten Welt liegt was? Die Wissenschaftler und Analytiker können nur andeuten, raten oder verklären, aber sie scheinen sich in einem Punkt einig zu sein: Jenes »vor« der jetzigen Kohärenz liegt in einer Zeit des Chaos. Unser Sinn für Kontinuität, diese Kohärenz, die in Frage zu stellen, geschweige denn wahrzunehmen wir selten Grund haben, musste geformt werden, Ordnung musste auferlegt, Kohärenz hergestellt, Sinn gestiftet werden. Es gab kein Ich, das das getan hätte, denn das Ich war erst das Ergebnis davon. An einem gewissen Punkt begann das »Ich«, das wir alle sind, die lebende, atmende Welt zu formen, die wir jetzt bewohnen, und ab einem gewissen Punkt begann diese Welt ein »Ich« zu formen. Diese seltsame Wechselbeziehung hat uns entstehen lassen. Welch ungestüme Energien müssen wir mühevoll gezügelt und gezähmt haben, mit welcher heimlichen Stärke haben wir jene Urkräfte gebunden und geformt, die ebenfalls wir und uns selbst aus dem Chaos befreit und die ersten Ansätze von Kohärenz und Ordnung gefunden. Den Anfang. Wie fangen wir an? Wo beginnen wir?
rupta via,