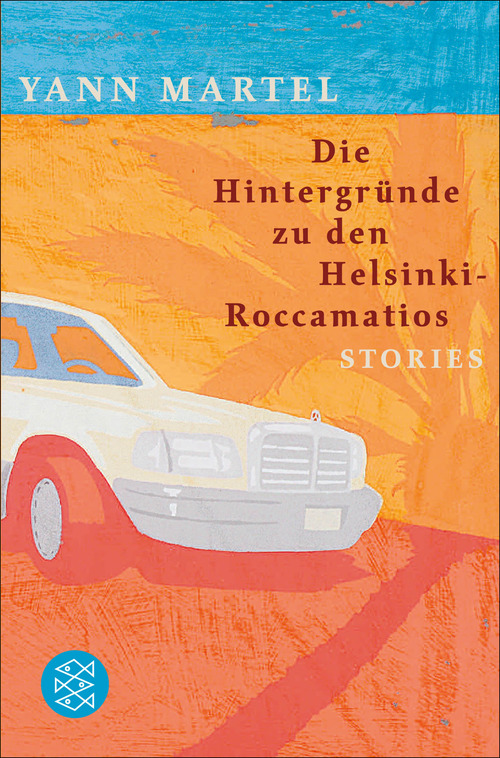
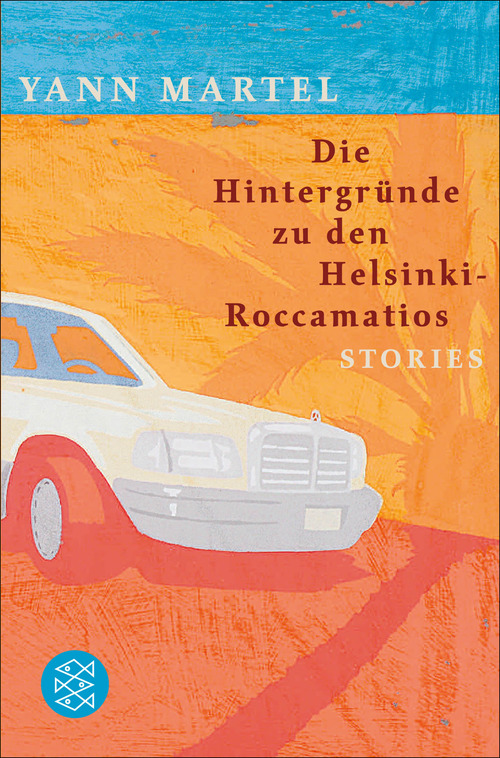
Yann Martel
Die Hintergründe zu den Helsinki-Roccamatios
Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
FISCHER E-Books

Yann Martel, 1963 in Salamanca geboren, studierte in Kanada, arbeitete als Tellerwäscher und Nachtwächter und lebt, falls er nicht gerade auf Reisen ist, in Montreal. Sein Roman »Schiffbruch mit Tiger« wurde mit dem Booker-Prize ausgezeichnet, in 36 Sprachen übersetzt und erreichte weltweit eine Auflage von 1.25 Millionen Exemplaren.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Bereits lange bevor Pi Patel mit dem Tiger Schiffbruch erlitt, erzählte Yann Martel vom Aufbruch junger Helden in die Welt: Unbekümmert denken sie sich die Welt auf eigene Faust zurecht, bis Ihnen die Wolken auf den Kopf fallen. Aber eines wissen sie genau: Geschichten bannen die Schatten und Erzählen heißt Atmen.
»Für Yann Martel ist Erzählen praktizierter Humanismus.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel ›The facts behind the Helsinki Roccamatios‹ bei Alfred A. Knopf Canada.
Die ersten drei Geschichten erschienen zuvor leicht verändert in The Malakat Review, die vierte in STORY.
1994 wurde das Buch unter dem Titel ›Aller Irrsinn des Seins‹ im Verlag Volk & Welt, Berlin, auf Deutsch aufgelegt.
Für die vorliegende Ausgabe wurden alle Texte vom Autor durchgesehen.
© 1993 by Yann Martel
Für diese Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hißmann, Hamburg
Coverabbildung: © Andy Bridge
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403006-7
Im zweiten Universitätsjahr, mit neunzehn, steckte ich mit meinem Studium in der Sackgasse. Der Vorhang zum Erwachsenenleben hatte sich gehoben, ich bestaunte die Aussicht, die ungeahnten Freiheiten, aber ich wusste nicht, was ich mit diesen Freiheiten anfangen sollte. Ich hatte geglaubt, ein akademischer Abschluss – Bachelor, Magister, ein Doktortitel – sei eine Art Geländer, an dem ich mich festhalten könnte, wenn ich die Stufen der Karriereleiter erklomm. Aber nun saß ich da und starrte auf die Buchseiten, Immanuel Kant, und verstand kein Wort, ich fiel bei zwei Prüfungen durch und sah meinem Geländer nach, wie es in den Abgrund stürzte. Der Blick der Leiter ließ mich schwindeln.
Diese jugendliche Existenzkrise war der Anstoß zu meinem ersten literarischen Versuch, einem Einakter, den ich binnen drei Tagen schrieb. Er handelte von einem jungen Mann, der sich in eine Tür verliebt. Als ein Freund hinter sein Geheimnis kommt, zerstört er die Tür. Danach nimmt unser Held sich prompt das Leben. Es war ohne Zweifel ein entsetzliches Stück, ein Werk von himmelschreiender Unreife. Und doch war mir, als hätte ich eine Violine gefunden, als hätte ich den Bogen angesetzt und den ersten Ton hervorgebracht. Das Geräusch, das ich produzierte, mochte grauenhaft sein – aber was für ein wunderschönes Instrument! Es faszinierte mich, dass ich mir eine Szenerie ausdenken konnte, sie mit Charakteren bevölkern, Dialoge für sie schreiben, dass ich sie durch die Handlung führte und mit alldem anderen vermittelte, wie ich die Welt sah. Zum ersten Mal hatte ich eine Aufgabe, die mich so sehr reizte, dass ich all meine Energie hineinsteckte.
Also schrieb ich weiter. Noch ein Stück – einen Pastiche auf das absurde Theater, grässlich –, bevor ich mich auf Prosa verlegte. Ich schrieb Kurzgeschichten – allesamt schlecht –, dann einen Roman – auch nicht besser – und weitere Geschichten – keine davon gelungen. Um das Bild von der Violine weiterzuführen, jetzt kam die Zeit, wo ich meine Nachbarn mit meinem jämmerlichen Spiel zur Verzweiflung brachte. Aber es hatte mich gepackt. Nicht dass ich mir eine große Zukunft ausgemalt hätte; sich diese Kritzeleien als Bücher in den Buchhandlungen vorzustellen war vermessen. Zwar hatte ich nie das Gefühl, dass ich beim Schreiben meine Zeit vergeudete – dazu war es zu aufregend –, aber ich erwartete auch nicht, dass ich mir damit eine Existenz aufbauen könnte. Um ehrlich zu sein, dachte ich über solche Dinge überhaupt nicht nach, ich tat es einfach im Rausch, wie Paganini (nur ohne das Talent).
Aber nach und nach, mit der Übung, wurde ich besser. Von Zeit zu Zeit traf ich auch einmal eine wohlklingende Note. Ich kam dahinter, dass die Grundlage jeder guten Geschichte die Emotion sein muss. Wenn eine Geschichte auf der Gefühlsebene nicht wirkt, dann wirkt sie überhaupt nicht. Um welches Gefühl es sich dabei handelt, ist nebensächlich; es kann Liebe, Neid, sogar Teilnahmslosigkeit sein, solange es nur überzeugend vermittelt wird – dann erwacht die Geschichte zum Leben. Eine Geschichte muss aber auch den Verstand anregen, sonst bleibt sie nicht im Gedächtnis. Ein Intellekt, der in der Emotion gründet, eine Emotion, vom Intellekt vermittelt – mit anderen Worten, eine gute Idee, die zugleich rührt –, das war mein hehres Ziel. Wenn mir eine solche zündende Idee kam, wenn der Funken der Inspiration die Ideen auflodern ließ wie ein Freudenfeuer, dann packte mich eine Begeisterung, wie ich sie noch nie im Leben gespürt hatte.
Ich ließ mich von allem und jedem inspirieren. Bücher. Die Zeitung. Filme. Das tägliche Leben. Leute, die mir begegneten. Erinnerungen und Erfahrungen. Und auch aus jenem geheimnisvollen schöpferischen Äther, aus dem Ideen ganz unvermittelt in meinem Kopf auftauchten. Ich versetzte mich einfach in Empfangsbereitschaft für Geschichten. Ich sperrte Augen und Ohren auf. Ich blickte nach außen, nicht nach innen; das Innen langweilte mich. Ich recherchierte mit Begeisterung. Recherche, das war meine Art zu lernen, meine ganz private Universität. Nichts machte mir mehr Spaß, als die Welt für eine Geschichte zu erforschen.
Ich lebte weiterhin bei meinen Eltern. Genauer gesagt lebte ich von meinen Eltern. Ich zahlte keine Miete, ich aß an ihrem Tisch. Ich nahm Gelegenheitsarbeiten an – Gärtner, Tellerwäscher, Nachtwächter –, aber nie etwas, das mir beim Schreiben im Wege gewesen wäre. Dass ich nichts tat, womit ich nach allgemeinen Maßstäben meinen Lebensunterhalt verdienen konnte, machte mir nichts aus (und, dem Himmel sei Dank, auch meinen Eltern nicht: Jeder Künstler braucht Mäzene), denn ich war immer mit einem Projekt beschäftigt, zum Beispiel der Arbeit an einer langen Erzählung – man könnte sie sogar eine Novelle nennen –, nämlich »Helsinki«. Den Anstoß hatte der Tod eines Freundes gegeben, der an AIDS gestorben war. Der Titel war sperrig, die Logik kurios, die Entwicklung verworren. Aber es steckte Leben in ihr, die Art von Leben, die in einem neugeborenen Kind steckt, in einem jubilierenden Violinsolo – die Art, die alles neu und aufregend und der Mühe wert macht. Wo ein solches Leben in meinen Händen strampelte, wie konnte ich mir da Gedanken um ein Bett oder die Rente machen?
Ich bot meine Geschichten an. Einmal schickte ich sechzehn verschiedene an sechzehn Literaturzeitschriften. Ich erhielt sechzehn Absagen. Ein anderes Mal waren es neunzehn Geschichten und neunzehn Zeitschriften. Zwei wurden genommen. Das ist eine Erfolgsquote von 5,7 Prozent. Nicht sehr ermutigend. Aber ich würde mit dem Schreiben weitermachen, bis sich etwas anderes ergab. Es ergab sich nie etwas anderes, bis heute nicht – und ich bin froh darüber.
Die vier Erzählungen dieses Bandes sind die besten meiner frühen Jahre. Sie haben sich wacker gehalten. Ich bekam einige Preise dafür. »Helsinki« wurde für Bühne und Fernsehen bearbeitet, auch nach »Arten zu sterben« entstanden ein Fernsehspiel und zwei Bühnenversionen. Die Sammlung erschien 1993 in Kanada und danach in sechs weiteren Ländern. Jetzt klopften die Nachbarn nicht mehr an die Wand, sondern riefen stattdessen Bravo. Das machte mich stolz, und dafür war ich dankbar und bin es bis heute.
Ich freue mich, dass diese Erzählungen nun, zehn Jahre später, noch einmal herauskommen. Ich habe sie ein wenig überarbeitet, dem jugendlichen Drang zum Überschwang sind Zügel angelegt, die eine oder andere Ungeschicklichkeit der Formulierung ist, hoffe ich, ausgebügelt. Gewiss habe ich andere Geschichten zu erzählen, aber diese vier sind es, die mich immer an die Begeisterung der frühen Jahre erinnern werden, die Atemlosigkeit der Weltpremiere.
pour J. G.
Allzu lange hatte ich Paul nicht gekannt. Wir lernten uns im Herbst 1986 an der Ellis-Universität in Roetown, im Osten Torontos, kennen. Ich trieb meine Studien nur halbherzig, hatte mir Arbeit gesucht und war nach Indien gereist. Ich war dreiundzwanzig, im letzten Universitätsjahr. Paul war gerade neunzehn geworden und fing eben erst an. Am Anfang eines Studienjahres machen die älteren Jahrgänge von Ellis die Neuankömmlinge mit den Einrichtungen und dem akademischen Leben vertraut. Keine Scherze, keine Gemeinheiten; die Älteren sollen den Jüngeren helfen. Sie heißen »Amigos«, die Neuankömmlinge »Amigatos«, was schon zeigt, wie es mit den Spanischkenntnissen in Roetown bestellt ist. Ich war Amigo, und die meisten meiner Amigatos kamen mir munter, eifrig und jung vor – sehr jung. Aber vom ersten Augenblick an mochte ich Pauls aufmerksame Art, seine entspannte Intelligenz, seinen Hang zur Skepsis. Wir verstanden uns auf Anhieb und hockten immer zusammen. Da ich älter war und schon mehr erlebt hatte, sprach ich oft mit der Autorität eines Gurus, und Paul lauschte wie ein gelehriger Schüler – außer wenn er eine Augenbraue hob oder mir mit einer ironischen Bemerkung zu verstehen gab, wie lächerlich ich wirkte. Dann lachten wir beide, schlüpften aus unseren Rollen und wussten, was wir waren: wirklich gute Freunde.
Dann, zu Anfang des zweiten Trimesters, wurde Paul krank. Schon zu Weihnachten hatte er Fieber gehabt, und seitdem plagte ihn ein trockener Reizhusten. Anfangs machte er sich – machten wir uns – überhaupt keine Gedanken darüber. Die Kälte, die trockene Luft – sicher kam es daher.
Allmählich wurde es schlimmer. Heute fallen mir Symptome ein, bei denen ich mir damals nichts gedacht habe. Mahlzeiten, die er stehen ließ. Klagen über Durchfall. Eine Kraftlosigkeit, die sich nicht allein mit phlegmatischem Temperament erklären ließ. Eines Tages gingen wir die Treppe zur Bibliothek hinauf, höchstens fünfundzwanzig Stufen, und oben blieben wir stehen. Mir ging auf, dass wir nur deswegen stehen geblieben waren, weil Paul außer Atem war und sich ausruhen wollte. Ich hatte auch den Eindruck, dass er abnahm. Es war schwer zu sagen, bei den dicken Winterpullovern, aber ich war mir sicher, dass er Anfang des Jahres fülliger gewirkt hatte. Als offensichtlich war, dass etwas nicht stimmte, redeten wir darüber – natürlich ganz beiläufig –, und ich spielte den Arzt und sagte: »Was haben wir … Atemnot, Husten, Gewichtsverlust, Erschöpfung. Paul, du hast eine Lungenentzündung.« Das war nur so dahingesagt, aber es stellte sich heraus, dass meine Diagnose ins Schwarze traf. PCP nennen es die Eingeweihten, Pneumocystis carinii-Pneumonie. Mitte Februar ging Paul nach Toronto und konsultierte seinen Hausarzt.
Neun Monate später war er tot.
AIDS. Er sagte es mir am Telefon, mit tonloser Stimme. Ich hatte fast zwei Wochen nichts von ihm gehört. Er sei gerade aus dem Krankenhaus zurück, erzählte er. Mein erster Gedanke galt mir selbst. Hatte ich mich jemals in seiner Gegenwart verletzt? Wenn ja, unter welchen Umständen? Hatte ich je aus seinem Glas getrunken? Von einem Teller mit ihm gegessen? Ich überlegte, ob es je einen Punkt gegeben hatte, an dem sein und mein Blut miteinander in Berührung gekommen waren. Dann dachte ich an ihn. Ich dachte an schwulen Sex und harte Drogen. Aber Paul war nicht schwul. Wir hatten zwar nie direkt darüber gesprochen, aber ich kannte ihn gut genug und hatte nicht die kleinste Zweideutigkeit entdeckt. Und auch als Heroinsüchtigen konnte ich ihn mir nicht vorstellen. Aber das war auch nicht die Erklärung. Drei Jahre zuvor, mit sechzehn, war er mit seinen Eltern zum Weihnachtsurlaub auf Jamaika gewesen. Sie hatten einen Autounfall gehabt, Paul hatte sich das rechte Bein gebrochen und recht viel Blut verloren. Im Hospital vor Ort hatte er eine Bluttransfusion bekommen. Sechs Unfallzeugen hatten angeboten zu spenden. Drei hatten die richtige Blutgruppe. Einige Telefonate und ein paar Nachforschungen ergaben, dass einer von den dreien vor zwei Jahren unerwartet gestorben war. Er war wegen Lungenentzündung in Behandlung gewesen. Die Autopsie ergab, dass er an schwerer zerebraler Toxoplasmose gelitten hatte. Eine verdächtige Kombination.
Am Wochenende besuchte ich Paul in seinem Elternhaus im reichen Rosedale. Ich fuhr nicht gern; am liebsten hätte ich die ganze Sache verdrängt. Ich fragte – das war mein Vorwand –, ob es seinen Eltern denn nicht zu viel würde, wenn auch noch ein Besucher käme. Er bestand darauf. Also fuhr ich hin. Ich riss mich zusammen. Ich fuhr nach Toronto. Und die Stimmung der Eltern hatte ich ganz richtig eingeschätzt. Denn was mich an jenem ersten Wochenende am meisten schmerzte, das war nicht Paul, das waren seine Eltern.
Als er erfuhr, auf welchem Wege Paul sich aller Wahrscheinlichkeit nach infiziert hatte, hatte sein Vater Jack den ganzen Rest des Tages kein Wort gesprochen. Früh am nächsten Morgen holte er den Werkzeugkasten aus dem Keller, zog seinen Winterparka über die Hausjacke, ging hinaus in die Einfahrt und demolierte seinen Wagen. Weil er bei dem Unfall auf Jamaika am Steuer gesessen hatte – obwohl er keine Schuld gehabt hatte und es ein Leihwagen gewesen war, nicht dieses Auto. Mit dem Hammer schlug er sämtliche Lampen und Fenster ein. Er zerkratzte und zerbeulte die gesamte Karosserie. Er schlug Nägel in die Reifen. Er ließ das Benzin aus dem Tank ab, goss es über den Wagen und über die Polster und zündete sie an. Die Nachbarn riefen die Feuerwehr. Im Handumdrehen war sie da und löschte den Brand. Die Polizei kam. Als er schluchzend erklärte, warum er es getan habe, waren alle sehr verständnisvoll, und die Polizisten nahmen nicht einmal ein Protokoll auf. Sie fragten nur, ob sie ihn ins Krankenhaus bringen sollten, aber er lehnte ab. Das war das Erste, was ich sah, als ich zu dem großen Eckhaus kam: das ausgebrannte Wrack eines Mercedes, überzogen mit verkrustetem Schaum.
Jack war ein erfolgreicher Geschäftsanwalt. Als Paul mich mit ihm bekannt machte, grinste er, schüttelte mir kräftig die Hand und sagte: »Schön Sie zu sehen!« Aber dann wusste er anscheinend nicht mehr, was sonst noch zu sagen war. Er wurde rot. Pauls Mutter Mary war im Schlafzimmer. Ich hatte sie schon Anfang des Jahres kennen gelernt. Als junge Frau hatte sie an der McGill-Universität einen Magistertitel in Anthropologie erworben, sie hatte es als Amateur-Tennisspielerin zu Erfolg gebracht, und sie war viel gereist. Jetzt arbeitete sie halbtags für eine Menschenrechtsorganisation. Paul war stolz auf seine Mutter und verstand sich sehr gut mit ihr. Sie war eine kluge, energische Frau. Doch nun lag sie auf dem Bett, ein zusammengekrümmter Fötus, schlaff wie ein Ballon, der seine Luft verloren hat. Alles Leben, alle Kraft war aus ihr gewichen. Paul blieb neben dem Bett stehen und sagte nur: »Meine Mutter.« Sie regte sich kaum. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Pauls Schwester Jennifer, Soziologiestudentin an der Universität von Toronto, sah man die Verstörung am meisten an. Ihre Augen waren rot, das Gesicht verquollen – sie sah schrecklich aus. Und ich will keine Witze machen, aber selbst George H., der Labrador, war krank vor Kummer. Er hatte sich unter das Sofa verkrochen, war durch nichts hervorzulocken und winselte nur leise vor sich hin.
Das Urteil war am Mittwochmorgen gekommen, und seither (inzwischen war Freitag) hatte keiner von ihnen, auch George H. nicht, einen Bissen zu sich genommen. Pauls Eltern waren nicht zur Arbeit gegangen, Jennifer nicht zur Uni. Wenn sie überhaupt schliefen, dann schliefen sie, wo sie gerade waren. Einmal fand ich am Morgen Pauls Vater schlafend auf dem Wohnzimmerboden, voll bekleidet und in den Perserteppich gewickelt, eine Hand zu dem Hund unter dem Sofa ausgestreckt. Wenn nicht gerade hektische Telefonate geführt wurden, war das ganze Haus still.
Und im Mittelpunkt von alldem stand teilnahmslos Paul. Es kam mir vor wie ein Begräbnis, wo alle Angehörigen tief von Schmerz und Gram gezeichnet sind, und er war der Beerdigungsunternehmer, der mit der Ruhe des Profis und einem vagen Gefühl der Anteilnahme dabeisitzt. Erst am dritten Tag meines Besuches begann er allmählich zu reagieren. Aber noch konnte der Tod sich nicht verständlich machen. Paul wusste, dass etwas Entsetzliches mit ihm geschah, aber er konnte es nicht begreifen. Er konnte den Tod nicht fassen. Er war zu theoretisch, zu abstrakt. Er sprach von seiner Krankheit, als seien es Nachrichten aus einem fernen Land. Er sagte »Ich werde sterben« im gleichen Tonfall, in dem er auch hätte sagen können: »Es gab ein Fährunglück in Bangladesch.«
Ich hatte eigentlich nur übers Wochenende bleiben wollen – der Unibetrieb ging weiter –, aber am Ende blieb ich zehn Tage. Ich habe eine Menge Haushaltsarbeit erledigt, ich habe gekocht. Die Familie bemerkte es kaum, aber das kränkte mich nicht. Paul half, und dass er etwas zu tun hatte, tat ihm gut. Wir ließen den Wagen abholen, wir ersetzten ein Telefon, das Pauls Vater zerschlagen hatte, wir putzten das ganze Haus, bis es blitzte vom Dachboden bis zum Keller, wir badeten George H. (der so hieß, weil Paul ein großer Beatles-Fan war; in jüngeren Jahren hatte er bei seinen Spaziergängen mit George H. gern vor sich hingesagt: »Unerkannt, völlig inkognito, streifen Beatle Paul und Beatle George in diesem Augenblick durch die Straßen von Toronto« und hatte sich ausgemalt, wie es wohl wäre, im Shea-Stadion zu stehen und »Help!« zu singen und dergleichen mehr), und wir kauften ein und drängten die Familie, etwas zu essen. Ich spreche von »wir«, ich sage »Paul half« – aber eigentlich tat ich alles allein, und er saß auf einem Stuhl dabei. Medikamente, Dapson und Trimethoprim, halfen Paul gegen die Lungenentzündung, aber er war noch immer sehr schwach und kurzatmig. Er schlurfte durchs Haus wie ein alter Mann, sich jeder Bewegung und der Anstrengung bewusst.
Die Familie brauchte eine Weile, bis sie aus diesem Schockzustand herauskam. Während Pauls Krankheit konnte ich drei Stadien ausmachen, die sie durchliefen. Die erste Phase verbrachten sie gemeinsam im Haus, wo der Schmerz mit Händen zu greifen war. Jeder ging seiner eigenen Wege: Pauls Vater zerschlug etwas möglichst Großes und Stabiles, einen Tisch etwa oder ein Küchengerät, Pauls Mutter lag teilnahmslos auf dem Bett, Jennifer weinte in ihrem Zimmer und George H. verkroch sich unter dem Sofa und winselte. In der zweiten, oft im Krankenhaus, versammelten sich alle um Paul, und sie redeten und weinten und machten einander Mut und lachten und tuschelten. In der dritten Phase schließlich leerten sie das an den Tag, was man wohl normales Verhalten nennen könnte, eine Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen, als gebe es den Tod gar nicht; sie zeigten eine gefasste, ein wenig dumpfe Zuversicht, eine Miene, die, weil sie sie jeden Tag von neuem aufsetzen mussten, bald heroisch und alltäglich zugleich war. Die Familie durchlief diese Stadien im Laufe der Monate, manchmal aber auch binnen einer einzigen Stunde.
Ich will hier nicht davon reden, was AIDS mit dem menschlichen Körper macht. Malen Sie sich das Schlimmste aus – und es ist noch schlimmer (der Verfall ist unvorstellbar). Schlagen Sie im Wörterbuch das Wort »Fleisch« nach – so ein kraftstrotzendes Wort – und dann »zergehen«.
Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist die Gegenwehr, der Daran-sterbe-ich-nicht-Virus. Das ist der Virus mit der größten Zahl an Opfern, denn er infiziert die Lebenden, diejenigen, die den Sterbenden lieben und umhegen. Mich erwischte er gleich zu Anfang. Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Paul war im Krankenhaus. Er aß sein Abendessen, jeden Bissen, bis der Teller vollkommen blank war, obwohl er gar keinen Hunger hatte. Ich sah ihm zu, wie er jede einzelne Erbse verfolgte, bis er sie auf der Gabel hatte, und jeden Mund voll gewissenhaft kaute, bevor er schluckte. Das gibt meinem Körper Kraft zum Kämpfen. Auch das kleinste bisschen zählt – das ging ihm durch den Kopf. Es stand ihm im Gesicht geschrieben, ich sah es an seiner Haltung, ich sah es als Zeichen an der Wand. »Lass doch die verfluchten Erbsen, Paul«, hätte ich ihn am liebsten angebrüllt, »du wirst sterben! STERBEN!« Nur dass »Tod« und »Sterben« und alle Varianten dieser beiden Worte nun stillschweigend aus unserer Rede verbannt waren. Ich saß also nur einfach mit ausdruckslosem Gesicht da, und der Arger wütete in meinem Inneren. Noch schlimmer ging es mir jedes Mal wenn Paul sich rasierte. Es waren ja nur ein paar Daunen am Kinn; er war kein haariger Typ. Trotzdem rasierte er sich nun täglich. Tag für Tag schlug er Massen von Rasierschaum auf und strich sein Gesicht dick damit ein, und dann schabte er es mit einem Einwegrasierer wieder ab. Es ist ein Bild, das sich mir ins Gedächtnis eingebrannt hat: Paul, noch halbwegs bei Kräften, in einem Krankenhaushemd vor dem Spiegel, wie er den Kopf bald in die eine, bald in die andere Richtung dreht, die Haut hierhin und dorthin spannt, penibel etwas macht, das vollkommen, ganz und gar, sinnlos ist.
Das Studienjahr war verloren. Ständig verpasste ich Vorlesungen und Seminare und brachte keine Essays mehr zustande. Ja, ich konnte nicht einmal mehr lesen; ich starrte stundenlang auf denselben Absatz Kant oder Heidegger, versuchte zu verstehen, was sie mir sagen wollten, versuchte meine Gedanken darauf zu konzentrieren, doch ohne Erfolg. Zu jener Zeit entwickelte ich auch einen Abscheu gegenüber meinem Heimatland. Kanada, das war Rückständigkeit, Trägheit, Kleinlichkeit. Kanadier steckten bis zum Hals im Materialismus, und vom Hals aufwärts gab es nur amerikanisches Fernsehen. Nirgends sah ich Idealismus, nirgends Aufrichtigkeit. Alles war nur lähmendes Mittelmaß. Die kanadische Haltung zu Zentralamerika, zu Indianern und Eskimos, zur Umwelt, zu Reagans Amerika, zu allem, das drehte mir den Magen um. Es gab nichts, was ich an diesem Land mochte, nicht das Geringste. Ich konnte es gar nicht abwarten, bis ich dem allen entfloh.
Eines Tages hielt ich in einem Philosophieseminar – mein Hauptfach – ein Referat über Hegels Geschichtsphilosophie. Der Professor, ein kluger und freundlicher Mensch, unterbrach mich und bat mich, einen Punkt näher zu erläutern, der ihm nicht klar geworden war. Ich schwieg. Ich sah mich in dem gemütlichen, mit Büchern voll gestopften Raum um. Ich kann mich an diesen Augenblick der Stille sehr genau erinnern, denn das war der Augenblick, in dem ich die Wut und den Überdruss, die sich mit immer größerer Macht in all meiner Verwirrung breit gemacht hatten, nicht mehr aushielt. Ich brüllte, ich sprang auf, ich schmiss den dicken Hegelband durch das geschlossene Fenster und stürmte aus dem Büro, warf die Tür hinter mir zu, so fest ich nur konnte, und trat, damit es sich auch lohnte, auch noch eine ihrer hübschen Füllungen ein.
Ich wollte mich beurlauben lassen, aber ich verpasste den Termin. Ich wandte mich an ein Komitee, das in Problemfällen die Studenten vertritt, und musste zu einer Anhörung erscheinen. Der Grund, weshalb ich von der Uni abgehen wollte, war Paul, aber als der Vorsitzende nachhakte und mit einem hämischen Grinsen fragte, was genau ich denn mit »emotionaler Belastung« meine, sah ich ihn nur an und wusste, dass ich ihm Pauls Todeskampf nicht auf einem Tablett präsentieren würde wie eine geschälte und geviertelte Apfelsine. Diesmal gab es jedoch keinen großen Auftritt. Ich sagte einfach nur: »Ich habe es mir anders überlegt. Ich ziehe meinen Antrag zurück. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.« Und damit ging ich hinaus.
So kam es, dass ich mein Studium nie abschloss. Es machte mir damals nichts aus und heute ebenso wenig. Ich blieb in Roetown, ein hübscher Ort, wenn man nichts anderes zu tun hat.
Aber eigentlich will ich ja von der Geschichte der Familie Roccamatio aus Helsinki erzählen. Nicht von Pauls Familie, denn er hieß mit Nachnamen Atsee. Und auch nicht von meiner.
es