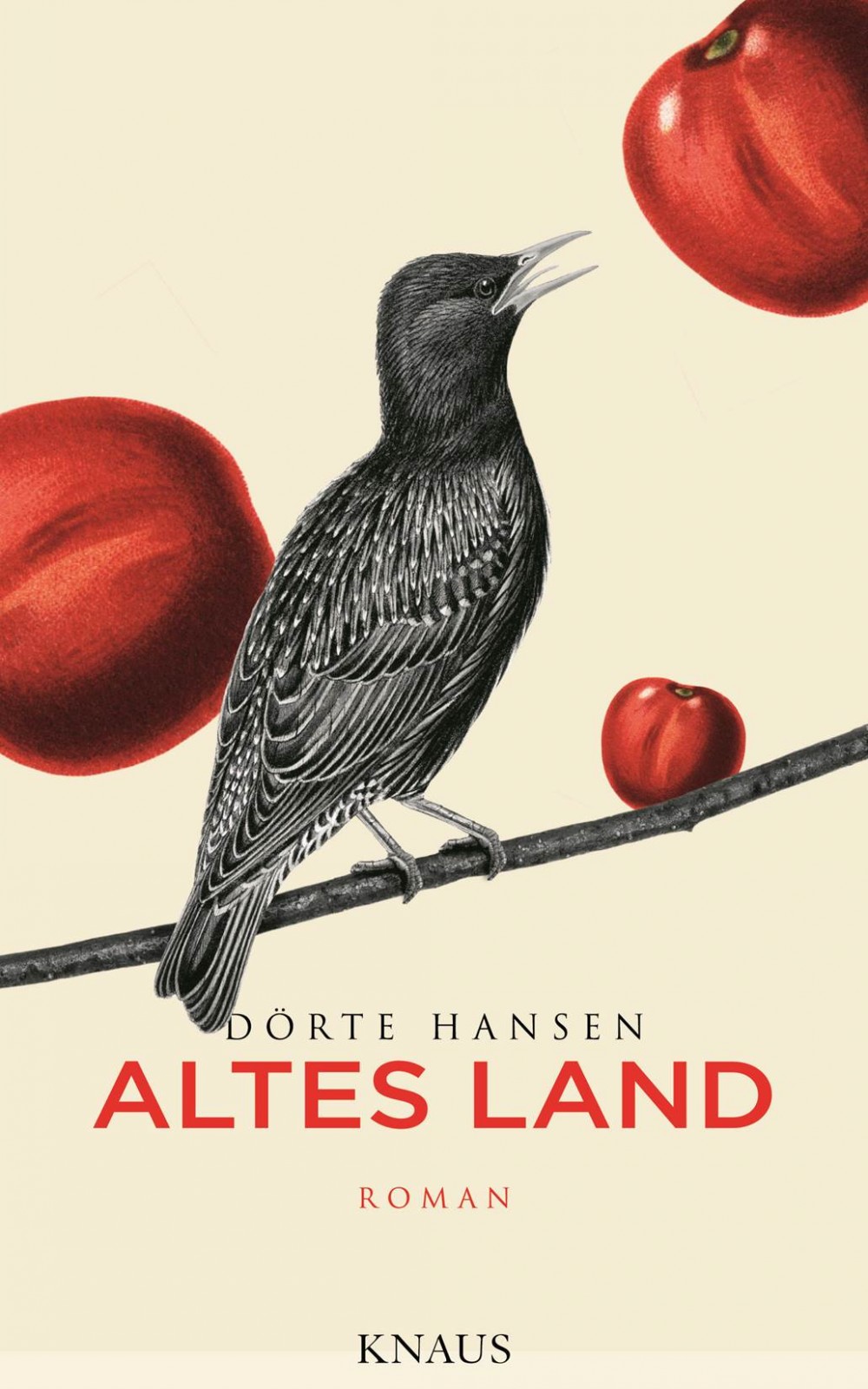
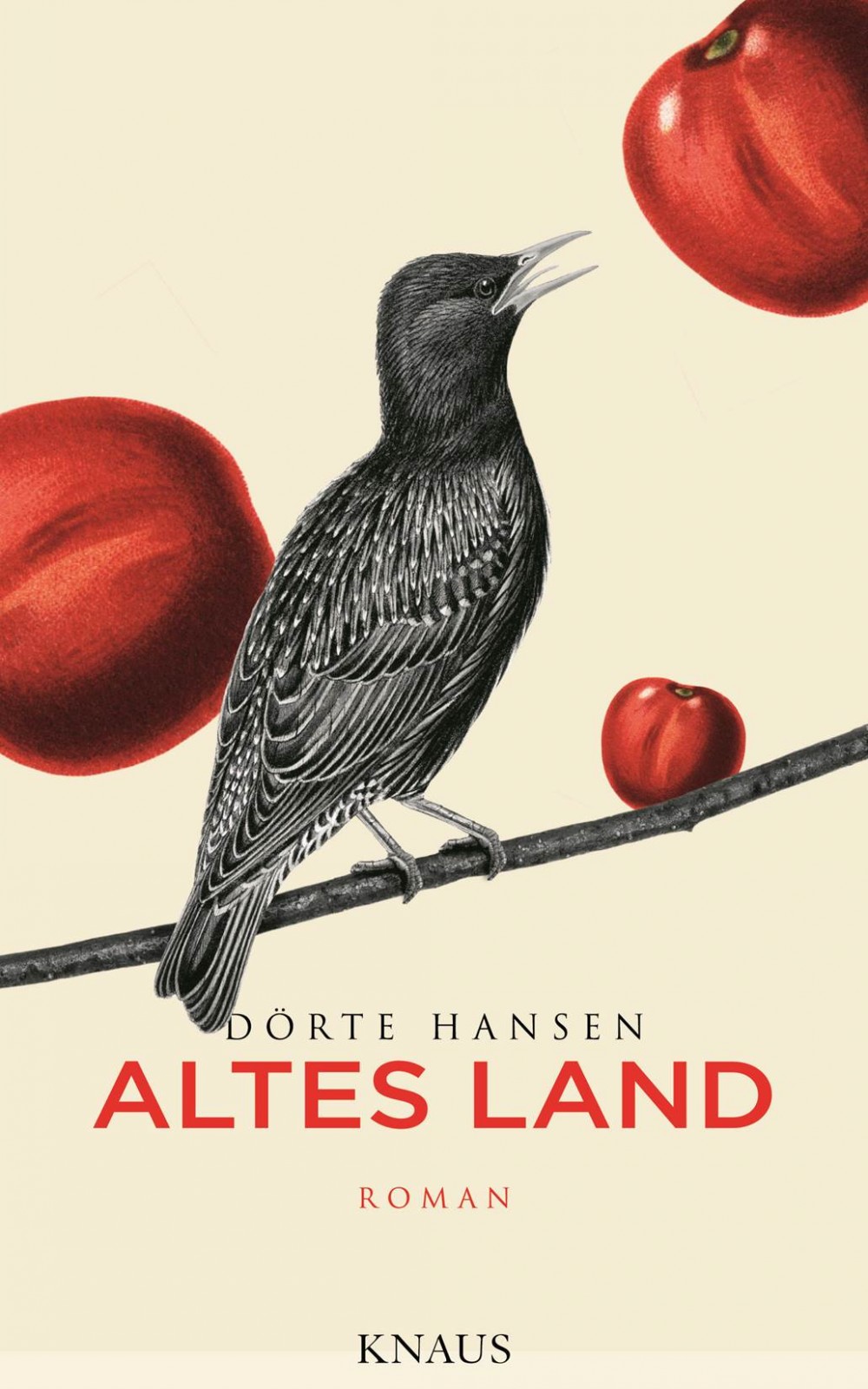
Dörte Hansen
Altes Land
Roman
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
14. Auflage
Copyright © 2015 beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15239-0
V003
www.knaus-verlag.de
För mien Appelhuuslüüd
1 – Kirschbäume
In manchen Nächten, wenn der Sturm von Westen kam, stöhnte das Haus wie ein Schiff, das in schwerer See hin- und hergeworfen wurde. Kreischend verbissen sich die Böen in den alten Mauern.
So klingen Hexen, wenn sie brennen, dachte Vera, oder Kinder, wenn sie sich die Finger klemmen.
Das Haus stöhnte, aber es würde nicht sinken. Das struppige Dach saß immer noch fest auf seinen Balken. Grüne Moosnester wucherten im Reet, nur am First war es durchgesackt.
Vom Fachwerk der Fassade war die Farbe abgeblättert, und die rohen Eichenständer steckten wie graue Knochen in den Mauern. Die Inschrift am Giebel war verwittert, aber Vera wusste, was da stand: Dit Huus is mien un doch nich mien, de no mi kummt, nennt’t ook noch sien.
Es war der erste plattdeutsche Satz, den sie gelernt hatte, als sie an der Hand ihrer Mutter auf diesen Altländer Hof gekommen war.
Der zweite plattdeutsche Satz kam von Ida Eckhoff persönlich und war eine gute Einstimmung gewesen auf die gemeinsamen Jahre, die noch kommen sollten: »Woveel koomt denn noch vun jau Polacken?« Ihr ganzes Haus war voll von Flüchtlingen, es reichte.
Hildegard von Kamcke hatte keinerlei Talent für die Opferrolle. Den verlausten Kopf erhoben, dreihundert Jahre ostpreußischen Familienstammbaum im Rücken, war sie in die eiskalte Gesindekammer neben der Diele gezogen, die Ida Eckhoff ihnen als Unterkunft zugewiesen hatte.
Sie hatte das Kind auf die Strohmatratze gesetzt, ihren Rucksack abgestellt und Ida mit ruhiger Stimme und der korrekten Artikulation einer Sängerin den Krieg erklärt: »Meine Tochter bräuchte dann bitte etwas zu essen.« Und Ida Eckhoff, Altländer Bäuerin in sechster Generation, Witwe und Mutter eines verwundeten Frontsoldaten, hatte sofort zurückgefeuert: »Von mi gift dat nix!«
Vera war gerade fünf geworden, sie saß frierend auf dem schmalen Bett, die feuchten Wollstrümpfe kratzten, der Ärmel ihres Mantels war getränkt vom Rotz, der ihr unaufhörlich aus der Nase lief. Sie sah, wie ihre Mutter sich sehr dicht vor Ida Eckhoff aufbaute und mit feinem Vibrato und spöttischem Lächeln zu singen begann: Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen…
Ida war so perplex, dass sie sich bis zum Refrain nicht vom Fleck rührte. Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck, sang Hildegard von Kamcke, holte in ihrer Flüchtlingskammer zur großen Operettengeste aus und sang noch, als Ida längst kalt vor Wut an ihrem Küchentisch saß.
Als es dunkel wurde und im Haus alles ruhig war, schlich Hildegard durch die Diele nach draußen. Sie kam zurück mit einem Apfel in jeder Manteltasche und einem Becher kuhwarmer Milch. Als Vera ausgetrunken hatte, wischte Hildegard den Becher mit ihrem Mantelsaum aus und stellte ihn leise zurück in die Diele, bevor sie sich zu ihrer Tochter auf die Strohmatratze legte.
Zwei Jahre später kam Karl Eckhoff heim aus russischer Gefangenschaft, das rechte Bein steif wie ein Knüppel, die Wangen so hohl, als hätte er sie nach innen gesogen, und Hildegard von Kamcke musste ihre Milch noch immer stehlen.
Von mi gift dat nix. Ida Eckhoff war ein Mensch, der Wort hielt, aber sie wusste, dass die Person jede Nacht in ihren Kuhstall ging. Irgendwann stellte sie neben den alten Becher in der Diele eine Kanne. Es musste beim nächtlichen Melken nicht auch noch die Hälfte danebengehen. Sie zog den Schlüssel für das Obstlager abends nicht mehr ab, und manchmal gab sie dem Kind ein Ei, wenn es mit dem viel zu großen Besen die Diele gefegt oder ihr beim Bohnenschneiden Land der dunklen Wälder vorgesungen hatte.
Als im Juli die Kirschen reif wurden und in den Höfen jedes Kind gebraucht wurde, um die Stare zu vertreiben, die sich in riesigen Schwärmen auf die Kirschbäume stürzten, stampfte Vera wie ein aufziehbarer Trommelaffe durch die Baumreihen, drosch mit einem Holzlöffel auf einen alten Kochtopf ein und grölte in endloser Wiederholung alle Lieder, die ihre Mutter ihr beigebracht hatte, nur das mit dem Schweinespeck ließ sie aus.
Ida Eckhoff konnte sehen, wie das Kind Stunde um Stunde durch den Kirschhof marschierte, bis ihm das dunkle Haar in feuchten Kringeln am Kopf klebte. Um die Mittagszeit war das Kindergesicht dunkelrot angelaufen. Vera wurde langsamer, begann zu straucheln, hörte aber nicht mit dem Trommeln auf und mit dem Singen, marschierte taumelnd weiter wie ein erschöpfter Soldat, bis sie kopfüber in das gemähte Gras zwischen den Kirschbäumen kippte.
Die plötzliche Stille ließ Ida aufhorchen, sie lief zur großen Tür und sah das ohnmächtige Mädchen im Kirschhof liegen. Ärgerlich schüttelte sie den Kopf und lief zu den Bäumen, hob das Kind wie einen Kartoffelsack auf die Schulter und schleppte es zu der weißen Holzbank, die im Schatten einer großen Linde neben dem Haus stand.
Diese Bank war für Gesinde und Flüchtlinge tabu, sie war Ida Eckhoffs Hochzeitsbank gewesen, und jetzt war sie ihre Witwenbank. Außer ihr und Karl hatte hier niemand zu sitzen, aber nun lag das Polackenkind mit Sonnenstich auf der Bank und musste wieder zu sich kommen.
Karl kam aus dem Schuppen angehumpelt, aber Ida war schon an der Pumpe, ließ kaltes Wasser in den Eimer laufen. Sie nahm das Küchentuch, das sie immer über der Schulter trug, tauchte es ein, legte es wie einen Kopfverband zusammen und drückte es dem Kind auf die Stirn. Karl hob die nackten Füße an und legte ihre Beine über die weiße Lehne der Bank.
Aus dem Kirschhof drang das entfernte Klappern der Holzrasseln und Kochtopfdeckel. Hier, dicht am Haus, wo es jetzt viel zu still geworden war, wagten sich die ersten Stare schon wieder in die Bäume. Man konnte sie in den Zweigen rascheln hören und schmatzen.
Früher hatte Karl sie von den Bäumen geschossen, mit seinem Vater; sie waren mit ihren Schrotflinten durch die Spaliere der Kirschbäume gezogen, hatten wie im Rausch hineingeballert in die schwarzen Schwärme. Hinterher war es ernüchternd, die kaputten kleinen Vögel einzusammeln. Die große Wut und dann das kümmerliche Büschel Federn.
Vera kam wieder zu sich, würgte, drehte den Kopf zur Seite und erbrach sich auf der weißen Hochzeitsbank unter Ida Eckhoffs herrschaftlicher Linde. Sie fuhr heftig zusammen, als ihr das bewusst wurde, wollte aufspringen, aber die Linde drehte sich über ihrem Kopf, die hohe Baumkrone mit den herzförmigen Blättern schien zu tanzen, und Idas breite Hand drückte sie auf die Bank zurück.
Karl kam aus dem Haus mit einem Becher Milch und einem Butterbrot, er setzte sich neben Vera auf die Bank, und Ida schnappte sich den Holzlöffel und den verbeulten Topf, um die dreisten Vögel zu verscheuchen, die sich auf ihrem Hof breitmachten und fraßen, was ihnen nicht zustand.
Karl wischte dem Kind mit dem feuchten Küchentuch das Gesicht sauber. Als Vera sah, dass Ida weg war, trank sie schnell die kalte Milch und schnappte sich das Brot. Sie stand auf und machte einen wackeligen Knicks, dann trippelte sie barfuß über das heiße Kopfsteinpflaster, die Arme seitlich ausgestreckt, als tanzte sie auf einem Seil.
Karl sah sie zurück zu den Kirschbäumen gehen.
Er steckte sich eine Zigarette an, wischte die Bank sauber und warf das Tuch ins Gras. Dann legte er den Kopf in den Nacken, nahm einen tiefen Zug und machte schöne runde Rauchringe, die hoch in die Krone der Linde schwebten.
Seine Mutter wütete immer noch mit dem alten Kochtopf durch die Baumreihen.
Du liegst auch gleich mit Sonnenstich im Gras, dachte Karl, trommel du ruhig.
Ida lief dann selbst ins Haus, holte die Flinte und schoss in die Vogelschwärme, ballerte in den Himmel, bis sie den letzten Fresser aus den Kirschen geholt oder wenigstens für eine Weile verscheucht hatte. Und ihr Sohn, der zwei gesunde Arme hatte und ein heiles Bein, saß auf der Bank und sah ihr zu.
Alles dran, Gott sei Dank!, hatte Ida Eckhoff gedacht, als er ihr vor acht Wochen auf dem Bahnsteig entgegengehumpelt kam. Dünn war er ja immer gewesen, müde sah er aus, das Bein zog er nach, aber es hätte doch viel schlimmer kommen können. Friedrich Mohr hatte seinen Sohn ohne Arme zurückbekommen, der konnte nun sehen, was aus seinem Hof wurde. Und Buhrfeindts Paul und Heinrich waren beide gefallen. Ida konnte froh sein, dass sie ihren einzigen Sohn in so gutem Zustand nach Hause gekriegt hatte.
Und das andere, die Schreierei in der Nacht und das nasse Bett manchmal am Morgen, das war nichts Ernstes. Die Nerven, sagte Dr. Hauschildt, das würde sich bald geben.
Als im September die Äpfel reif wurden, saß Karl immer noch auf Idas weißer Bank und rauchte. Schöne runde Ringe blies er in die goldene Krone der Linde, und an der Spitze der Pflückerkolonne, die sich Korb für Korb durch die Apfelbaumreihen arbeitete, stand Hildegard von Kamcke. Aus Preußen sei sie ja ganz andere Flächen gewöhnt, hatte sie gesagt, und Ida hatte wieder einmal große Lust gehabt, das hochmütige Weib stante pede vom Hof zu jagen. Aber sie konnte nicht auf sie verzichten. Sie biss sich die Zähne aus an dieser schmalen Frau, die sich frühmorgens auf das Fahrrad schwang wie auf ein Reitpferd und in tadelloser Haltung zum Melken fuhr. Die im Obsthof schuftete, bis der letzte Apfel vom Baum war, die im Stall die Forke schwang wie ein Kerl und dabei Mozart-Arien sang, was die Kühe nicht beeindruckte.
Aber Karl auf seiner Bank gefiel es sehr.
Und Ida, die nicht geweint hatte, seit ihr Friedrich vor acht Jahren leblos wie ein Kreuz im Entwässerungsgraben trieb, stand am Küchenfenster und heulte, weil sie sah, wie Karl unter der Linde saß und lauschte.
Fühlst du nicht der Liebe Sehnen …, sang Hildegard von Kamcke und dachte dabei wohl an einen anderen, der tot war. Und sie wusste so gut wie Ida, dass da draußen auf der Bank nicht mehr der Karl saß, auf den die Mutter jahrelang gewartet hatte.
Ihr Hoferbe Karl Eckhoff, stark und hoffnungsvoll, war im Krieg geblieben. Einen Pappkameraden hatten sie ihr zurückgebracht. Freundlich und fremd wie ein Reisender saß ihr Sohn auf der Hochzeitsbank und schickte Rauchringe in den Himmel. Und in den Nächten schrie er.
Als der Winter kam, baute Karl leise pfeifend einen Puppenwagen für die kleine Vera von Kamcke, und Weihnachten saß die hergelaufene Gräfin mit ihrem ewig hungrigen Kind zum ersten Mal an Ida Eckhoffs großem Esstisch in der Stube.
Im Frühling, als es Kirschblüten schneite, spielte Karl Akkordeon auf seiner Bank, und Vera setzte sich dazu.
Und im Oktober, nach der Apfelernte, zog Ida Eckhoff auf ihr Altenteil und hatte eine Schwiegertochter, die sie achten konnte und hassen musste.
Dit Huus is mien un doch nich mien …
Die alte Inschrift galt für beide. Sie waren ebenbürtig, sie lieferten sich schwere Schlachten in diesem Haus, das Ida nicht hergeben und Hildegard nicht mehr verlassen wollte.
Die jahrelange Schreierei, die Flüche, das Türenknallen, das Krachen der Kristallvasen und Goldrandtassen zogen in die Ritzen der Wände, setzten sich wie Staub auf Dielenbrettern und Deckenbalken ab. In stillen Nächten konnte Vera sie noch hören, und wenn es stürmisch wurde, fragte sie sich, ob es wirklich der Wind war, der da so wütend heulte.
Kein Staat mehr zu machen mit deinem Haus, Ida Eckhoff, dachte sie.
Vor dem Fenster stand die Linde und schüttelte den Sturm aus ihren Zweigen.
2 – Zauberflöte
Am schlimmsten waren die Schnuppertage, einmal im Halbjahr, wenn die Drei- bis Fünfjährigen mit ihren Eltern in den großen Übungsraum strömten und Bernd sein helles Jeanshemd trug. Und dazu passend das Haargummi in Himmelblau.
Bernd war nicht der Typ, der Dinge gern dem Zufall überließ, er sah nur gern so aus. Die runde Brille, der Vollbart, das graumelierte Haar im Zopf – vertrauensbildende Maßnahmen. Musikalische Früherziehung war ein Geschäft, das sehr viel Feingefühl verlangte.
Wenn die Eltern von Hamburg-Ottensen mit ihren Kindern zum Schnuppertag kamen, wollten sie keinen Musikpauker mit Fliege sehen. Bernd gab ihnen den kreativen Endvierziger, zugewandt, dynamisch, locker – aber professionell. Das war hier keine Volkshochschule.
Musimaus stand für ein anspruchsvolles Frühförderungskonzept, und wenn Bernd seine kurze Begrüßungsansprache hielt, baute er sorgfältig die einschlägigen Schlüsselwörter ein. Spielerisch war immer das erste.
Anne saß im großen Kreis auf dem Holzfußboden des Übungsraums, Mundwinkel und Augenbrauen oben, die Querflöte im Schoß, es war ihr achter Schnuppertag, und sie schloss ganz kurz die Augen, als Bernd das Wort behutsam sagte. Jetzt fehlten noch Talent und Potential und kognitive Fähigkeiten.
Das Mädchen auf dem Schoß seiner Mutter neben Anne war höchstens drei, es nagte an einer Reiswaffel und trommelte gelangweilt mit den Füßen, starrte Anne eine Weile an, dann lehnte es sich zu ihr herüber und griff mit den klebrigen Händen nach der Flöte. Die Mutter sah ihm lächelnd zu. »Möchtest du da mal reinpusten, Schatz?«
Anne sah den nassen Kindermund, an dem die Waffelreste klebten, sie hielt ihr Instrument mit beiden Händen fest und atmete tief durch, sie spürte, wie eine Wand von Wut sich langsam aufbaute in ihr, verspürte große Lust, dem Kind ihre Sopranflöte C, Vollsilber, über den Schädel zu ziehen – oder, viel lieber noch, die Mutter zu schlagen, die geringelte Strumpfhosen trug und ein geblümtes Tuch im Haar. Die jetzt verständnislos die Stirn runzelte, weil ihre vollgesabberte Dreijährige nicht in ein 6000 Euro teures Profi-Instrument pusten durfte.
Komm wieder runter, dachte Anne, das Kind kann nichts dafür.
Sie hörte, dass Bernd zum Ende seiner kleinen Ansprache kam: »… einfach die FREUDE an der Musik!« Sein Schlusswort, ihr Stichwort. Sie stand auf, drehte ihr Bühnenlächeln heller und ging durch den Kreis zu ihm herüber. Anne mit der Zauberflöte, Bernd mit der Gitarre, das machten sie jedes Mal so, dreimal das Papageno-Motiv auf der Querflöte, dann ein kurzes Intro auf der Gitarre, »und jetzt dürfen alle Kinder sich aus der Mitte eine Triangel oder ein Klangholz holen, und die Eltern singen mit, Sie kennen das Lied ganz bestimmt, und jetzt alle … drei, vier: Das klinget so herrlich, das klinget so schön …«
Während die Kinder auf die Instrumente einschlugen und die Eltern mehr oder weniger schön vor sich hinsangen, ging Anne mit ihrer Flöte tänzelnd durch den Übungsraum, und Bernd schlenderte singend und lächelnd mit der Gitarre hinterher.
Er schaffte es, dabei die ganze Zeit begeistert seinen Kopf hin und her zu wiegen. Bernd war ein Profi.
Er hatte die Schnuppertage perfekt durchchoreographiert, und das zahlte sich aus. Die Musimaus-Kurse waren bei den Eltern von Hamburg-Ottensen fast noch begehrter als ein Schrebergarten mit Stromanschluss, es gab sehr lange Wartelisten.
Anne konnte froh sein, dass sie den Job bekommen hatte. Bernd stellte sonst nur ausgebildete Musiklehrer ein oder Absolventen der Musikhochschule. Als abgebrochene Musikstudentin hätte sie eigentlich keine Chance gehabt, aber erstens hatte Bernd schnell festgestellt, dass Anne seine diplomierten Musiklehrer locker an die Wand spielte, und zweitens hatte sie in sein Gesamtkonzept gepasst.
Was bedeutete, dass sie eine ziemlich gute Figur machte, wenn sie mit ihrer Querflöte und ihren dunklen Locken durch den großen Übungsraum spazierte, in einem nicht zu langen Kleid – das war Bernds Dresscode für die Schnuppertage.
»Immer dran denken, es sind die Papas, die den Unterricht bezahlen!« Aber zu kurz durfte das Kleid auch wieder nicht sein, »die Mamas sollen ja keine schlechte Laune kriegen!«
Bernd grinste breit und zwinkerte, wenn er das sagte, aber Anne kannte ihn jetzt fast fünf Jahre. Es war sein voller Ernst.
Sie hasste das hellblaue Jeanshemd und den Zopf, sie hasste auch sich selbst, wenn sie die Rattenfänger-Nummer abzog, während die zukünftigen Musimaus-Schüler ohne Gnade die Orff’schen Instrumente im großen Übungsraum traktierten.
Sie fühlte sich wie eine Traumschiff-Hostess, die beim Käpt’ns-Dinner die Eistorte mit den Wunderkerzen hereintragen musste.
Aber Kreuzfahrt-Passagiere klatschten wenigstens im Takt.
»Hast du das wirklich nötig, Anne?«
Warum war sie ans Telefon gegangen gestern Abend? Sie hatte die Nummer ihrer Mutter auf dem Display gesehen und trotzdem abgenommen. Ein Fehler, immer wieder.
Erst hatte Marlene ein paar Minuten mit Leon gesprochen, aber er war noch nicht so gut im Telefonieren, nickte den Hörer an oder schüttelte den Kopf, wenn seine Großmutter ihm eine Frage stellte. Anne musste auf Lautsprecher stellen und Leons stumme Antworten übersetzen.
»Was wünschst du dir denn von der Großmama zu Weihnachten, mein Schatz?«
Leon sah Anne ratlos an, in der Kita bastelten sie gerade erst Laternen.
»Ich glaube, Leon muss darüber noch ein bisschen nachdenken, Mama.« Mama mit Betonung auf der zweiten Silbe, das war Marlene wichtig.
Als Leon in seinem Zimmer verschwunden war, stellte Anne den Lautsprecher aus und stand vom Sofa auf. Sie nahm noch immer Haltung an, wenn sie mit ihrer Mutter sprach. Als ihr das auffiel, setzte sie sich wieder.
»Anne, wie geht es dir? Ich höre sehr wenig.«
»Alles in Ordnung, Mama. Gut geht’s mir.«
»Das ist schön.« Marlene war eine Meisterin der Pausensetzung.
»Mir geht es übrigens auch gut.«
»Ich hätte dich schon noch gefragt, Mama.«
Ohne es zu merken, war Anne wieder aufgestanden. Sie nahm ein Sofakissen, ließ es auf den Boden fallen und kickte es einmal quer durchs Wohnzimmer.
»Und, was heißt das, alles in Ordnung«, fragte Marlene, »heißt das, du hast endlich aufgehört bei dieser Klimper-Schule?«
Anne nahm das zweite Sofakissen und kickte es an die Wand.
»Nein, Mama, das heißt es nicht.«
Sie schloss die Augen und zählte langsam bis drei. Kleine Kunstpause am anderen Ende der Leitung, dann tiefes Einatmen, gefolgt von stoßartigem Ausatmen durch den Mund, dann, resigniert und fast geflüstert: »Hast du das wirklich nötig, Anne?«
Sie hätte jetzt auflegen sollen, normalerweise tat sie das an dieser Stelle, gestern war offensichtlich nicht ihr Tag gewesen.
»Mama, hör endlich auf mit dem Scheiß!«
»Sag mal, wie redest …«
»Es ist nicht mein Problem, wenn dir mein Leben peinlich ist.«
Es dauerte ein bisschen, bis Marlene wieder sprechen konnte. »Du hattest alles, Anne.«
Die anderen Mädchen waren immer so nervös gewesen vor den Auftritten. Bleich vor Angst hatten sie neben den Klavierlehrern gesessen und gewartet, bis sie dran waren, und sich dann mit hängenden Köpfen die paar Stufen zur Bühne hochgeschleppt, als gingen sie zur Hinrichtung.
Anne hatte es geliebt. Das Beben im Bauch, nur ganz leicht, wenn der Name aufgerufen wurde, und dann mit wippenden Locken die Bühnentreppe rauf, schwungvoll auf den Klavierhocker zu, einmal kurz den Kopf in den Nacken – und los.
»Klar, dass du das super findest. Weil du immer gewinnst«, hatte Cathrin gesagt, ihre beste Freundin, ohne jeden Neid, es war nur eine Feststellung. Annes erster Platz bei Jugend musiziert war fast Routine. Kreiswettbewerb, Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb – sie musste einen ziemlich schlechten Tag erwischen, um auf Platz zwei oder gar drei zu landen, dann ärgerte sie sich so über sich selbst, dass sie sich hinterher noch mehr beim Üben quälte.
Die ersten drei Jahre hatte Marlene sie selbst unterrichtet, sie kam auch später mit zu allen Wettbewerben. Große Eisbecher nach den Konzerten, und als sie älter wurde große Shoppingtouren, Arm in Arm, sehr glücklich.
Es tat noch immer weh, daran zu denken. Und an den Vater, sein Lächeln, seine Hände auf ihren Schultern, wenn sie mit einem ersten Preis nach Hause kam, große Hände, die noch den Bauernsohn verrieten. »Kartoffelgrubberhände«, sagte Marlene, an guten Tagen klang es zärtlich.
Als wäre es gar kein Problem für sie, dass ihr Mann ein Aufgestiegener war, ein Junge vom Land, der seinen Stallgeruch zwar losgeworden war in Hörsälen und Bibliotheken, dem aber hin und wieder noch das »r« im Mund nach vorne rutschte, und dann rollte er es wie im Plattdeutschen. Marlene zuckte jedes Mal zusammen. Wie ein Landarbeiter.
Anne liebte es, weil der Physikprofessor Enno Hove in diesen Augenblicken nahbar war wie sonst nur selten. Ein Papa, mit Betonung auf der ersten Silbe.
»Das Talent hat sie von mir!«
Marlene hatte verzichtet auf die Musikkarriere, als sie mit einundzwanzig schwanger wurde. Das jedenfalls war ihre Sicht der Dinge.
Ein großes Opfer sei das allerdings auch nicht gewesen, stellte Großmutter Hildegard dann immer gerne klar. »Sagen wir, es war ein Öpferchen. Marlene und Karriere, ach Gott.«
Aber Anne schien das Zeug zu haben, nicht einmal Hildegard von Kamcke zweifelte daran. Musikgymnasium, natürlich, die ersten Konzerte in Schulen und Kulturzentren, und dann, zum vierzehnten Geburtstag, ihr eigener Flügel.
Er war fast zu groß für das Wohnzimmer, ein Bechstein, gebraucht, die Eltern hatten trotzdem einen Kredit aufnehmen müssen. Arm in Arm standen sie und hörten Anne das erste Mal spielen auf ihrem kostbaren Instrument, der schwarze Lack so ernst und feierlich wie ein Versprechen.
Thomas war damals sieben, ihr kleiner Bruder, er kam gerade in die zweite Klasse, vier Wackelzähne, seltsamerweise wusste sie das noch.
Anne hatte ihm schon früh die ersten Stücke am Klavier gezeigt. Thomas auf ihrem Schoß, die pummeligen kleinen Finger auf den Tasten, er lernte schnell, sie spielten bald vierhändig.
Mit acht Jahren hatte er sie eingeholt.
Mit neun war er der Bessere.
Vorspiel am Konservatorium, ein Gutachter, der um Fassung rang. Die Mutter in glückseliger Aufregung, der Vater fast scheu in seiner Ehrfurcht. Ein Wunderkind!
Die ganze Welt erleuchtet von dem Strahlen dieses Kindes.
Du hattest alles, Anne.
Erst alles und dann gar nichts mehr. Licht aus. Totale Sonnenfinsternis mit sechzehn. Kein Mensch sah ein begabtes Kind, wenn ein begnadetes den Raum betrat.
Nach der Rattenfänger-Nummer musste sie rennen, um Leon aus der Kita abzuholen, und trotzdem kam sie viel zu spät.
Mit rotem Kopf schlich sie zum Gruppenraum, wo Leon in der Duplo-Ecke spielte, allein, schon fertig angezogen, während die Erzieherin unter dem Esstisch fegte und Anne mit hochgezogenen Augenbrauen begrüßte.
Sie hatte sich angewöhnt, statt einer Entschuldigung nur noch Schönen Feierabend! in den Raum zu rufen, sie schnappte Leon und trug ihn schnell hinaus, wie eine tickende Zeitbombe, die jede Sekunde hochgehen könnte.
Sie kaufte ihm ein Brötchen, für sich selbst einen Cappuccino im Pappbecher, und schob die Kinderkarre Richtung Fischerspark, reihte sich ein in den Treck der Ottensener Vollwert-Mütter, die jeden Tag aus ihren Altbauwohnungen strömten, um ihren Nachwuchs zu lüften, die Einkäufe aus dem Bio-Supermarkt im Netz des Testsieger-Buggys, den Kaffeebecher in der Hand und im Fußsack aus reiner Schafwolle ein kleines Kind, das irgendetwas Durchgespeicheltes aus Vollkorn in der Hand hielt.
Wie alles in ihrem Leben schien auch das ihr irgendwie zugestoßen zu sein: Muttersein in einem angesagten Großstadtviertel.
Es war ein kalter Nachmittag, der Himmel grau wie Stein, sie würden es nicht lange aushalten im Fischerspark, den alle Mütter Fischi nannten, aber Leon brauchte nach dem Vormittag in seiner Kita frische Luft.
Die Käfergruppe ging nicht oft genug nach draußen, es würde wieder mal ein Thema auf dem Elternabend sein, sie hatte nicht die Absicht hinzugehen.
Anne holte Leon aus dem Buggy und gab ihm seinen Playmobilbagger, setzte sich auf die Bank und sah zu, wie er zur Sandkiste marschierte, wo ein kleiner Junge mit einer Schildkrötensandform saß. Er hatte schon eine stattliche Reptilienpopulation produziert und schien den Rest der Sandkiste für weitere Schildkröten vorgesehen zu haben.
Leon stand mit seinem Bagger davor und traute sich offenbar nicht hinein, Anne schaute weg, am besten mischte man sich gar nicht ein.
Zwei Bänke weiter saß eine Frau, die ihre Tochter Sprosse für Sprosse die Stufen einer Rutsche hochjubelte, sie trug einen Parka mit vielen Kordeln und Reißverschlüssen und Camper-Schuhe.
Die meisten Mütter auf dem Spielplatz trugen diese Camper-Schuhe. Sie hinterließen lange, kringelige Lochmusterspuren im Spielplatzsand, wenn die Frauen, wie gutmütige Familienhunde, die Schnuller und Trinkflaschen apportierten, die ihre Kleinkinder aus den Buggys warfen.
Leon stand immer noch am Rand der Sandkiste, ein Bein hatte er über die Kante geschwungen, aber weiter kam er nicht, weil der Schildkrötenjunge lautstark sein Revier verteidigte.
»Du darfst hier nicht rein! Das ist nur für Schildkröten!«
Leon sah sich kurz zu Anne um, und als sie nickte, setzte er auch den zweiten Fuß in die Sandkiste und stellte seinen Bagger ab. Der Schildkrötenjunge fing an zu brüllen und versuchte Leon wegzuschieben.
Anne sah, wie eine schwangere Frau ein bisschen mühsam von einer der Bänke aufstand und lächelnd zur Sandkiste ging. Sie beugte sich zu Leon herunter und legte den Kopf ein bisschen schief. »Du, sag mal, könntest du vielleicht woanders baggern? Ginge das? Guck mal, der Alexander, der war hier ja zuerst, und der macht hier gerade so schöne Schildkröten.«
Anne sprang auf und ging zur Sandkiste.
Sie kannte sich selbst gut genug, um zu wissen, dass sie ein Wortgefecht mit einer Ottensener Übermutter nicht gewinnen würde, also stieg sie wortlos zu Leon in die Sandkiste, trat dabei leider einige Schildkröten platt, zerstörte ein paar weitere, weil sie sich in den Sand kniete, und gab ihrem Sohn einen Kuss.
»So, Leon, bagger los. Oder soll ich?« Sie tat, als wollte sie ihm den Bagger wegnehmen. Leon lachte, schnappte sich sein Spielzeug und begann zu graben.
Anne setzte sich auf den Rand der Sandkiste und sah ihm zu.
Die Mutter des Schildkrötenjungen starrte sie angewidert an, ihr Sohn beschallte mittlerweile den ganzen Spielplatz, deshalb konnte Anne nicht verstehen, was sie sagte. Sie sah nur, wie die Frau ihr schreiendes Kind aus der Sandkiste zog, es mit tröstenden Worten in seine Karre setzte und verschwand.
Sie hatten dem armen kleinen Alexander, seiner schwangeren Mama und – jede Wette – auch dem Ungeborenen in ihrem Bauch den Tag versaut.
Anne hoffte, dass sie nicht am nächsten Schnuppertag bei Musimaus auftauchen würden.