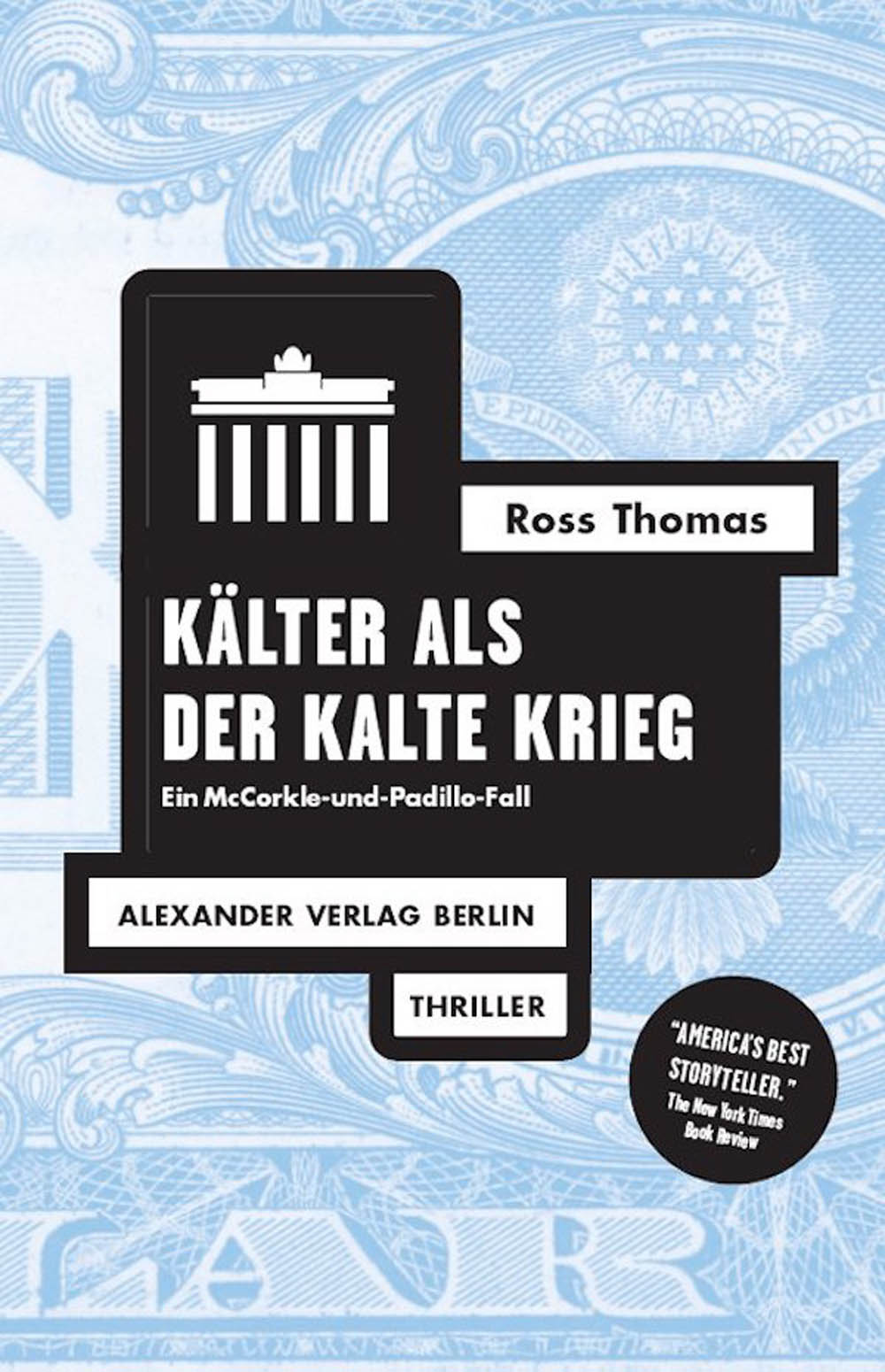
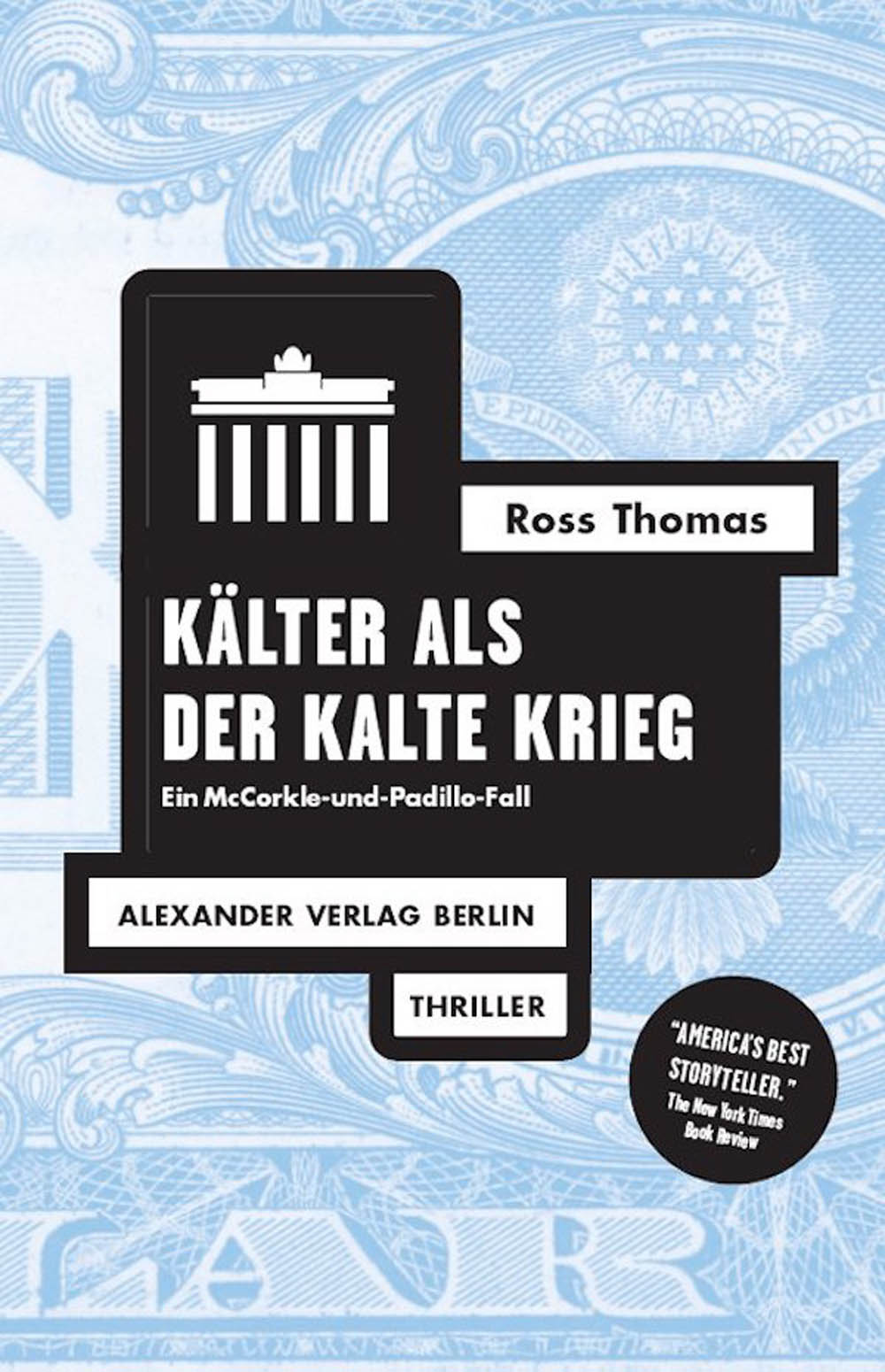
Ross Thomas, Kälter als der Kalte Krieg

Das Buch: Unter dem Originaltitel »The Cold War Swap« erschien 1966 dieser erste Roman von Ross Thomas – und erhielt prompt den angesehenen Edgar Allan Poe Award.
»Es ist ein geruhsames Leben, das Mac McCorkle als Restaurantbesitzer in Bonn führt. Daß sein Partner Mike Padillo gelegentlich zu Sonderaufträgen abkommandiert wird, stört die rheinländische Beschaulichkeit nicht weiter – bis eines Tages ein dicker Mann namens Maas auftaucht, dessen Gesprächspartner in Macs Kneipe niedergeschossen und Padillo wieder zum Agenteneinsatz gerufen wird. Nichts ist diesmal wie sonst, McCorkle muß bald, aus Freundschaft, nach Berlin, um dort Kopf und Kragen bei einer selbst für Geheimdienst- (nicht aber natürlich für Ross Thomas-)Verhältnisse überaus undurchsichtigen Rettungs- und Austauschaktion zu riskieren.« Ekkehard Knörer, crime-corner.de
»Die Kneipe, die die Protagonisten McCorkle und sein Partner Padillo in Bonn führen, heißt ›Mac’s Place‹. Mac’s Place ist ein neuer Ort auf der Landkarte der Kriminalliteratur. Selbst ein Marlowe würde hier zwar nicht als Trinker, aber als puritanisch räsonierendes Überbleibsel aus ferner Zeit auffallen. Mac ist definitiv eine Figur unserer Zeit: zu abgebrüht für jede Parole, zu zynisch, um nicht sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Die Story ist raffiniert gestrickt, die Atmosphäre stimmt haarklein, die Schreibe ist exzellent – ein absoluter Hit der Thriller-Szene.« Jörg Fauser
Der Autor: Ross Thomas, geboren 1926 in Oklahoma, war Journalist, politischer Berater und Mitorganisator von Wahlkämpfen. In den 50er Jahren baut er in Bonn das deutsche AFN-Büro auf, arbeitet danach für verschiedene amerikanische Organisationen. Mit 40 schreibt Thomas seinen ersten Roman. Er wurde mit dem Edgar-Allan-Poe-Preis und dem deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Bis zu seinem Tod 1995 entstehen 25 Romane.
Ross Thomas
Kälter als der Kalte Krieg
Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Aus dem Amerikanischen
von Wilm W. Elwenspoek,
durchgesehen und überarbeitet
von Gisbert Haefs und Anja Franzen
Alexander Verlag Berlin
Von Ross Thomas liegen in gleicher Ausstattung ebenfalls vor:
Die im Dunkeln
Gottes vergessene Stadt
Umweg zur Hölle
Kälter als der Kalte Krieg
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1966 unter dem Titel The Cold War Swap.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1970 im Ullstein Verlag, Frankfurt/M.– Berlin unter dem Titel Der Einweg-Mensch.
© 1966 und 2003 by Ross E. Thomas, Inc.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2007
Alexander Wewerka, Postfach 19 18 24, D-14008 Berlin info@alexander-verlag.com
www.alexander-verlag.com
Umschlaggestaltung Antje Wewerka
Alle Rechte vorbehalten
Druck und Bindung Interpress, Budapest
ISBN 978-3-89581-235-4
Printed in Hungary (October) 2007
Ebook: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Er kam als letzter an Bord der Maschine von Tempelhof nach Köln-Bonn. Er hatte sich verspätet, geriet durcheinander und schwitzte, als er den Flugschein nicht fand, bis die Suche seine innere Jackentasche erreichte.
Die englische Stewardeß war geduldig und lächelte sogar nett, als er ihr ihn schließlich mit gemurmelten Entschuldigungen reichte. Der Sitz neben mir war frei, und er steuerte darauf zu, wobei er eine schäbige Aktentasche gegen die Arme der Passagiere rammte, als er den Mittelgang entlangstolperte. Mit einem Schnaufen ließ er sich auf den Sitz fallen. Er war nicht groß; untersetzt, vielleicht sogar fett, und trug einen dicken braunen Anzug, den ein Klempner zugeschnitten haben mochte, und einen dunkelbraunen Hut ohne besondere Form oder Merkmale, abgesehen davon, daß er gerade auf seinem Kopf saß, fast wie mit der Wasserwaage abgemessen.
Er stopfte die Aktentasche zwischen die Beine und schnallte sich an, nahm aber den Hut nicht ab. Er beugte sich vor, um aus dem Fenster zu sehen, als das Flugzeug zum Startpunkt der Landebahn rollte. Beim Start wurden seine Hände an den Knöcheln weiß, weil er die Lehnen seines Sitzes umklammerte. Als er begriff, daß der Pilot nicht zum ersten Mal flog, lehnte er sich zurück, zog eine Packung Senoussi hervor und zündete sich eine mit einem Streichholz an. Er blies den nicht eingeatmeten Rauch aus und betrachtete mich mit jenem forschenden Blick, der unterhaltungsbedürftige Mitreisende kennzeichnet.
Ich war für ein dreitägiges Wochenende in Berlin gewesen, an dem es mir gelungen war, zuviel Geld auszugeben und einen prächtigen Kater zu erwerben. Ich hatte im Hotel am Zoo gewohnt, wo die Martinis so gut sind wie in keinem anderen Lokal Europas, ausgenommen vielleicht Harry’s Bar in Venedig.
Sie hatten ihren üblichen Tribut gefordert, und in der Stunde, die der Flug von Berlin nach Bonn dauert, mußte ich dringend schlafen.
Aber der Mann auf dem Platz neben mir wollte sich unterhalten. Ich konnte beinahe spüren, wie sein Verstand arbeitete und nach einer Eröffnung suchte, während ich mich mit geschlossenen Augen so weit zurücklehnte, wie der Sitz sich kippen ließ, und mein Kopf in inniger Harmonie mit dem Summen der Motoren brummte.
Sein Eröffnungszug war dann nicht originell.
»Wollen Sie nach Köln?«
»Nein«, sagte ich und behielt die Augen geschlossen, »ich will nach Bonn.«
»Sehr gut! Ich will auch nach Bonn.«
Das war nett. Das machte uns zu Reisegefährten.
»Mein Name ist Maas«, sagte er, packte meine Hand und schüttelte sie kräftig nach deutscher Art. Ich öffnete die Augen. »Ich heiße McCorkle. Sehr erfreut.«
»Ach, Sie sind kein Deutscher?«
»Amerikaner.«
»Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch.«
»Ich lebe schon lange hier.«
»Der beste Weg, eine Sprache zu lernen«, sagte Maas und nickte beifällig. »Man muß in dem Land leben, wo sie gesprochen wird.«
Das Flugzeug flog seine Bahn, wir saßen da und machten small talk über Berlin und Bonn und das, was manche Amerikaner von der Lage in Deutschland hielten. Mein Kopf schmerzte nach wie vor, und ich fühlte mich miserabel.
Selbst wenn es nicht bewölkt ist, gibt es zwischen Berlin und Bonn nicht viel zu sehen. Der Flug ist grau und düster wie einer über Nebraska oder Kansas an einem Februartag. Aber die
Dinge entwickelten sich freundlicher. Maas wühlte in seiner Aktentasche und förderte eine halbe Flasche Steinhäger zutage. Das war aufmerksam. Steinhäger trinkt man am besten eiskalt und spült mit einem Liter Bier nach. Wir tranken ihn warm aus kleinen Silberbechern, die er gleichfalls zur Verfügung stellte. Als die beiden Türme des Kölner Doms in Sicht kamen, waren wir beinahe per du, aber noch nicht ganz. Immerhin hatten wir uns schon so weit angefreundet, daß ich Maas anbot, ihn mit nach Bonn zu nehmen.
»Sehr freundlich von Ihnen. Ich will mich Ihnen bestimmt nicht aufdrängen. Ich danke Ihnen sehr. Aber keiner kann auf einem Bein stehen. Machen wir die Flasche leer.«
Wir machten sie leer, und Maas verstaute die beiden Silberbecher wieder in seiner Aktentasche. Der Pilot setzte die Maschine mit nur zwei Stößen bei der Landung auf, und Maas und ich stiegen unter der gedämpften Mißbilligung der beiden Stewardessen aus. Meine Kopfschmerzen waren verschwunden.
Maas hatte nur seine Aktentasche, und nachdem ich meinen Koffer geholt hatte, gingen wir zum Parkplatz, wo ich zu meiner freudigen Überraschung den Wagen intakt vorfand. Deutsche Jungkriminelle – oder Halbstarke – bringen einen Wagen so schnell in Gang, daß daneben ihre amerikanischen Kollegen wie Schwächlinge wirken. In dem Jahr fuhr ich einen Porsche, und Maas geriet darüber ins Schwärmen. »Was für ein wunderbarer Wagen. Dieser Motor. Und so schnell.« Er murmelte weitere Lobsprüche, während ich den Wagen aufschloß und meinen Koffer auf dem Rücksitz verstaute, wie dieser optimistisch genannt wird. Ein Porsche weist einige Vorzüge auf, die kein anderer Wagen hat, aber Dr. Ferdinand Porsche hat ihn nicht für Dicke entworfen. Er muß die langen hageren Rennfahrertypen wie Moss und Hill vor Augen gehabt haben. Herr Maas versuchte, mit dem Kopf statt mit dem Hinterteil voran einzusteigen. Sein brauner Zweireiher öffnete sich, und die Luger, die er in einem Schulterhalfter trug, war eine Sekunde lang zu sehen.
Ich fuhr über die Autobahn nach Bonn. Der Weg ist etwas länger und weniger malerisch als die übliche Strecke, die reisende Ministerpräsidenten, Staatsoberhäupter und Premiers nehmen, wenn sie einen Grund haben, die westdeutsche Hauptstadt zu besuchen. Der Wagen lief gut, ich hielt ihn bei bescheidenen 140 km/h, und Herr Maas summte vor sich hin, während wir an Volkswagen, Kapitänen und gelegentlich einem Mercedes vorbeizischten.
Wenn er eine Waffe tragen wollte, war das seine Sache. Es gab Gesetze dagegen, aber es gibt schließlich auch Gesetze gegen Ehebruch, Mord, Brandstiftung und Spucken auf den Bürgersteig. Es gibt alle möglichen Gesetze, und durch den Steinhäger milde gestimmt beschloß ich, daß ein fetter kleiner Deutscher, der eine Luger herumtragen wollte, wahrscheinlich gute Gründe dafür hatte.
Ich war noch dabei, mir zu dieser überlegenen, weltläufigen Haltung zu gratulieren, als mein linker Hinterreifen platzte. Mit dem, was ich noch immer als meisterhafte Selbstbeherrschung betrachte, hielt ich den Fuß von der Bremse zurück, trat sanft auf das Gaspedal, übersteuerte etwas und brachte den Wagen wieder in gerade Richtung – auf der falschen Fahrbahn vielleicht, aber wenigstens in einem Stück. An dieser Stelle hat die Autobahn keinen Mittelstreifen. Ein ebenso großes Glück war, daß gerade kein Verkehr aus der Gegenrichtung kam.
Maas sagte kein Wort. Ich fluchte fünf Sekunden lang und fragte mich dabei, ob die Garantie von Michelin sich wohl bezahlt machen würde.
»Mein Freund«, sagte Maas, »Sie sind ein ausgezeichneter Fahrer.«
»Danke«, sagte ich und zog an dem Knopf, der die vordere Haube öffnete, unter der sich das Reserverad befand.
»Wenn Sie mir sagen, wo Sie das Werkzeug haben, werde ich den Reifen wechseln.«
»Das ist mein Job.«
»Nein! Ich war mal ein ganz guter Mechaniker. Wenn Sie nichts dagegen haben, übernehme ich die Reparatur.«
Der Porsche hat an der Seite eine Halterung für den Wagenheber, aber das brauchte ich Herrn Maas nicht zu sagen. Er hatte das Rad mit dem geplatzten Reifen in drei Minuten abmontiert; zwei Minuten später zog er die letzte Mutter des Reserverads mit einem letzten Ruck fest und drückte mit der Miene eines Mannes, der weiß, daß er gute Arbeit geleistet hat, die Radkappe auf. Er hatte nicht einmal die Jacke ausgezogen.
Die Vorderhaube war noch offen, und Maas rollte den geplatzten Reifen nach vorn und hob ihn an seinen Platz. Er knallte den Deckel zu und stieg wieder in den Wagen, diesmal mit dem Hinterteil zuerst. Als wir wieder über die Autobahn rollten, dankte ich ihm für seine Mühe.
»Nicht der Rede wert, Herr McCorkle. Es war mir ein Vergnügen, Ihnen helfen zu können. Wenn Sie so freundlich wären, mich am Bahnhof abzusetzen, sobald wir in Bonn sind, bin ich nach wie vor in Ihrer Schuld. Ich kann mir da ein Taxi nehmen.«
»So groß ist Bonn nicht«, sagte ich. »Ich kann Sie absetzen, wo Sie wollen.«
»Aber ich muß nach Bad Godesberg. Das ist weit entfernt von der Bonner Stadtmitte.«
»Schön. Da fahre ich auch hin.«
Ich fuhr über die Viktoriabrücke zur Reuterstraße und dann zur Koblenzer Straße, einem zweispurigen Boulevard, den die einheimischen Witzbolde »Diplomatenrennbahn« getauft haben. Morgens konnte man dort den Kanzler in seinem Mercedes 300 erhaben vorbeischweben sehen, eskortiert von einem Paar strammer Polizisten auf Motorrädern; eine weiße Sonderanfertigung von Porsche, die den Begleitschutz anführte, scheuchte das gewöhnliche Volk zur Seite, während die Prozession ihren Weg zum Palais Schaumburg feierlich zurücklegte.
»Wo wollen Sie in Godesberg hin?« fragte ich.
Er wühlte in seiner Jackentasche, zog ein blaues Notizbuch heraus und blätterte darin. »Zu einem Café. Es heißt Mac’s Place. Kennen Sie es?«
»Klar doch«, sagte ich und schaltete vor einer roten Ampel in den zweiten Gang herunter. »Es gehört mir.«
Wahrscheinlich kann man ein paar tausend Lokale wie Mac’s Place in New York, Chicago oder Los Angeles finden. Sie sind dunkel und still, die Möbel schon etwas abgewetzt, der Teppich durch verschüttete Getränke und Zigarettenasche zu einem unbestimmbaren Farbton verblaßt, der Barmann freundlich und flink, aber taktvoll genug, keine Bemerkung zu machen, wenn man mit der Frau eines anderen hereinkommt. Die Getränke sind kalt, großzügig bemessen und etwas teuer, der Service ist bemerkenswert, und die Küche, wenn sich die Speisekarte auch auf Hähnchen und Steaks beschränkt, serviert wirklich sehr gute Hähnchen und Steaks.
In diesem Jahr gab es in Bonn und Bad Godesberg noch ein paar andere Lokale, in denen man einen anständig gemixten Drink bekam. Eines war der American Embassy Club, in dem man Mitglied oder Gast eines Mitglieds sein mußte. Ein anderes war der Schaumburger Hof, wo man für 2 cl Scotch Preise bezahlte, die man sich nur auf Spesenkonto leisten konnte.
Ich hatte das Lokal im Jahr nach Eisenhowers erster Wahl zum Präsidenten eröffnet. Und da er in seiner Wahlkampagne versprochen hatte, nach Korea zu gehen und so weiter, kam die Army zu der Überzeugung, daß die nationale Sicherheit nicht erheblich leiden würde, wenn die in der ausgedehnten amerikanischen Botschaft am Rhein untergebrachte Military Assistance Advisory Group auf meine Dienste verzichtete. Tatsächlich hatte man schon läßlich spekuliert, warum ich überhaupt zum zweiten Mal einberufen worden war. Ich fragte mich das auch, da während der angenehmen zwanzig Monate meines Aufenthalts in der Botschaft, die in ein Krankenhaus umgewandelt werden soll, falls und wenn die deutsche Hauptstadt je nach Berlin verlegt wird, mich nie jemand aufgefordert hatte, bei irgend etwas Wichtigem zu beraten oder zu assistieren.
Einen Monat nach meiner Entlassung in Frankfurt war ich wieder in Bad Godesberg und saß auf ein paar Bierkästen in einem niedrigen Raum, der einmal eine Gaststätte gewesen war. Feuer hatte sie zerstört, und ich schloß mit dem Hausbesitzer einen langfristigen Mietvertrag, nach dem er nur die grundlegenden Reparaturen vorzunehmen hatte. Jede zusätzliche Renovierung und jeder Ausbau gingen auf meine Kosten. Ich saß auf den Bierkästen, von Kisten mit Geräten, Möbeln und unausgepackten Gläsern umgeben, hielt mich an einer Flasche Scotch fest und füllte auf einer Reiseschreibmaschine in sechsfacher Ausfertigung meinen achten Antrag auf eine Lizenz aus, Speisen und Getränke feilzubieten – das alles im warmen Schimmer einer Petroleumlampe. Der Stromanschluß erforderte einen weiteren Antrag.
Als er hereinkam, tat er dies sehr leise. Er hätte erst eine Minute dasein können, aber es konnten auch schon zehn sein. Ich fuhr zusammen, als er mich ansprach.
»Sind Sie McCorkle?«
»Ich bin McCorkle«, sagte ich und tippte weiter.
»Sie haben hier ein hübsches Lokal.«
Ich drehte mich um, um ihn anzusehen. »Meine Güte, einer aus Yale.«
Er war nicht ganz einsachtzig groß und mochte ein- oder zweiundsiebzig Kilo wiegen. Er zog einen Bierkasten heran, um sich zu setzen, und die Art, in der er sich bewegte, erinnerte mich an einen Siamkater namens Pajama Cord, den ich einmal besessen hatte.
»New Jersey, nicht New Haven«, sagte er.
Die Uniform stand ihm gut: das schwarze Haar im Bürstenschnitt; das junge, sonnengebräunte, freundliche Gesicht; die Drei-Knöpfe-Jacke aus weichem Tweed mit einem Buttondown-Hemd und einer Krawatte mit Regimentsstreifen, deren Knoten in der Größe einer kernlosen Traube elegant gebunden war. Er trug auch kappenlose Schuhe aus Korduanleder, die im Lampenlicht schwärzlich glänzten. Die Socken konnte ich nicht sehen, nahm aber an, daß sie nicht weiß waren.
»Vielleicht Princeton?«
Er grinste. Es war ein Lächeln, das beinahe seine Augen erreichte. »Warm, mein Freund. Tatsächlich war es die Blue Willow Bar and Grill in Jersey City. Jeden Samstagabend hatten wir da schicke Shuffleboard-Spieler.«
»Und was kann ich sonst noch für Sie tun, außer Ihnen einen Bierkasten als Sitz und einen Schluck auf Kosten des Hauses anzubieten?« Ich reichte ihm den Scotch, und er tat zwei kräftige Züge, ohne sich erst die Mühe zu machen, den Hals der Flasche abzuwischen. Ich fand das höflich.
Er gab sie mir zurück, und ich trank auch einen Schluck. Er wartete, bis ich mir eine Zigarette angezündet hatte. Er schien jede Menge Zeit zu haben.
»Ich möchte mich an Ihrem Lokal beteiligen.«
Ich sah mich in dem Durcheinander um. »Ein Anteil an nichts ist nichts.«
»Ich möchte mich einkaufen. Mit der Hälfte.«
»Einfach so, wie?«
»Einfach so.«
Ich griff nach dem Scotch, reichte ihm die Flasche, und er trank einen Schluck, und dann trank ich noch einen.
»Vielleicht hätten Sie gern eine Anzahlung – daß ich’s ernst meine?« sagte er.
»Hab ich was davon gesagt?«
»Es heißt, Geld ist immer ein gutes Argument«, sagte er, »aber ich habe ihm nie so richtig zugehört.« Er griff in die Innentasche seiner Jacke und zog ein Stück Papier heraus, das sehr nach einem Scheck aussah. Er reichte es mir. Es war ein Scheck, in Dollar auf eine New Yorker Bank ausgestellt. Er war beglaubigt. Er trug meinen Namen. Und er lautete genau über die Hälfte des Kapitals, das ich brauchte, um die Pforten zu Bonns neuestem und freundlichstem Bar-and-Grill zu öffnen.
Ich reichte den Scheck zurück. »Ich brauche keinen Partner. Ich will keinen.«
Er nahm den Scheck, stand auf, ging zu dem Tisch, auf dem die Schreibmaschine stand, und legte den Scheck darauf. Dann drehte er sich um und sah mich an. Sein Gesicht war ausdruckslos.
»Wie wär’s mit einem weiteren Drink?« fragte er.
Ich reichte ihm die Flasche. Er trank und gab sie mir zurück. »Danke. Jetzt werde ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Es wird nicht lange dauern, aber wenn ich fertig bin, werden Sie wissen, warum Sie einen neuen Partner haben.«
Ich trank einen Schluck. »Nur zu. Ich habe noch eine Flasche, falls wir trockenfallen.«
Er hieß Michael Padillo, sagte er, als er dort in dem unordentlichen, halbdunklen Raum saß und sprach. Er war halb Este, halb Spanier. Sein Vater war in Madrid Rechtsanwalt gewesen, hatte sich im Bürgerkrieg auf die Seite der Verlierer gestellt und war 1937 erschossen worden. Seine Mutter war die Tochter eines estnischen Arztes. Sie hatte Padillos Vater 1925 bei einem Urlaub in Paris kennengelernt. Sie heirateten, und der Sohn wurde im folgenden Jahr geboren. Seine Mutter war eine beeindruckende, ja schöne, hochkultivierte und hochgebildete Frau.
Nach dem Tod ihres Mannes erreichte sie dank ihres estnischen Passes Lissabon und schließlich Mexico City. Dort überlebte sie durch Klavierstunden und Sprachunterricht in Französisch, Deutsch, Englisch und gelegentlich Russisch.
»Wenn man Estnisch kann, kann man alles sprechen«, sagte Padillo. »Sie sprach akzentfrei acht Sprachen. Sie sagte mir einmal, daß die drei ersten Sprachen am schwersten zu lernen sind. Einen Monat lang haben wir nur Englisch gesprochen, im nächsten Französisch. Dann Deutsch oder Russisch oder Estnisch oder Polnisch und zurück zu Spanisch oder Italienisch und danach das Ganze wieder von vorn. Ich war jung genug, daß es mir Spaß gemacht hat.«
Padillos Mutter starb im Frühjahr 1941 an Tuberkulose. »Ich war damals fünfzehn und konnte sechs Sprachen, darum habe ich mir gesagt, zum Teufel mit Mexiko, und habe mich in die Staaten aufgemacht. Ich bin bis El Paso gekommen, wurde Hotelpage, Fremdenführer und Gelegenheitsschmuggler. Außerdem habe ich die Grundkenntnisse eines Barmanns aufgeschnappt.
Mitte 1942 habe ich beschlossen, El Paso hätte mir alles gegeben, was es geben kann. Ich habe mir eine Sozialversicherungskarte und einen Führerschein besorgt und mich zum Wehrdienst gemeldet, obwohl ich noch nicht alt genug war. Ich habe ein paar Briefbögen mit Firmenkopf von zwei der besseren Hotels geklaut und mir hymnische Empfehlungsschreiben als Barmann gedichtet. Auf beiden habe ich die Unterschriften der Manager gefälscht.«
Per Anhalter fuhr er durch das Big-Bend-Land von Texas nach Albuquerque und von dort über die Route 66 direkt nach Los Angeles. Padillo sprach von dem Los Angeles der glorreichen, verängstigten, kriegsfiebernden Tage des Jahres 1942 wie von einem privaten, aber lange verlorenen Paradies.
»Es war eine verrückte Stadt, voll von Betrügern, leichten Mädchen, Soldaten und Irren. Ich habe einen Job als Barmann gefunden. War ein nettes Lokal, man hat mich gut behandelt, aber es hat nicht lange gedauert, bis sie mich erwischt haben.«
»Wer?«
»Das FBI. Es war im August 1942. Ich hatte gerade aufgemacht. Sie waren zu zweit. Höflich wie Pfarrer. Sie zeigen mir ihre kleinen schwarzen Ausweise, und darin steht wirklich, daß sie vom FBI sind, und dann fragen sie, ob ich etwas dagegen hätte, mal mitzukommen, weil die Einberufungsbehörde mir schon seit einer Ewigkeit Briefe schreibt, die regelmäßig mit dem Stempel ›Empfänger unbekannt‹ zurückkommen. Und sie sind überzeugt, alles ist nur ein Irrtum, aber sie hätten ganze fünf Monate gebraucht, um mich ausfindig zu machen, und so weiter.
Tja, ich bin also mitgegangen und habe denen irgendwas erzählt – eine schriftliche Aussage gemacht und unterschrieben. Dann Fotos und Fingerabdrücke. Und danach bringen sie mich zu einem Staatsanwalt, der mir einen Vortrag hält und mich vor eine Wahl stellt: Ich könnte entweder zum Militär oder ins Gefängnis, weil ich mich der Wehrpflicht entzogen habe.«
Padillo ging zur Armee und meldete sich zur Fachschule für Köche und Bäcker. Ende 1942 leitete er fröhlich die Bar im Offizierskasino einer kleinen Infanterie-Ersatz-Einheit in Nord-Texas, nicht weit von Dallas und Fort Worth, ehe jemand seine Unterlagen durchging und feststellte, daß Padillo sechs Sprachen mündlich und schriftlich beherrschte.
»Sie sind nachts gekommen«, sagte er. »Der Top-Sergeant und der Kommandant und so ein Typ in Zivil. Es war alles wie ein mieser Fernsehkrimi im Nachtprogramm. Der olivgrüne Packard, die stumme Fahrt zum Flugplatz, die schweigsamen Piloten, die dauernd auf die Uhr sehen, während sie unter dem Flügel der C-47 auf und ab gehen. Reiner Kitsch.«
Das Flugzeug landete in Washington, und Padillo wurde von Büro zu Büro weitergeschoben. »Einige waren in Zivil, andere in Uniform. Wenn ich mich recht erinnere, haben sie in dem Jahr alle Pfeife geraucht.«
Sie prüften seine Sprachkenntnisse. »Ich kann Englisch mit Mississippi- oder Oxford-Akzent sprechen. Ich kann wie ein Berliner reden oder wie ein Zuhälter aus Marseille. Berlitz würde mich lieben.
Dann haben sie mich nach Maryland geschickt; da habe ich von ihnen ein paar Tricks gelernt und ihnen ein paar beigebracht, die ich in Juárez aufgeschnappt hatte. Es war alles ziemlich übertrieben, mit Decknamen und falscher Identität. Ich habe erzählt, ich wäre in einem mexikanischen Puff für die Handtücher zuständig gewesen. Die anderen haben meine Pseudo-Geschichte nie knacken können, aber sie haben mich detailliert über meine Tätigkeit ausgefragt und dabei viel Spaß gehabt.«
Als die Ausbildung in Maryland beendet war, wurde Padillo wieder nach Washington gebracht. Er kam in ein Haus in der R-Street, unmittelbar westlich der Connecticut Avenue. Man sagte ihm, der Colonel wolle ihn sprechen. »Er sah ganz so aus wie der Hollywoodschauspieler, der den Colonel in den Schulungsfilmen über Geschlechtskrankheiten spielte, die sie uns bei der Grundausbildung vorgeführt haben«, sagte Padillo. »Ich glaube, das war ihm peinlich.
Er hat mir gesagt, ich könnte einen wichtigen Beitrag zur ›nationalen Aufgabe‹ leisten, wie er es nannte. Wenn ich dazu bereit wäre, würde ich vom Militär entlassen, bekäme die amerikanische Staatsbürgerschaft, und bei der American Security and Trust Company würde auf meinen Namen ein gewisser Betrag eingezahlt. Wenn ich zurückkäme, könnte ich das Geld abheben.
Also habe ich gefragt, von wo zurück.
›Paris‹, sagt er und saugt an seiner Pfeife und schaut aus dem Fenster. Dafür, daß er früher Assistenzprofessor für Französisch an der Staatsuniversität von Ohio war, ging es ihm wirklich ganz gut.«
Padillo verbrachte in Frankreich zwei Jahre im Untergrund, meistens in Paris als Verbindungsmann der Amerikaner zum Maquis. Nach dem Krieg wurde er in die Vereinigten Staaten zurückgebracht. Er hob sein Geld von der Bank ab, erhielt einen Wehrausweis, auf dem stand, daß er untauglich sei, und der General persönlich klopfte ihm diskret auf die Schulter.
»Ich bin nach Los Angeles geflogen. 1945 ging es da immer noch wild zu, es war aber nicht mehr wie früher. Vielleicht hat es mir aber deshalb gefallen, weil es so verdammt verlogen war. Von der Wirklichkeit hatte ich genug.
Ich hatte auch genug Geld, daß ich mich eine Weile am Strip herumtreiben konnte. Ich habe ein paar Jobs als Statist gekriegt und dann angefangen, in einem kleinen Lokal auf dem Santa Monica Boulevard an der Bar zu arbeiten. Ich war sogar schon dabei, mich da einzukaufen, als sie aufgetaucht sind. Sie wissen schon: jung, einreihige Anzüge, Hüte. Sie hätten einen kleinen Auftrag, haben sie gesagt, der zwei oder drei Wochen in Anspruch nehmen würde. In Warschau. Keiner würde je erfahren, daß ich weg bin, und für mich wären zweitausend drin.«
Padillo trat seine Zigarette auf dem Boden aus und zündete eine neue an. »Ich bin los. Dieses Mal und vielleicht noch weitere zwei Dutzend Male, und als sie das letzte Mal in ihren dunklen Anzügen und mit ihren Akademikermanieren gekommen sind, habe ich nein gesagt. Sie wurden nur noch höflicher und vernünftiger und sind immer wieder gekommen. Sie fingen mit Andeutungen darüber an, daß man in Washington Fragen nach der Gültigkeit meiner Staatsbürgerschaft stellt, aber sie wären sicher, daß sich alles regeln läßt, wenn ich nur noch diesen einen Auftrag übernehme.
Ich habe einen Teil des Geldes zurückgekriegt, das ich ins Lokal investiert hatte, und bin nach Osten gegangen. In Denver habe ich in der Senate Lounge auf der Colfax Avenue gearbeitet, aber auch da haben sie mich gefunden. Darum bin ich nach Chicago gegangen und von Chicago nach Pittsburgh und von da nach New York. In New York habe ich von einem Lokal in Jersey gehört. Es war nett und ruhig. Die Gäste waren junge Leute vom College und aus der Umgebung. Ich habe etwas angezahlt.«
Draußen war es nun ganz dunkel. Die Petroleumlampe strahlte mit ihrem sanften, warmen Schimmer. Der Scotch in der Flasche ging zur Neige. Die Stille wirkte schwer und nachdenklich.
»Sie sind noch einmal gekommen, und diesmal waren sie nicht höflich. Darum mache ich jetzt mit Ihnen das, was sie mit mir gemacht haben. Ich brauche einen Unterschlupf in Bonn, und Sie waren so aufmerksam, mir einen zu beschaffen, der perfekt ist.«
»Was, wenn ich nein sage?«
Padillo betrachtete mich zynisch. »Haben Sie zufällig Probleme damit, die nötigen Genehmigungen und Lizenzen zu bekommen?«
»Ein paar.«
»Sie würden sich wundern, wie einfach es ist, wenn man die richtigen Beziehungen hat. Aber wenn Sie bei Ihrem Nein bleiben, stehen die Chancen fünfhundert zu eins, daß Sie nie Ihren ersten Martini verkaufen.«
»Aha. So ist das also?«
Padillo seufzte. »Ja, genauso ist es.«
Ich trank noch einen Schluck und hob die Schultern, obwohl mir nicht nach Achselzucken zumute war. »Okay. Sieht so aus, als ob ich einen Partner hätte.«
Padillo blickte zu Boden. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich das von Ihnen hören wollte, kann aber auch nicht das Gegenteil behaupten. Sie waren in Burma, nicht wahr?«
Ich sagte ja.
»Hinter den Linien?«
Ich nickte.
»Da hat es ein paar harte Burschen gegeben.«
Ich nickte wieder. »Ich habe ein bißchen was gelernt.« »Das könnte sich als nützlich erweisen.«
»Wie?«
Er grinste. »Um Samstag abends die Betrunkenen rauszuwerfen.« Er stand auf, ging zur Schreibmaschine, nahm den beglaubigten Scheck und reichte ihn mir wieder. »Gehen wir in den Club hinüber und verwenden einen Teil davon, um uns vollaufen zu lassen. Natürlich wird das denen nicht passen, aber viel dagegen tun können sie auch nicht.«
»Soll ich fragen, wer mit ›sie‹ gemeint ist?«
»Nein. Nur vergessen Sie nicht – Sie sind das Gewand, und ich bin der Dolch.«
»Ich glaube, das kann ich auseinanderhalten.«
Padillo sagte: »Kommen Sie, gehen wir was trinken.«
An diesem Abend betranken wir uns, aber ehe wir die Bar des Clubs betraten, griff Padillo nach dem Telefon und führte ein Gespräch. Alles, was er sagte, war: »In Ordnung.« Dann legte er den Hörer zurück und sah mich nachdenklich an. »Sie armes Schwein«, sagte er. »Ich glaube, das haben Sie eigentlich nicht verdient.«
Im folgenden Jahrzehnt ging es mit uns bergauf, und wir erwarben Erfolgssymbole wie einen Hauch Grau an den Schläfen, eine Reihe schneller, kostspieliger Wagen, eine weitere Reihe schneller, kostspieliger junger Damen, handgearbeitete Schuhe, Anzüge und Jacketts aus London und ein paar behagliche Zentimeter mehr um die Taille.
Es gab auch jene bewußten Tage, an denen ich gegen zehn Uhr vormittags ins Lokal kam und Padillo bereits an der Bar fand. Er saß vor einer Flasche Scotch und starrte in den Spiegel.
Er sagte immer nur: »Ich habe einen.«
Ich fragte immer nur: »Wie lange?«
Er antwortete dann: zwei Wochen oder zehn Tage oder einen Monat, und ich sagte nur: »In Ordnung.« Es war sehr wortkarg, sehr britisch, ganz wie Basil Rathbone und David Niven in Dawn Patrol. Dann bediente ich mich aus der Flasche, und wir saßen nebeneinander da und starrten in den Spiegel. Ich glaube, an diesen Tagen hat es immer geregnet.
Nachdem Padillo mir die Grundlagen des Gastwirtgewerbes beigebracht hatte, wurden wir ein gutes Geschäftsteam. Er war ein vorzüglicher Wirt, und seine Sprachkenntnisse machten das Lokal zum Lieblingsaufenthaltsort des Personals der Botschaften, einschließlich der Russen, die manchmal zu zweit und zu dritt kamen. Ich betrieb die geschäftliche Seite des Unternehmens, und unser Konto bei der Deutschen Bank in Bad Godesberg schwoll beruhigend an.
Zum Ausgleich für Padillos »Geschäftsreisen« flog ich gelegentlich nach London und in die Staaten, angeblich auf der Suche nach neuen Ideen. Ich kam zurück mit Katalogen für Küchengeräte und auffällige, zeitgemäße Möbel und mit originellen Cocktail-Ideen. Aber wir veränderten das Lokal nicht. Es wurde langsam ein bißchen schäbiger und ein bißchen lässiger. Unseren Gästen schien das zu gefallen.
Der Flug nach Berlin hatte wohl eine Geschäftsreise sein sollen. Ich wollte mich um einen Barmann bemühen, der Drinks im amerikanischen Stil mixen konnte. Er arbeitete im Berliner Hilton, aber als ich sagte, er würde in Bonn leben müssen, lehnte er ab. »Die Rheinländer sind alle verrückt«, sagte er und zerschnitt weiter Mister Hiltons Apfelsinen.
Herr Maas behielt seine Gesprächigkeit bei, als ich mit ihm durch die engen Straßen von Godesberg fuhr und auf einem der beiden reservierten Plätze parkte, die Padillo den Stadtvätern hatte entreißen können. Wir stiegen aus, und Herr Maas murmelte immer noch seine Dankesbekundungen, während ich ihm die Tür aufhielt. Es war halb vier, zu früh für die Cocktailstunde. Im Lokal war es gedämpft und dunkel wie immer, und Herr Maas blinzelte, um seine Augen darauf einzustellen. An Tisch 6 in der hinteren Ecke saß ein Mann mit einem Glas vor sich. Maas bedankte sich noch einmal und ging auf ihn zu. Ich trat an die Bar, wo Padillo stand und Karl, dem Barmann, zusah, der Gläser polierte, die nicht poliert zu werden brauchten.
»Wie war es in Berlin?«
»Sehr naß«, sagte ich, »und er kann die Rheinländer nicht leiden.«
»Ein in der Wolle gefärbter Berliner also?«
»Völlig.«
»Was trinken?«
»Nur einen Kaffee.«
Hilde, eine unserer Kellnerinnen während der Cocktailzeit, kam heran und bestellte für Herrn Maas und den Mann, den zu treffen er nach Bonn gekommen war, einen Steinhäger und eine Cola. Sie waren die einzigen Gäste im Lokal.
»Wer ist dein Freund?« fragte Padillo und nickte zu Maas hin. »Ein dicker kleiner Mann mit einer großen dicken Pistole. Sagt, er heißt Maas.«
»Für Pistolen habe ich nichts übrig«, sagte Padillo, »aber noch weniger für den Mann in seiner Gesellschaft.«
»Kennst du ihn?«
»Ich weiß nur, wer er ist. Hat irgendwas mit der jordanischen Botschaft zu tun.«
»Probleme?«
»Etwas in der Richtung.«
Karl schob mir meinen Kaffee hin.
»Haben Sie schon mal von einem seven-layer mint frappé gehört?« sagte er.
»Nur in New Orleans.«
»Vielleicht kommt die Puppe da her. Sie kommt zum Lunch und bestellt einen. Mike hat mir nie beigebracht, wie man seven-layer mint frappé macht.«
Karl war Kriegswaise und hatte sein Englisch überwiegend vor dem riesigen PX-Laden der Army in Frankfurt aufgeschnappt. Dort hatte er sich, gerade etwas über zehn Jahre alt, seinen Lebensunterhalt dürftig durch den Handel mit Zigaretten verdient, die er amerikanischen Soldaten abluchste und auf dem schwarzen Markt verkaufte. Er war ein guter Barmann und sprach Amerikanisch ohne jeden deutschen Akzent.
Er kam nicht dazu, mehr zu sagen. Padillo packte mich an der linken Schulter, schlug mir die Beine unterm Körper weg und warf mich zu Boden. Ich drehte mich im Fallen und erwischte einen flüchtigen Blick auf das Paar. Sie hatten die Gesichter mit weißen Taschentüchern verdeckt und liefen zu dem Tisch, an dem Maas und sein Freund saßen. Sie feuerten vier Schüsse ab. Ihr Knall tat mir in den Stirnhöhlen weh. Padillo hatte sich auf mich fallen lassen. Wir richteten uns noch rechtzeitig auf, um Herrn Maas durch die Tür hinausrennen zu sehen. Seine schäbige Aktentasche schlug ihm dabei gegen ein fettes Bein. Hilde, die Kellnerin, stand erstarrt in einer Ecke, ein Tablett wie vergessen in der Hand. Dann schrie sie gellend, und Padillo befahl Karl, zu ihr zu gehen und sie zum Schweigen zu bringen. Karl, bleich unter der Höhensonnenbräune, kam schnell hinter der Bar hervor und begann auf das Mädchen in Tönen einzureden, die besänftigend sein sollten. Sie schienen sie noch mehr zu verstören, aber immerhin hörte sie auf zu schreien.
Padillo und ich gingen zu dem Tisch, an dem Maas und sein weiland Freund gesessen hatten. Der Freund lag ausgestreckt im Sessel, seine Augen blickten starr zur Decke, sein Mund stand etwas offen. Es war zu dunkel, um Blut erkennen zu können. Er war ein kleiner dunkler Mann gewesen, mit glattem schwarzen Haar, das er ohne Scheitel zurückgekämmt getragen hatte. Seine Gesichtszüge waren scharf, mit Hakennase und fliehendem Kinn, das eine Rasur nötig gehabt hätte. Seine Bewegungen mochten flink, seine Redeweise lebhaft gewesen sein. Jetzt war er nur tot – nichts als eine Leiche, die uns vor Probleme stellte.
Padillo sah ihn ausdruckslos an. »Wahrscheinlich werden sie vier Geschosse im Herzen finden, je zwei in einem Zoll Abstand. Anscheinend waren es Profis.«
Ich konnte noch das Kordit riechen. »Soll ich die Polizei rufen?«
Padillo sah mich zerstreut an und nagte an seiner Unterlippe. »Ich war nicht hier, Mac«, sagte er. »Ich war in Bonn auf ein Bier. Oder auf dem Petersberg, die Opposition beobachten. Eben einfach nicht hier. Es würde ihnen nicht sehr passen, daß ich hiergewesen bin, und ich muß heute abend ein Flugzeug erwischen.«
»Mit Hilde und Karl bringe ich das in Ordnung. Das Küchenpersonal hat noch Mittagspause, nicht wahr?«
Padillo nickte. »Wir haben noch Zeit, schnell einen auf den Weg zu nehmen, ehe du anrufst.« Wir gingen zur Bar zurück, und Padillo trat hinter die Theke, griff nach der Haig-Flasche mit den Einbuchtungen und goß zwei kräftige Drinks ein. Karl stand noch in der Ecke bei Hilde und redete besänftigend auf sie ein. Ich bemerkte, daß seine Hände die richtigen Stellen tätschelten.
»Wenn ich das Flugzeug heute abend kriege, sollte ich in zehn Tagen zurück sein, vielleicht in zwei Wochen.«
»Warum sagst du ihnen nicht, du hättest dir eine schwere Erkältung zugezogen?«
Padillo trank einen Schluck und lächelte. »Ich bin nicht besonders scharf auf diese Reise. Es geht diesmal um mehr als um reine Routine.«
»Sollte ich sonst noch etwas wissen?«
Er blickte drein, als wollte er etwas sagen; dann hob er die Schultern. »Nein, nichts. Halte mich nur da raus. Gib mir zwei Minuten und ruf dann die Polizei. Okay?«
Er leerte sein Glas und kam hinter der Bar hervor.
»Viel Spaß«, sagte ich.
»Danke, gleichfalls.«
Wir gaben uns nicht die Hand. Wir taten es nie. Ich sah, wie Padillo hinausging. Er schien sich nicht mehr so schnell zu bewegen wie früher; er schien sich auch ein bißchen weniger aufrecht zu halten.
Ich leerte mein Glas, ging dann in die Ecke und half Karl, Hilde zu beruhigen, und klärte mit beiden, daß Padillo nicht dagewesen war, als der kleine dunkle Mann seine letzte Cola trank. Dann ging ich zur Bar zurück, griff nach dem Telefon und rief die Polizei an.
Danach setzte ich mich an die Bar und dachte über Padillo nach und wohin er diesmal reisen mochte. Dann dachte ich an Herrn Maas und seinen schlanken dunklen Freund und an das maskierte Paar, das hereingekommen war und seinem Leben ein Ende gemacht hatte. Als die Polizei eintraf, stellte ich mir Fragen über mich selbst, und ich war froh, daß sie kamen, weil ich jetzt über etwas anderes lügen konnte.
Sie kamen in großem Stil: Ihre Sirene kündigte volle zwei Minuten im voraus ihre Ankunft an – für einen geübten Einbrecher reichlich Zeit, über die Hintertreppe und durch eine Seitengasse zu verschwinden. Zwei gestiefelte, grünuniformierte Polizisten stürmten herein und blinzelten in die Dunkelheit. Nummer eins stelzte zur Bar herüber und fragte, ob ich der brave Bürger sei, der angerufen hatte. Als ich bejahte, drehte er sich um und verkündete diese Tatsache stolz der Nummer zwei und den beiden in Zivil, die mit ihnen gekommen waren. Der eine Nichtuniformierte nickte mir zu, und dann gingen alle zu dem Toten, um ihn anzusehen.
Ich blickte auf meine Uhr. Seit der kleine dunkle Mann erschossen worden war, waren siebzehn Minuten vergangen. Während die Polizisten die Leiche betrachteten, um Hinweise oder was auch immer zu finden, rauchte ich eine Zigarette. Karl stand inzwischen wieder hinter der Bar, und Hilde befand sich in der Nähe der Tür und zerknitterte ihre Schürze.
»Haben Sie das mit Hilde geklärt?«
Karl nickte. »Sie hat ihn den ganzen Tag nicht gesehen.« Einer der beiden in Zivil löste sich aus der Gruppe, die um den Toten herumstand, und kam zur Bar.
»Sind Sie Herr McCorkle?« fragte er und gab meinem Namen einen hübschen gutturalen Klang.
»Ja. Ich habe gleich angerufen, als es passierte.«
»Ich bin Inspektor Wentzel.«
Wir schüttelten uns die Hand. Ich fragte ihn, ob er etwas trinken wolle. Er sagte, einen Kognak würde er nehmen. Wir warteten, während Karl einschenkte, sagten Prosit, und er trank. Dann kam er zur Sache.
»Haben Sie es gesehen?« fragte Wentzel.
»Zum Teil, nicht alles.«
Er nickte. Der Blick seiner blauen Augen war offen und fest, sein Mund eine dünne gerade Linie, die weder Mitgefühl noch Argwohn verriet. Er hätte nach einer eingedrückten Stoßstange fragen können.
»Würden Sie mir bitte den Vorgang genau so schildern, wie Sie sich daran erinnern? Lassen Sie nichts aus, egal wie nebensächlich.«
Ich erzählte ihm, was sich seit meinem Abflug von Berlin ereignet hatte, und überging nur Padillos Anwesenheit, was vermutlich alles andere als nebensächlich war. Während ich sprach, trafen die Kriminaltechniker ein, machten Aufnahmen, suchten Fingerabdrücke, untersuchten die Leiche, legten sie auf eine Bahre, breiteten eine Decke über sie und schafften sie dorthin, wo Tote hingebracht werden. Vermutlich ins Leichenschauhaus.
Wentzel hörte mir aufmerksam zu, machte sich aber keine Notizen. Wahrscheinlich hatte er ein gutes Gedächtnis. Er drängte mich weder, noch stellte er Fragen. Er hörte einfach nur zu und schaute gelegentlich auf seine Fingernägel. Sie waren sauber wie auch sein Hemd, dessen breitgeschnittener Kragen durch eine in doppeltem Windsorknoten geknüpfte braunschwarze Krawatte zusammengehalten wurde. Sie paßte nicht besonders gut zu seinem dunkelblauen Anzug. Er hatte sich irgendwann im Verlauf des Tages rasiert und roch leicht nach Rasierwasser.
Schließlich hatte ich alles gesagt, aber er lauschte weiter. Die Stille wuchs, und ich widerstand der Versuchung, hier und da noch ein paar kleine Ausschmückungen hinzuzufügen. Ich bot ihm eine Zigarette an, die er akzeptierte.
»Also dieser Maas ...«
»Ja?«
»Hatten Sie ihn schon einmal gesehen?«
»Noch nie.«
»Aber es ist ihm gelungen, Sie in der Maschine von Tempelhof kennenzulernen, sich mit Ihnen anzufreunden, sich die Fahrt mit Ihnen nach Godesberg zu sichern – sogar zu genau demselben Bestimmungsort –, und hier haben Sie gesehen, wie er aus Ihrem Lokal hinauslief, nachdem sein Bekannter erschossen worden ist. Ist das so richtig?«
»Ja, das stimmt.«
»Natürlich«, murmelte Wentzel, »natürlich. Aber finden Sie nicht, Herr McCorkle, finden Sie nicht auch, daß es ein seltsamer Zufall ist – ein wirklich verblüffender Zufall –, daß dieser Mann sich neben Sie setzt, daß Sie ihm anbieten, ihn mitzunehmen, daß er in Ihr Lokal geht, um sich dort mit einem Mann zu treffen, der dann erschossen wird?«
»So kommt es mir auch vor«, sagte ich.
»Ihr Partner, Herr Padillo, war nicht hier?«
»Nein; er ist geschäftlich verreist.«
»Aha. Falls dieser Maas versucht, sich mit Ihnen irgendwie in Verbindung zu setzen, werden Sie uns bitte sofort benachrichtigen?«
»Sie erfahren es als erster.«
»Und wäre es Ihnen möglich, morgen in unsere Dienststelle zu kommen und Ihre Aussage zu unterschreiben? Ihre Angestellten müßten ebenfalls kommen. Wollen wir sagen, um elf Uhr?«
»Gut. Sonst noch etwas?«
Er musterte mich gründlich. Noch in zehn Jahren würde er sich an mein Gesicht erinnern.
»Nein«, sagte er. »Im Augenblick nicht.«
Ich bot den drei anderen ebenfalls etwas zu trinken an. Sie schauten zu Wentzel, und der nickte. Sie baten um Kognak und kippten ihn herunter. Es spielte keine Rolle, Karl hatte ihnen nicht den besten eingeschenkt. Wir schüttelten uns ringsum die Hand, und Wentzel marschierte hinaus in den Nachmittag. Ich starrte auf den Tisch in der Ecke, wo Maas und sein Freund gesessen hatten. Jetzt war dort nichts. Nur ein paar Tische und Sessel, die beinahe einladend aussahen.
Ich verdiente auch eine Menge Geld und konnte mich wahrscheinlich mit fünfundvierzig zur Ruhe setzen. Die Tatsache, daß mein Partner Spion für Wichtigtuer war, die durch die Welt schwirrten und in Gott weiß welchen Winkeln die Konstruktionspläne für das nächste russische Raumschiff zum Saturn suchten, war nebensächlich – sogar unwichtig. Und die Tatsache, daß mein Lokal in Wirklichkeit unser Lokal war – das des Spions und meines – und die Tatsache, daß sie es nach allem, was ich wußte, als internationale Nachrichtenbörse benutzten, wo die Geheimcodes in Cocktailzwiebeln versteckt waren –, das alles würde in den guten künftigen Zeiten nur als Plauderthema über langen, gutgekühlten Drinks dienen.