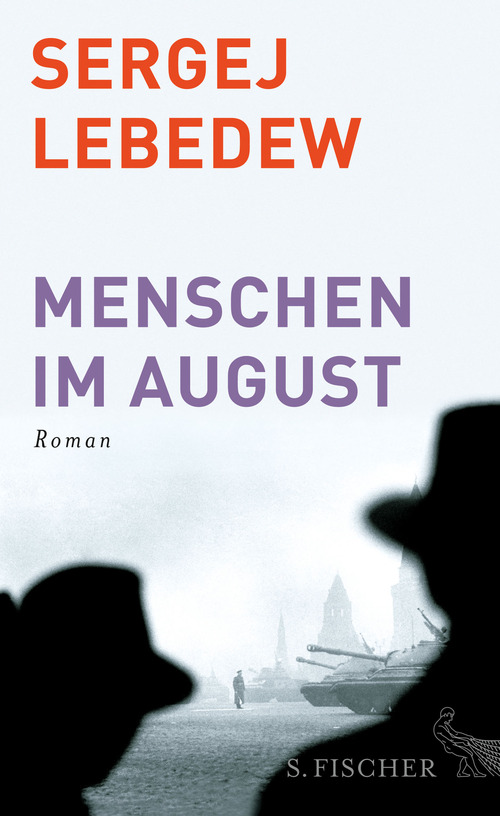
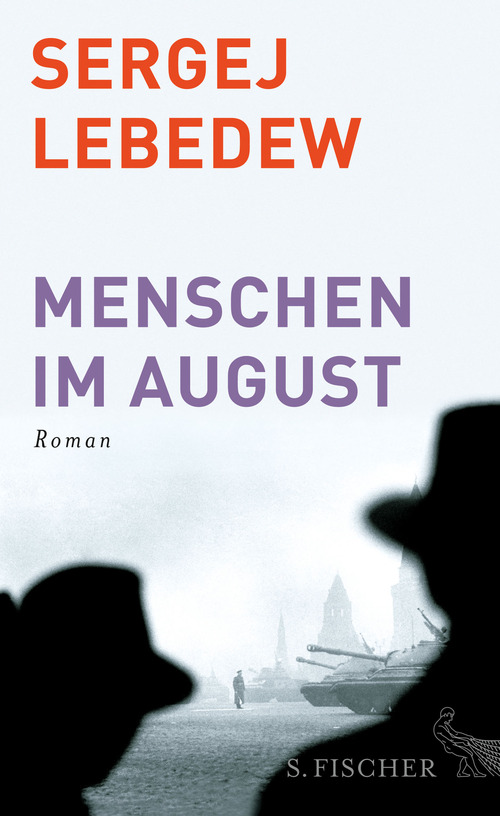
Sergej Lebedew
Menschen im August
Roman
Aus dem Russischen von Franziska Zwerg
FISCHER E-Books

Sergej Lebedews Zeitung, für die er in den letzten Jahren schrieb, wurde während des Ukrainekonflikts verboten. Als Schriftsteller und Journalist sieht der 1981 in Moskau geborene Lebedew in Russland für sich keine Zukunft mehr. Noch in diesem Jahr möchte er auswandern. Auch wenn sein erster Roman ›Der Himmel auf ihren Schultern‹ 2011 auf der Longlist des russischen »Nazbest«-Preises (Nationaler Bestseller) stand.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Erschienen bei FISCHER E-Books
Der Originaltitel heißt ›ЛЮди aвгустa‹
© Sergej Lebedew
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: © Elliott Erwitt/plainpicture/Magnum - the plainpicture edit
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402029-7
Wlassow-Anhänger – Mitglieder militärischer Gruppen von ehemaligen sowjetischen und anderen Bürgern, die auf der Seite Deutschlands gegen die UDSSR kämpften. Bezeichnet nach dem Namen von Generalleutnant Andrej Wlassow, der 1942 in Gefangenschaft geriet und zu den Deutschen wechselte. Später führte er die Russische Befreiungsarmee ROA an, wichtigste Streitkraft der Kollaborateure. Die Anführer wurden später hingerichtet, die Mehrheit der Soldaten verbannt.
Schlacht auf dem Kulikowo Pole – Gefecht zwischen dem vereinigten russischen Heer unter Kommando des Großfürsten von Moskau Dmitri und dem Heer des Emirs der Goldenen Horde Mamai, das am 8. September 1380 auf dem Kulikowo Pole (Schnepfenfeld) ausgetragen wurde. Historisch gilt sie als Beginn der Befreiung des russischen Bodens von der Macht der Goldenen Horde.
Michail Tuchatschewski (1893–1937) – sowjetischer Heerführer. Während des Bürgerkriegs leitete er insbesondere die Niederschlagung der antibolschewistischen Aufstände in Kronstadt und Tambow. 1937 wurde er im Rang eines Marschalls der Sowjetunion der Zusammenarbeit mit der deutschen Spionage beschuldigt und erschossen. Rehabilitiert 1957.
Schlacht von Schipka – ein Ereignis des Russisch-Osmanischen Kriegs 1877–78. Die russischen Truppen verteidigten den Schipkapass im heutigen Bulgarien, die türkische Armee wollte ihn erobern. Die Kämpfe fanden im Gebirge statt, die Truppen erlitten größere Verluste durch die Wetterbedingungen als unmittelbar durch die Kampfhandlungen.
Alexander Koltschak (1874–1920) – Admiral der russischen Marine, Politiker, Wissenschaftler. Während des Bürgerkriegs einer der Anführer der Weißen Bewegung, 1918–1920 Oberster Regent Russlands, wurde von den Bolschewiki erschossen.
Pjotr Wrangel (1878–1928) – russischer Feldherr, einer der Anführer der Weißen Bewegung, Oberbefehlshaber der sogenannten Russischen Armee auf der Krim. Zog nach der Niederlage gegen die Rote Armee seine verbliebenen Truppenteile sowie Flüchtlinge von der Krim nach Konstantinopel ab, starb in Brüssel.
Bauernaufstand von Tambow – einer der größten Aufstände gegen die Bolschewiki im Bürgerkrieg, ereignete sich 1920–1921 im Gebiet des Gouvernements Tambow. Benannt nach Alexander Antonow, einem der Anführer des Aufstands und Mitglied der Partei der Sozialrevolutionäre. Grund des Aufstands war die Zwangsrequirierung von Lebensmitteln durch die Bolschewiki. Schätzungsweise beteiligten sich maximal 50000 Menschen. Niedergeschlagen wurde der Aufstand von Truppen unter dem Kommando von Michail Tuchatschewski.
»Grüne« – allgemeine Bezeichnung für bewaffnete Formationen, die in der Zeit des Bürgerkriegs in Russland weder zu den Roten (Bolschewiki) noch zu den Weißgardisten gehörten. Der Begriff wurde vornehmlich für Banditen gebraucht, die gegen alle kämpften.
WeTscheKa – Allrussische Außerordentliche Kommission zum Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage. Wurde 1917 unter der Leitung von Feliks Dzierżyński gebildet. Mit dem Beginn des Bürgerkriegs erhielt sie Sondervollmachten und gehörte zu den wesentlichen Instrumenten des sowjetischen Staatsterrors. Später wurde sie mehrfach umformiert und umbenannt (1923 OGPU – Vereinigte Staatliche Politische Verwaltung, 1934 NKWD – Volkskommissariat des Inneren, später MGB – Ministerium für Staatssicherheit und KGB – Komitee für Staatssicherheit).
TSCHON – Sondertruppen, speziell militarisierte Formationen der bolschewistischen Partei mit Aufgaben im Wachschutz, für Bestrafungsaktionen und militärische Einsätze. Gegründet 1919, aufgelöst 1925, zeichnete sich durch besondere Grausamkeit aus.
»Im Reich der Tiere« – populärwissenschaftliche Sendung des sowjetischen und später russischen Fernsehens. Ihre musikalische Introduktion, gespielt vom Orchester Paul Mauriat, war einer der bekanntesten musikalischen Codes der sowjetischen Kultur.
Jewgeni Onegin – Dieses und die folgenden Zitate aus »Jewgeni Onegin« stammen aus der Ausgabe: Alexander Puschkin. Jewgeni Onegin. Aus dem Russischen von Rolf-Dietrich Keil. Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig, 1999. Anm. d. Ü.
»Erschießung des Weißen Hauses« – volkstümliche Bezeichnung für den Konflikt zwischen Anhängern Präsident Jelzins und Vertretern des Obersten Sowjets, der sich im September und Oktober 1993 in Moskau ereignete. Die bewaffnete Phase des Konflikts endete mit dem Sturm der Residenz des Obersten Sowjets, an dem Armee-Einheiten und Panzer beteiligt waren. Politisches Ergebnis des Konflikts war die Abschaffung des Vizepräsidentenpostens und die Übertragung von Machtbefugnissen des Parlaments auf den Präsidenten.
Alexej Surkow (1899–1983) – sowjetischer Lyriker, zweifacher Stalinpreisträger, erster Sekretär des Sowjetischen Schriftstellerverbands von 1953 bis 1959. Autor von Texten beliebter militärisch-patriotischer Lieder.
Konstantin Simonow (1915–1979) – sowjetischer Lyriker und Schriftsteller, Leninpreisträger und sechsfacher Stalinpreisträger. Autor populärer Kriegslyrik.
NKWD – Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten der UDSSR, gegründet 1934. Zu seinen Aufgaben gehörten politische Fahndungen, Strafvollzug, Außenaufklärung, Grenzbewachung und Spionageabwehr innerhalb der Armee. Das NKWD durfte außergerichtliche Urteile verhängen. Außerdem baute es große Industrieobjekte und besaß industrielle Unternehmen, war faktisch ein Staat im Staat. In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre übte das NKWD massenhaft Repressionen gegen die Bevölkerung der UDSSR aus, die unter dem Namen »Großer Terror« in die Geschichte eingingen.
Das 8. Mechanisierte Korps der Roten Armee war eine Militäreinheit innerhalb der 26. Armee des Kiewer Militärsonderbezirks. Das Korps trat am 22. Juni 1941 in den Kampf gegen die deutschen Truppen ein. Bereits zum 30. Juni hatte sich das Korps in einige Gruppen aufgespalten, die in der Umzingelung ohne Kontakt zueinander kämpften. Im Verlauf der Kampfhandlungen und bei der Durchbrechung der Umzingelung erlitt das Korps schwere Verluste, mehr als 5000 Menschen galten als vermisst. In der Folge wurde das Korps aufgelöst.
Bürgerwehr – militärische Einheiten (Divisionen), die im Sommer 1941 auf Grundlage einer »freiwilligen Beteiligung« aus Personen zusammengestellt wurden, die nicht der gesetzlichen Wehrpflicht unterstanden. Schlecht ausgebildet und bewaffnet wurden diese Einheiten im Herbst 1941 Teil der regulären Armee und erlitten schwere Verluste bei der Schlacht um Moskau.
Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Goldabbau – eine in Wirklichkeit nicht existierende Institution, deren Name während des Zweiten Weltkriegs als Tarnung des sowjetischen militärischen Nachrichtendienstes diente.
Lend-Lease Act – staatliches Programm, mit dem die USA ihre Verbündeten im Zweiten Weltkrieg mit Munition, Technik, Lebensmitteln und Rohstoffen ausrüsteten.
»Eingekesselter« – Jargonausdruck für Militärpersonen der Roten Armee, die in deutsche Einkesselung geraten waren und sich daraus befreien konnten, was negative Folgen haben konnte: Häufig sahen die Behörden Eingekesselte als Verbrecher. Ein »Einkesselungsvermerk« in der Personalakte konnte eine Karriere zum Stillstand bringen oder als erschwerender Umstand gelten.
Die »Filtration« der Eingekesselten wurde vom NKWD durchgeführt, dabei wurden die Gesetze missachtet: Man sah in ihnen entweder Spione oder Deserteure, die sie »entlarvten« und zu Falschaussagen zwangen.
Polnische Aktion des NKWD – eine Serie von Verhaftungen von Personen polnischer Nationalität, die nach Erlass des NKWD-Befehls Nr. 00485 vom 11. August 1937 begann und die Staatssicherheitsorgane beauftragte, einen in der UDSSR ansässigen Agentenring der erfundenen Polnischen Militärorganisation (POW) zu verhaften. Insgesamt wurden mehr als 36000 Menschen inhaftiert und verurteilt.
Stepan Bandera (1909–1959) – einer der Anführer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), der für die Schaffung eines unabhängigen ukrainischen Staates eintrat. 1941, nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, versuchte er, zusammen mit anderen Anhängern der Nationalbewegung die Unabhängigkeit der Ukraine auszurufen, woraufhin er verhaftet wurde und sich bis 1944 im Konzentrationslager Sachsenhausen befand. Später lebte er in Westdeutschland und wurde 1959 in München von einem KGB-Agenten getötet. In der sowjetischen Geschichtsschreibung war Banderas Name traditionell ein Synonym für einen hinterlistigen Feind und Verräter.
SMERSCH – Abkürzung für »Tod den Spionen!«, ein 1943 nach der Verwaltungsreform entstandener militärischer Nachrichtendienst der UDSSR mit Abteilungen in Armee, Flotte und NKWD.
FSK – Föderaler Dienst für Gegenaufklärung Russlands, gegründet 1993 nach Abschaffung des Ministeriums für Staatssicherheit Russlands, wurde 1995 in den Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) umstrukturiert. Befand sich im ehemaligen sowjetischen KGB-Gebäude auf der Lubjanka und erfüllte faktisch dessen Funktionen.
Basmatschen, von türkisch »bosmoq« – angreifen, ausrauben – Sammelbegriff für Aufständische militärischer Partisaneneinheiten, die in Zentralasien nach der Einsetzung der Macht der Bolschewiki entstanden. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, gegen die Sowjetmacht, den Wandel der islamischen Lebensweise und der Zwangskollektivierung Widerstand zu leisten. Die Basmatschen wurden mit unterschiedlicher Intensität in den zwanziger und dreißiger Jahren bekämpft.
Baikonur – größtes Kosmodrom der UDSSR und der Welt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion blieb der Status des Kosmodroms von 1991 bis 1993 ungeklärt, was zu Schwierigkeiten bei der technischen Nutzung und der Versorgung des Komplexes führte: Es gab Unregelmäßigkeiten bei der Energieversorgung, im Winter sank die Temperatur in einigen Wohnräumen unter null Grad. Baikonur wird seit 1994 von Russland gepachtet.
Aufstand von Karaganda – nicht genehmigter Studentenprotest in Karaganda im Dezember 1986 als Folge der Ereignisse in Alma-Ata, der Hauptstadt der Kasachischen Sowjetrepublik, wo es Massenproteste von Jugendlichen mit Forderungen nach Selbstbestimmung der kasachischen Nation gegeben hatte, die mit dem Sturm des Gebäudes des ZK der Kommunistischen Partei von Kasachstan endeten.
In Karaganda protestierten Schätzungen zufolge 150–200 Menschen. Viele wurden später verhaftet und exmatrikuliert.
Faktisch waren die Ereignisse in Kasachstan der erste öffentliche Protest in der UdSSR, bei dem die Autonomie einer Sowjetrepublik gefordert wurde.
OUN – Organisation Ukrainischer Nationalisten. Während des Zweiten Weltkriegs und danach führten verschiedene Strömungen der OUN einen bewaffneten Kampf gegen die Sowjetmacht und ihre Truppen.
»Weiße Sonne der Wüste« (1970) – sowjetischer Kinofilm, der vom Kampf der Rotarmisten gegen die Basmatschen in den letzten Jahren des Bürgerkriegs erzählt. Kultfilm sowohl in der UDSSR als auch für Russland, in den Sprachgebrauch wurden viele Ausdrücke und Sätze übernommen. Der Film handelt von der Rettung der Haremsfrauen des Basmatschen Abdullah durch den Rotarmisten Fjodor Suchow.
Mussa Dschalil (1906–1944) – sowjetischer Lyriker tatarischer Abstammung. Geriet 1942 in deutsche Kriegsgefangenschaft, trat der von Deutschen geschaffenen Legion Idel-Ural bei und gründete dort eine geheime Untergrundgruppe. Dafür wurde er verhaftet und 1944 in das Berliner Gefängnis Moabit gebracht. Nach dem Krieg galt er in der UDSSR als Verräter. In den fünfziger Jahren ließ man die Anschuldigungen gegen Dschalil fallen, und durch Bemühungen von Konstantin Simonow wurde Dschalil zu einem Symbol des Untergrundkampfes. Nach Mussa Dschalil benannte man Straßen in vielen sowjetischen Städten.
»Weißes Haus« – inoffizielle Bezeichnung für das Gebäude des Parteikomitees der Tschetscheno-Inguschischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik, später Präsidentenpalast von Dschochar Dudajew. Das Gebäude hatte architektonische Ähnlichkeit mit dem Weißen Haus in Moskau, dem Regierungsgebäude der Russischen Föderation. Während des Ersten Tschetschenienkriegs wurden erbitterte Kämpfe um das Gebäude geführt, es wurde teilweise zerstört und dann abgetragen.
Friedensvertrag von Chasawjurt – gemeinsame Erklärung offizieller Vertreter Russlands und der Tschetschenischen Republik. Sah den Abzug der russischen Truppen von tschetschenischem Territorium und die Verschiebung einer Entscheidung zum Status von Tschetschenien auf das Jahr 2001 vor. Das Datum der Unterzeichnung des Friedensvertrags gilt als offizielles Ende des Ersten Tschetschenienkriegs.
Chankala – Siedlung und Militärflughafen in einem Vorort von Grosny, Tschetschenien. Während des Zweiten Tschetschenienkriegs befand sich in Chankala der Hauptmilitärstützpunkt der russischen Truppen.
Lied – Den Text dieses in Dissidentenkreisen beliebten Liedes schrieb Ende der 1960er Jahre Nikolaj Williams (1926–2006), ein Mathematiker, der 1977 aus der Sowjetunion ausgebürgert wurde, in die USA emigrierte und 1993 nach Russland zurückkehrte. Anm. d. Ü.
FSB – Föderaler Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation, gebildet 1995 als Nachfolger des Komitees für Staatssicherheit der UDSSR (KGB). Untergebracht im ehemaligen KGB-Gebäude auf dem Lubjanka-Platz (der Name »Lubjanka« wurde in der UDSSR und in Russland zum Begriff für die Maschinerie des Staatsterrors). Bis zu seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten Russlands war Wladimir Putin Leiter des Inlandsgeheimdiensts FSB.
Seeschlacht bei Tsushima – Gefecht zwischen russischen und japanischen Geschwadern während des Russisch-Japanischen Kriegs 1904–1905. Die Schlacht endete mit der vernichtenden Niederlage der russischen Einheiten. Eine entscheidende Rolle bei der Niederlage spielte die Tatsache, dass die japanische Flotte in heimischen Gewässern operierte und die russischen Schiffe hingegen einen mehrmonatigen Weg von den baltischen Stützpunkten über Afrika zurücklegen mussten – England hatte dem russischen Geschwader die Durchfahrt durch den Suezkanal verweigert.
Das Schicksal war uns auf den Fersen –
Ein Wahnsinniger – das Messer in der Hand.
Arseni Tarkowski
Oh, Buch der Zwietracht, Handschrift des Unglücks! Es wurde weiß Gott in guter Absicht, für ein hohes Ziel geschrieben: um die brüchigen Lebenslinien der Nachkommen zu richten, sie vom fatalen Familienerbe zu befreien und zu schützen vor den Fallen des Lebens, die in der Vergangenheit wurzeln.
Und um die Zukunft günstig zu stimmen, blieb ein Mensch von den Schilderungen ausgeschlossen und wurde nicht auf die Arche des Manuskripts gelassen; er blieb draußen, im Dunkeln – wie man denen Einlass verwehrt, die sich beschmutzt haben und andere beschmutzen können. Aber diese scheinbar richtige Entscheidung ließ das alte Fatum in einem neuen Samenkorn aufkeimen. Durch sie wurde das Buch zum Beginn eines teuflischen Spiels, das sich über Generationen und Epochen hinzog.
Aber ganz am Anfang dieses Wegs, im Herbst 1991, war das Buch ein großartiges Geschenk, eine ersehnte Begegnung; es schien genau zum richtigen Zeitpunkt aufzutauchen, ein Buch als Künder großer und kleiner Veränderungen, die sich im Land und mit den Menschen vollzogen.
Was waren das für Monate! Auf der Lubjanka, wo im August der Eiserne Feliks dumpf auf dem Asphalt aufschlug, herrschte das Gefühl vor, dass hier und jetzt ein neues Land entstand. Wir waren bereits ein Teil von ihm und mussten nur noch einige Anstrengungen aufbringen, um uns von unserem traurigen und düsteren Erbe zu lösen. Mit der Wahrheit über die Vergangenheit würden wir deren Fehler nicht wiederholen, und die Geschichte ginge einen neuen Weg.
Zum unauffälligen Helden dieser Zeit wurde für mich der Bergsteiger, der zum Denkmal für Feliks Dzierżyński hinaufstieg, um ihm ein Seil vom Arm des Krans umzuwerfen. Er kletterte hinauf, warf es, stieg hinunter – und war weg, verschwunden in der Menge, unerkennbar; einer von Hunderten, Tausenden und Abertausenden junger Menschen, der »Menschen im August«, wie ich uns damals nannte.
Das bronzene Götzenbild war gestürzt, die verlogene Vergangenheit verworfen. Und die wahre Vergangenheit lag in diesem Buch, einem Manuskript in braunem Leineneinband, dessen Heftrücken mit einem rauen, gewachsten Faden genäht war. Einem unerwarteten, unvermuteten Manuskript, das mir meine Großmutter Tanja in den letzten Augusttagen gab.
Als Kind wusste ich als Einziger in der Familie, dass sie einen Text schrieb, und ich ahnte, dass es ihre Memoiren waren. Aber so ging es Jahr um Jahr, manchmal konnte ich monatelang nicht beobachten, dass sie sich an den Tisch setzte und das Heft aufschlug. Ich hatte mich bereits an die Endlosigkeit ihrer Niederschrift gewöhnt und meinte, es sei ein innerer Dialog, der nicht für einen außenstehenden Leser bestimmt war. Dann, Ende der achtziger Jahre, erkrankte meine Großmutter, die Beschwerden wechselten einander ab, und für einige Jahre war das Heft mit ihrer Handschrift irgendwohin verschwunden. Verschwunden war es damit auch aus meinen Gedanken, ich vergaß es mit der leichtfertigen Eile eines Heranwachsenden, der die Tage verschlingt. An das Manuskript zu denken hätte bedeutet, eine trügerische und eigentlich unbegründete Hoffnung am Leben zu halten.
Eine Hoffnung? Ja.
Wenn ich darüber nachdachte, fühlte ich, dass das Heft meiner Großmutter in dem Leben, das ich lebte, etwas geradezu Verbotenes und Undenkbares darstellte. Ich verfügte nicht über geniale Geistesschärfe, empfand aber trotzdem – wie man eine Gefühlslage, eine Gestimmtheit empfindet –, dass ich mich auf dem unergründlichen Terrain des Verschweigens bewegte.
Bei einem Kind gibt es die ursprüngliche Gewissheit, dass Erwachsene gleichwie ein anständiges Leben führen. Ja, sie erzählen dem Kind nicht viel, denn dafür ist es »noch zu klein«, und zu den Geheimnissen der Erwachsenen vorzudringen gehört zu den aufregendsten Beschäftigungen in der Kindheit. Aber wie kann ein Kind ahnen, dass es eine Menge von Dingen gibt, die generell aus dem Bereich des Aussprechbaren entfernt wurden, dass es eine Sprache gibt, in der geschwiegen wird?
Ohne die Zusammenhänge zu sehen, fallen einem Kind nur Merkwürdigkeiten auf, unvermittelte Pausen in einem Gespräch, und es fühlt, wie seine Nächsten auf einmal zu Fremden werden, die irgendetwas streng zu bewachen scheinen. In den dreißiger und vierziger Jahren sorgte ein Maulkorb für das Schweigen; Anfang der achtziger Jahre war der Maulkorb weg, doch man war an ihn gewöhnt, er war bereits mit der Persönlichkeit verwachsen und scheinbar genuiner Teil des Menschen. So wird Schweigen zur Schweigsamkeit, wird eine Erscheinung zur Eigenschaft, und nie würde man diese vermeintliche Eigenschaft mit den wahren, aber unbekannten Gründen ihrer Entstehung in Verbindung bringen.
Großmutter Tanja war sozusagen eine Adeptin dieser Schweigensreligion. Anderen Menschen waren zumindest ein Rest des Unausgesprochenen und die Last des Ungesagten anzumerken, die ihnen auf der Seele lagen; bei Tischgesprächen brachen Wörter aus ihnen heraus, die unverständlich waren und sich vor sich selbst zu fürchten schienen. Großmutter Tanja hatte diesen Fluss der Wörter in sich abgeschnitten wie ein Mönch im höchsten Grad der Entsagung; ihr Schweigen war ein innerliches.
Meine Eltern hatten eine eigene, absolut überzeugende Erklärung dafür, warum Großmutter Tanja sich nicht gern an die Vergangenheit erinnerte oder von ihr sprach; diese Erklärung bestand aus zwei Teilen.
Erstens hatte sie als Redakteurin bei »Politisdat« gearbeitet, einem Parteiverlag für politische Literatur. Und auch wenn ihr Lektorat rein technischer und nicht ideologischer Natur gewesen war, gingen meine Eltern davon aus (was wahrscheinlich teilweise zutraf), dass Großmutter Tanja an die strenge Disziplin in den Abteilungen, Fluren und Zimmern von »Politisdat« gewöhnt war, wo man die offizielle Vergangenheit gewissermaßen produzierte – also niederschrieb, leicht retuschierte und für gültig erklärte. Zweitens gab es ein Familiengeheimnis, das so kunstvoll präsentiert wurde, dass es nicht wie ein Geheimnis wirkte. Mein im Krieg geborener Vater war ohne Vater aufgewachsen; er hatte ihn nicht gekannt, so wenig wie ich meinen Großvater. Über ihn wurde nie gesprochen, es fehlte an jeglichen Beweisen seiner Existenz; selbst der Vatersname meines Vaters – Michajlowitsch – schien willkürlich gewählt und hatte hinsichtlich einer Verwandtschaftslinie nichts zu bedeuten. Anstelle des Menschen war wie bei einem amputierten Bein eine auffällige, selbstredende Leere geblieben, die keine Fragen aufwerfen konnte; als komme es eben vor, dass Kinder aus dem Nichts geboren werden, durch die Umstände, ohne Beteiligung eines Mannes.
Parallel dazu und in absolutem Gegensatz zu dieser Leere existierte eine Legende, eine Geschichte, die sich Großmutter Tanja wahrscheinlich für meinen noch nicht erwachsenen Vater ausgedacht hatte. Nach dieser Legende war Großvater Michail Funker gewesen, hatte meine Großmutter noch vor dem Krieg auf einer Sportlerparade kennengelernt, sie hatten sich ineinander verliebt und wollten heiraten, aber dann begann der Krieg, und Großvater Michail geriet mit einer Gruppe von Kundschaftern weit hinter die deutsche Front, fast nach Deutschland selbst. Vielleicht war er dort gefallen, vielleicht lebte er auch noch, vielleicht war er immer noch in Deutschland hinter dem »Eisernen Vorhang« und sandte geheime Depeschen. Meine Großmutter hatte diese Figur für ihren Sohn geschaffen, dessen Altersgenossen auf ihre heldenhaften Väter, ob tot oder lebendig, stolz waren. Sie hatte ihn eingeladen zu einem Spiel der Phantasie, und er hatte dieses Spiel selbstverständlich angenommen.
Von da an führte dieses Phantom in unserer Familie ein Eigenleben; alle wussten zwar, dass es sich bei dieser Legende um eine Lüge handelte, weil es aber eine wohlmeinende Lüge war, nahm man sie durch die ständigen Wiederholungen und aus Gewohnheit an, als sei es die Wahrheit.
Auch ich glaubte bis ins Jugendalter an diese Legende; ich weiß nicht einmal mehr, wer sie mir erzählte. Mit elf oder zwölf Jahren wurde mir klar, dass die Geschichte vom Spionage-Funker ein gutgemeinter Betrug war. Aber erstaunlicherweise zerstörte meine Entdeckung die Legende nicht; es füllte immerhin die Leere aus und bot einen gewissen Hinweis auf die reale Existenz meines Großvaters. Ich war fasziniert, wie langsam und konsequent sich eine Schwindelei mit der Realität verwob, die dann für meine Kinder, sollten sie geboren werden, zu einer wahrheitsgetreuen Überlieferung werden würde.
Meine Eltern schienen zu meinen, hinter dem Schweigen meiner Großmutter über Großvater Michail verberge sich eine persönliche Tragödie; er sei nicht einfach nur an die Front gegangen, gefallen oder vermisst; nein, wahrscheinlich hatte er sie und das Kind sitzenlassen, war zu einer anderen Frau gegangen, hatte sich als ehrlos erwiesen; vielleicht hatte der Krieg seine Feigheit offenbart, er war vom Schlachtfeld geflohen, verurteilt und erschossen worden.
Bemerkenswerterweise äußerte nie jemand die Vermutung, Großvater Michail könne Kriegsgefangener oder Wlassow-Anhänger[1] gewesen sein, könne nach der Gefangenschaft in ein sibirisches Lager verbannt oder wegen Kritik an der Sowjetordnung verhaftet worden sein, wie zum Beispiel der Artillerie-Hauptmann Solschenizyn. Das wäre ein Historiendrama mit politischem Beigeschmack gewesen, und im Fall meiner Großmutter sah man in erster Linie eine private, man konnte sogar sagen – weibliche Tragödie (oder wollte sie sehen?); eine schöne, achtbare Frau war in vielerlei Hinsicht an den Falschen geraten.
Ein solcher Standpunkt lieferte unter anderem eine hervorragende Begründung, warum man Großmutter Tanja nicht nach Großvater Michail fragen sollte; als private Tragödie gehörte er ihr allein, es war eine Geschichte der verletzten Gefühle. Niemand fragte sie also, und mir kam es so vor, als ob diese Konstellation allen gelegen kam, schließlich fürchteten meine Eltern unterschwellig, das von Großmutter gehütete Geheimnis sei in Wirklichkeit gar nicht so privat; überhaupt gab es in der Vergangenheit so einiges, vor dem uns Großmutters Schweigen bewahrte.
An der Wand von Großmutters Zimmer hing eine Vielzahl alter Fotografien – mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter, die Geschwister meiner Großmutter, nahe und entfernte Verwandte; sie nahmen gleichsam ständig am Familienleben teil, beobachteten zum Beispiel meine kindlichen Späße auf Großmutters Sofa, sahen, wie ich Spielkarten vertauschte, wenn ich beim »Durak« schummelte, oder wie ich einen Trupp von Spielzeugsoldaten abkommandierte, der die deutschen Positionen hinter dem Hügel des Kopfkissens stürmen sollte.
Aber meine Großmutter erzählte mir nichts über sie. Deswegen war deren Anwesenheit nur imaginär. Die Fotografien, die so ausdrucksstark, so echt waren, versperrten und versiegelten in Wirklichkeit den Zugang zur Vergangenheit, als seien sie namenlose Schutzgeister über unserem Heim.
Im August 1991 meinte ich, Großmutters Manuskript stoße diese Tür zur Vergangenheit auf. Sie ließ das Heft einfach bei mir auf dem Tisch liegen, ohne ein Wort, ohne eine Notiz, wie etwas Selbstredendes, das der Gang der Ereignisse hervorgebracht hatte – gestern noch undenkbar, heute unvermeidlich. Dreihundert Seiten, beschrieben mit verschiedenen Stiften, verschiedenen Tinten, Seiten, die bereits angegilbt waren – die Niederschrift wurde vor sehr langer Zeit begonnen.
Noch nicht wissend, worüber Großmutter Tanja eigentlich geschrieben hatte, war ich schon sicher, das Dunkel der Vergangenheit würde verschwinden, sobald ich ihre Erinnerungen gelesen hätte. Ich würde alle und alles erkennen, würde neu geboren und ginge in ein neues Leben, das Buch selbst führe mich dorthin.
Auch ohne eine Erklärung meiner Großmutter wusste ich, dass das Buch mir gehört, für mich bestimmt war, und ich meinen Eltern wohl nicht davon erzählen sollte. Meine Großmutter hatte diese Botschaft nur mir zugedacht, die anderen hielt sie nicht für fähig, sich zu wandeln, deswegen hatte sie auch alles geheim gehalten. So gewaltig war das Gefühl des Besitzens, das Gefühl des Vollzugs, dass ich die Lektüre des Manuskripts von Tag zu Tag verschob und diese Zeit, ähnlich dem Vorgefühl der Liebe, auskostete; wahrscheinlich war das der erste Fehler in einer langen, langen Kette.
Eines Abends ging ich mit dem Manuskript auf den Balkon und dachte, ich würde an diesem Tag mit dem Lesen beginnen; dazu brauchte ich Wind, Blätterrascheln, Dämmerung, erste Sterne – als Vorspiel zur Lektüre. Ich bemerkte nicht, hörte nicht, wie mein Vater nach Hause kam, zu mir ins Zimmer trat und mich mit dem Manuskript in der Hand antraf.
Selbstverständlich fehlte es mir an Gleichmut oder Verschlagenheit zu sagen, es sei ein Schulheft. Auch wenn er sich nichts anmerken ließ, war mein Vater äußerst erstaunt und beleidigt – warum hatte Großmutter ihre Memoiren mir und nicht ihm, ihrem Sohn gegeben?
Er fragte mich, ob ich zu lesen begonnen hätte, und ich, ein ehrlicher Dummkopf, fühlte mich auf einmal unbegründet schuldig vor ihm und gestand – nein, ich habe noch nicht begonnen. Mein Vater bat, das Manuskript »anschauen« zu dürfen – und so gab ich es ihm und wusste in dem Moment, dass ich es ganz weggegeben hatte, dass mein Vater es lesen und nicht eher zurückgeben würde, bis er fertig war. Ich gebe zu, mir tat mein Vater leid, ich wollte nicht, dass es zwischen ihm und Großmutter zum Streit käme; zum Streit oder zur Entfremdung; und dafür opferte ich mein Recht der ersten Lektüre, auch wenn ich mir der Größe dieses Opfers bewusst war.
Man hätte meinen können, es machte keinen Unterschied, wer das Manuskript las und wann, warte einen Monat oder so lange, wie dein Vater braucht, und du bekommst das Manuskript zurück, was ändert dieser Monat, was ändert sich dadurch, dass du die Zeilen nicht als Erster, sondern als Zweiter siehst?
Und dennoch tat es mir leid, dass mein Vater die Handschrift abgefangen hatte, er schien nicht zu verstehen, wie wichtig sie für mich war, und dachte, ich sei nur von flüchtiger Neugier getrieben. Ich wiederum hatte nun keine Möglichkeit mehr, ihm meine Empfindungen zu erklären. Ich fühlte ein Dilemma, eine Irritation und bedauerte, dass ich nicht gefasst, schlau, listig gewesen war – konnte jedoch nichts rückgängig machen.
Mein Vater war nie ein schneller Leser gewesen, selbst wenn in einem Buch eine langweilige Passage auftauchte, die man hätte überspringen können, las er sie anscheinend mit doppelter Aufmerksamkeit, um seine Willenskraft und Ausdauer zu trainieren. Natürlich hatte ich erwartet, dass er diesmal den Text verschlingen würde, in einem Tag, in zweien, in einem Zug. Aber als wolle er meine Geduld prüfen, las er, umgeben von Enzyklopädien und Nachschlagewerken, nur etwa drei, vier Seiten am Tag. Dabei machte er sich umfangreiche Notizen, zeichnete irgendwelche Graphiken, Schemata und skizzierte einen Stammbaum.
Manches Mal wollte mein Vater mit Großmutter Tanja sprechen, etwas klären, sie nach Details fragen – denn schließlich, so meinte er, habe sie einiges ausgelassen.
Aber scheinbar hatte Großmutter Tanja tatsächlich alles aufgeschrieben; der Prozess des Schreibens war für sie eine Gedächtnisstütze gewesen. Und nach Beendigung der Niederschrift schien das Papier mehr zu wissen, als Großmutter erinnern konnte. Sie wurde krank und schwach, stand nur mit Mühe aus dem Bett auf, klagte über Kopfschmerzen; in kürzester Zeit, in buchstäblich zwei, drei Wochen vergaß sie alles, worüber sie geschrieben hatte, schien nicht einmal mehr von der Existenz eigener Memoiren zu wissen, auch wenn sie sich an zeitnahe Dinge und Ereignisse im häuslichen Kreis genau, wenn auch ein wenig tastend, erinnerte.
Ihre Existenz war wie in zwei Teile zerfallen, ein Mensch war zum Anhängsel eines Stapels beschriebener Blätter geworden. Auf der Waage des Daseins wogen Tinte und Papier schwerer als ein Menschenleib. Erstaunt schaute sie auf das Heft, das mein Vater ihr zeigte, und lächelte verlegen – als wisse sie selbst nicht, woher das alles kam, wie es entstanden war.
Meine Eltern holten Ärzte, diese verschrieben Tabletten, sprachen von den Hirngefäßen, nickten verständnisvoll – was soll man da machen, das Alter … Bei mir verstärkte sich das Gefühl, meine Großmutter habe der Krankheit selbst den Weg geebnet, sich aus dem Leben zurückgezogen. Etwas ging mit ihr vor, das nichts mit einer Erkrankung zu tun hatte.
Ich verbrachte deutlich mehr Zeit zu Hause als meine Eltern, mir oblag die Fürsorgepflicht für Großmutter Tanja. Abends und morgens, wenn wir zu viert in der Wohnung waren, benahm sich meine Großmutter wie immer, so wie früher, wie in der gesamten Zeit, in der ich sie kannte. Aber wenn meine Eltern das Haus verließen und meine Großmutter mich zeitweise aus ihrem Blickfeld verlor, vergaß sie, missachtete sie, dass noch jemand in der Wohnung war, und es zeigte sich eine andere, mir unbekannte Großmutter Tanja.
Sie hatte sich schon immer durch die außerordentliche Genauigkeit einer Redakteurin ausgezeichnet; ich konnte mich nicht erinnern, dass sie früher etwas zerbrochen, verstreut, vergossen oder umgeworfen hätte, dass ihr der Brei angebrannt oder die Milch übergelaufen wären und den Herd verschmutzten, oder dass sie sich mit einer Nadel in den Finger gestochen hätte. Und nun schienen die Elemente und Dinge geradezu den Aufstand zu proben, und es verging kein Tag ohne eine kleine Katastrophe. In meiner Großmutter hauste jetzt ein kleiner Dämon der Zerstörung, der die Kräfte des Chaos zum Leben erweckte; und ich war wie ein Wächter, der mit ihm rang.
Ein Dämon, ein kleiner Dämon nutzte die Schwäche meiner Großmutter und ihre Vergesslichkeit meisterlich aus; es schien, als habe er sich das Ziel gesetzt, die Wohnung vollständig zu vernichten. Großmutter schaltete wer weiß wozu das Gas ein, und ich lüftete danach die Küche; sie legte die Zeitung viel zu nah an den brennenden Herdring, schaltete das Heizgerät an, ohne zu merken, dass der Vorhang die glühenden Spiralen berührte; Brand, Überschwemmung, Diebe – wie oft schloss Großmutter die Wohnungstür auf und ließ sie angelehnt offen stehen –, alle denkbaren Unglücksfälle suchten beharrlich einen Weg in unser Haus.
Und dann wurde mir klar, dass sie etwas vernichten wollte; sie ging durch die Zimmer und befragte die Dinge, die etwas vor ihr verbargen. Als ich eines Tages vom Einkaufen zurückkam, traf ich sie weinend an – über einer Schüssel, die voller Papierasche war; sie hatte etwas verbrannt und offenbar erst dann begriffen, dass es das Falsche war.
Das Manuskript – suchte sie nach dem Manuskript, um es zu verbrennen? Hatte sie es sich anders überlegt? Wollte sie ihre Erinnerungen zurückhaben? Aber das Manuskript lag bei meinem Vater auf dem Tisch, meine Großmutter war unzählige Male daran vorbeigegangen. Wusste sie nicht mehr, wie das Heft aussah? Hatte sie vergessen, was sie vernichten wollte, und versuchte deswegen, das Unglück ins Haus zu locken, damit es alles auf einmal verschlang? Was war dort Besonderes, was sie aufgeschrieben hatte, warum war sie so unruhig und aufgewühlt, wenn sie mir selbst das Manuskript zum Lesen überlassen hatte? Hing es irgendwie damit zusammen, dass mein Vater es las und nicht ich? Wusste meine Großmutter davon?
Wie oft wollte ich, wenn mein Vater bei der Arbeit war, das Manuskript aufschlagen; aber mein Vater hatte eine Eigenheit – er war überakkurat und hätte auf jeden Fall gemerkt, dass jemand das Heft angerührt hatte; bereits als Kind wusste ich, dass ich durchaus in den Schrank meiner Mutter und meiner Großmutter kriechen konnte, aber hätte ich das Territorium meines Vaters betreten und zum Beispiel den Stangenzirkel aus dem Reißzeug genommen, um damit ein hochaufgeschossenes Metallmännchen zu konstruieren, wäre ich ganz sicher ertappt worden, egal wie millimetergenau ich danach alles an seinen Platz zurückgelegt hätte. Außerdem fand ich, das Manuskript könne man nicht auf zwei verteilen, es wie ein gewöhnliches Buch behandeln, das einfach und zugänglich ist – schlag auf und lies.
Mein Vater las indes die Memoiren meiner Großmutter, ohne etwas von ihrer Unruhe zu wissen – meinem Gefühl folgend, dass es besser so sei, erzählte ich ihm nichts, und zum Abend hin beruhigte sich Großmutter und war wie immer. Er meinte, ihr sei eines Tages bewusst geworden, dass sie nicht mehr lang zu leben hatte, und habe beschlossen, vor ihrem Ende all das zu erzählen, was sie wusste und gesehen hatte; als Einzige, die von der älteren Generation der einst vielzähligen Familie übriggeblieben war, erfüllte sie ihre Pflicht gegenüber Vorfahren und Nachkommen.
Mein Vater war völlig überwältigt von dem sich offenbarenden Ausmaß der Vergangenheit; als eigentlich zurückhaltender Mensch ohne Neigung zu Affekten, erzählte er immer wieder einige Episoden: Wer hätte das gedacht, unser entferntester Vorfahre war ein tatarischer Mirza, der nach der Schlacht auf dem Kulikowo Pole[2] in den russischen Militärdienst ging … Stellt euch vor, die Kinder ließen sich auf der Schleppe eines Abendkleides über das Parkett ihrer Villa ziehen … Sie rutschten von einem Lazarettzelt, als sei es eine Schlitterbahn … Und Großmutter hat also noch Tuchatschewski[3] zu Gesicht bekommen …
Er zitierte aus dem Manuskript, wenn Freunde meiner Eltern zu Besuch kamen, und diese Zitate wurden von Mund zu Mund weitergegeben – mit Staunen, mit Begeisterung. Tag für Tag, Woche für Woche hörte ich diese fragmentarischen Sätze, und in mir wuchs ein dunkler Zweifel, ein Argwohn, der mich selbst erstaunte.
Warum verwandelte sich Großmutter Tanja tagsüber in ein irrlichterndes Gespenst? Wegen Tuchatschewski? Wegen der Schleppe? Wegen des Lazarettzelts? Nein, das konnte es nicht sein.
Nach ungefähr zwei Monaten übergab mir mein Vater feierlich, viel zu feierlich, endlich das Manuskript. Offensichtlich fühlte er sich schuldig, dass er es abgefangen hatte, und wollte sich mit dieser Feierlichkeit entschuldigen. Aber vor allem waren wir jetzt nicht mehr nur Vater und Sohn, sondern Urenkel, Ururenkel und Nachkommen jener, die bereits im Schatten der Jahrhunderte standen und nur noch in unserem Familiennamen weiterlebten.
Wie mir erst viel später klarwurde, hatte meine Großmutter etwas in dieses Buch gelegt, das sich nur dem ersten Leser offenbaren sollte. Und dieser mir zugedachte Zauber der ersten Lektüre war nun meinem Vater zugefallen – wie ein irrtümlich abgeschossener Pfeil des Amors einen zufälligen Vorübergehenden in einen hoffnungslos leidenden Verliebten verwandelt.
Selbst als zweiter Leser und im Wissen, in welcher Aufregung meine Großmutter lebte, war ich dem Text geradezu verfallen. Er lebte und atmete, er sang seine Melodie wie eine edle Spieluhr. Aufgestoßen wurden die Fenster zu den Jahrhunderten, im Hintergrund zeichneten sich die Figuren großer Persönlichkeiten ab; Schiffe liefen aus Häfen aus, Blut floss, Menschen wechselten Länder und Staatszugehörigkeiten. Ich ließ mich ein, versenkte mich in den Text, flog durch die Epochen, die Mauern der Finsternis traten beiseite, und immer mehr dehnte sich die Dimension des Lichts aus, sah ich das historische Terrain, auf dem meine entfernten Vorfahren agiert hatten.
Und wenn ich aufgehört und den Text kein zweites Mal gelesen hätte, wäre es bei dem herrlichen Gefühl der sich öffnenden Grenzen geblieben. Aber ich las ihn wieder und wieder – ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal; mich befremdete von Anfang an eine selbstverständliche und deswegen schwer fassbare Eigentümlichkeit.
Die Memoiren bestanden aus zwei Teilen.
Der erste Teil umfasste das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert, die Familienlegenden; meine Großmutter hatte sie so aufgeschrieben, wie sie sie als Kind von den Älteren gehört hatte: Die Kinder wurden hinter Wandschirmen zu Bett gebracht, aber sie stellten sich nur schlafend, während die Erwachsenen sich Geschichten über die Vorfahren erzählten, ihre Begegnungen, ihre Verliebtheiten, ihren Tod und das Getrenntsein. Eine Familie zu sein bedeutet genau das – nachts in einem großen Zimmer an einem Tisch zu sitzen und diese Geschichten zu hören.
Eine Haltestation irgendwo bei Kaluga im Winter, zwei Züge, die in den Schneewehen stecken geblieben sind, mein Ururgroßvater begegnet meiner Ururgroßmutter … Ihre Ehe gegen den Willen der Verwandten, meine Ururgroßmutter eine Kleinbürgerin aus einer armen Familie, mein Ururgroßvater Oberst mit Aussichten auf den Generalsrang, Erbe eines Landguts, Liebling der altadligen Verwandtschaft, die im Spiel der Eitelkeiten ihre Hoffnungen auf ihn setzt. Ihre Heirat, das Eheleben, der Erwerb eines kleinen Guts bei Serpuchow, die Geburt dreier Kinder, der Tod meines Ururgroßvaters im Kaukasus. Mein Urgroßvater, ein Militärarzt im Russisch-Japanischen Krieg, trifft danach genauso zufällig wie sein Vater seine künftige Frau in einer abgelegenen Kleinstadt an der Transsibirischen Eisenbahn, wo sein Lazarettzug stationiert ist. Wieder eine Heirat ohne Zustimmung der Verwandten, wieder Kinder, dann der Beginn des Ersten Weltkriegs …
Oh, wie gut, wie rührend und zuckersüß glänzend diese Geschichten waren, echte Geschichten aus dem neunzehnten Jahrhundert. Für einen Menschen am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ein paradiesischer Zustand, zu dessen historischer Unberührtheit es kein Zurück gab. Ich konnte mich nicht mit ihnen in Verbindung bringen, mit den gebildeten Aristokraten, die sich ihres Adelstitels schämten, mit jenen, für die die Belagerung von Sewastopol im Krimkrieg oder die Schlacht von Schipka[4] Ende der siebziger Jahre der Höhepunkt von Schrecken und Leid gewesen waren.
Im zweiten Teil schrieb meine Großmutter darüber, was sie selbst gesehen und erlebt hatte: der Erste Weltkrieg, der Bürgerkrieg, die zwanziger, dreißiger Jahre, der Große Vaterländische Krieg, die Wanderjahre mit dem Lazarett ihres Vaters hinter den Fronten der russischen Armeen in Galizien und der Ukraine; 1917 – die Krankheit ihres Vaters, die Rückkehr auf das Gut, Einsiedlertum; 1918 – mein Urgroßvater tritt in die Rote Armee ein; wieder unterwegs mit dem Lazarett, diesmal im Hinterland der Roten Fronten und Kampfgruppen; die große Zersplitterung, Feindschaft unter Brüdern, ein Teil der Verwandten emigriert, der jüngere Bruder meines Urgroßvaters, ein Offizier, dient in der Armee von Koltschak[5], dann ist er verschollen; der ältere Bruder, ein Geistlicher, verlässt mit Wrangels[6] Truppen die Krim, oder er wird von den Roten erschossen, als diese die Halbinsel einnehmen. Die Unbestimmtheit, ob die Brüder umgekommen sind – beide allererste Feinde der Sowjetmacht, Pope und Zarenoffizier – oder ob sie überlebt haben, im Ausland sind, oder sich unter falschem Namen irgendwo auf sowjetischem Boden verstecken, gab dem familiären Gram über die Verluste lange Jahre einen bittermandelnen Beigeschmack; in gewissem Sinne wäre es für die in der Sowjetunion Gebliebenen besser gewesen, wären beide Brüder unter Zeugen umgekommen.
Die späten zwanziger Jahre – meine Großmutter studiert, Geschwister, Vetter und Kusinen ersten und zweiten Grades heiraten, damit beginnt der Zerfall der alten Familie: Zwei Drittel der neuen Verbindungen wären zehn Jahre zuvor undenkbar gewesen. Meine Großmutter – allein. Lernte sie niemanden kennen? Blieb ihre Liebe unerwidert?
Die dreißiger Jahre – nicht mehr als zehn Seiten für ein ganzes Jahrzehnt, und selbst diese wurden scheinbar unter innerem Zwang geschrieben; Anekdoten von der Arbeit in der Druckerei, Alltagsgeschichten, großartige Vorhaben – die ganze Familie tritt einer Wohnungsbaukooperative bei. 1938 stirbt meine Urgroßmutter, und sieben von zehn Seiten sind ihrer Beerdigung gewidmet.
Der Krieg – meine Großmutter ist bereits schwanger, wobei das Kind völlig unvermittelt im Text auftaucht und gleichzeitig so beiläufig, als habe es meine Großmutter schon zehn Jahre in unverändert embryonalem Zustand in sich getragen, sei mit ihm verwachsen und habe sich an ihn gewöhnt – und nun zeigt sie es den Lesern, und es beginnt sich zu entwickeln und zu wachsen, wie es sich für ein Kind gehört.
Die Niederkunft im August; der Herbst, die Deutschen stehen vor Moskau; Panik, Plündereien, Flucht nach Osten; Gegenoffensive der sowjetischen Truppen, der Dezemberangriff bei Finsternis, Frost und Schnee; der erste Tote – ein Vetter meiner Großmutter fällt im Nahkampf in einem Schützengraben. In den ersten fünf Kriegsmonaten wurde niemand aus der Familie verletzt – und nun der Tod, als ginge er ein Klassenbuch von A bis Z durch und sei bei unserem Familiennamen angekommen; kein Aufschub mehr.
All jene Menschen, die auf den Seiten ihrer Erinnerungen Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre aufgetaucht waren, kamen jetzt wieder vor – zum letzten Mal. Meine Großmutter schaffte es gerade noch festzuhalten, wer wann starb und unter welchen Umständen, falls sie ihr bekannt waren. Wer im Hinterland geblieben war, fand sich auf einmal an vorderster Front wieder: Ein Vetter meiner Großmutter, ein Akademiemitglied, hatte vielen Verwandten Arbeit in Leningrad beschafft. Er selbst wurde als unersetzlicher Experte ausgeflogen, die anderen blieben im Einschluss der Blockade, deren Ende keiner von ihnen erlebte.
Aber derartige Einzelheiten erfuhr ich erst aus den Notizen meines Vaters – er hatte einiges bei Verwandten nachgefragt und Dokumente miteinander verglichen. Meine Großmutter hatte das alles scheinbar widerwillig geschrieben; dieser Teil der Erinnerungen war so etwas wie eine erzwungene Zugabe zum ersten Teil.
Ich war ein wenig enttäuscht. Ich hatte ein gewaltiges Orgelgewitter erwartet. Aber diese unerfüllte Erwartung half mir schließlich zu ergründen, in welcher Weise die Erinnerungen geschrieben waren, welche Subtexte sie bargen.
Ursprünglich hatte ich – fälschlicherweise – angenommen, meine Großmutter habe die Vergangenheit in dem gesamten, ihr zugänglichen Umfang beschrieben, die Arbeit sei bereits geleistet, und ich brauche mir das neue Wissen nur anzueignen. Strenggenommen hatte ich meine eigene Intention auf meine Großmutter übertragen – die Wahrheit vollständig offenzulegen. Sie aber konnte dergleichen nicht erfüllen oder, was wahrscheinlicher war, sie hatte es überhaupt nicht gewollt. Deswegen war folglich weniger der Inhalt ihrer Memoiren von Bedeutung, sondern meine eigene Lektüreerfahrung – das Lesen zwischen den Zeilen, durch den Text hindurch, der die Echtheit eines Dokuments vorgaukelte. Das war das eigentlich Interessante und Aufregende, eine echte historische Detektivarbeit, und nicht die Details aus dem Familienleben Anfang des 20. Jahrhunderts.
Das Erste, was mich erstaunte – meine Großmutter maß alle ihre Betrachtungen an der Familie und nicht am einzelnen Menschen; oder sie maß sie am Menschen als Teil der Familie, als ihr Organ oder Funktion. Das verlieh dem Erzählten ein besonderes Erscheinungsbild: Im Grunde fehlte es an eigenständig handelnden Personen.
Dieser Eindruck verstärkte sich durch eine weitere Besonderheit. Meine Großmutter schrieb so, als hätten die Menschen unter den historischen Umständen nie irgendwelche Entscheidungen getroffen. Sie verliebten sich, hielten – überaus dramatisch – um jemandes Hand an, taten sich zusammen, brachten Kinder zur Welt, zerstritten sich mit Verwandten. Doch sobald der Text an eine Stelle kam, die eine zutiefst persönliche Entscheidung erwarten ließ, tauchten völlig gängige Phrasen auf wie: »Und dann wurde Vater eingezogen, und er begann, in der Roten Armee zu dienen.«
Mein Urgroßvater, ein adliger Zarenoffizier und vermutlich überzeugter Anhänger der Konstitutionell-Demokratischen Partei – wurde er etwa einfach so »eingezogen, und er begann, in der Roten Armee zu dienen«? Das hatte so nicht sein können, war aber die vom Text geschaffene Realität; in dieser Realität waren die Menschen allein der Macht der Umstände unterworfen.
Ja, und die Autorin selbst befand sich bemerkenswerterweise in derselben Lage wie ihre Protagonisten. Meine Großmutter schrieb höchst emotional und dabei doch unpersönlich; die Emotionalität war künstlerisch, tauchte in Naturbeschreibungen von, sagen wir, blauem Rittersporn in der sommerlichen Flussniederung der Oka, in den Wortkörpern selbst auf; aber gleichzeitig schien der Text wie von einem erfahrenen Bürokraten geschrieben, der bewandert war in der Zusammenstellung von Dokumenten: nirgends die eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen oder eine Bewertung abzugeben.
Man bemerkte es kaum: Es gab so viele Details und Ereignisse, die Aufmerksamkeit war ständig beansprucht … Ich konnte diese Empfindung erst beim dritten oder vierten Lesen in Worte fassen. Wie viele Kränkungen, wie viele Ungerechtigkeiten hatte es gegeben, die Gefallenen des Bürgerkriegs, die Gefallenen des Vaterländischen Kriegs, die Kusinen, die in der Leningrader Blockade an Hunger gestorben waren … und nichts. Keine Reaktion, kein Aufschrei, kein Aufstöhnen, kein Klageruf nach Rache oder Vergeltung; als sei die Empfindung von Kränkung und Schmerz nur unnötige Kraftverschwendung. Und überhaupt, wenn man von der Familie absah – wie viele waren vernichtet, aus dem Leben gestrichen worden, wie viel Blut wurde vergossen, wie viele Gemeinheiten und Abscheulichkeiten waren begangen worden – und sie schwieg.
Meine Großmutter fehlte