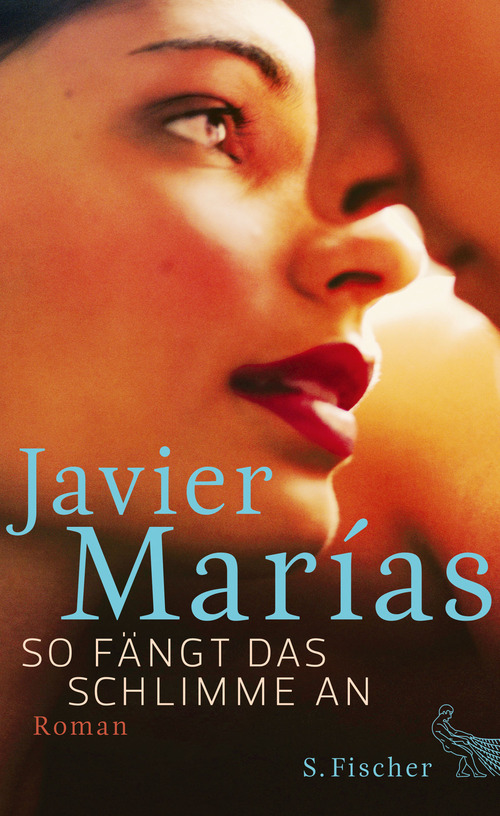
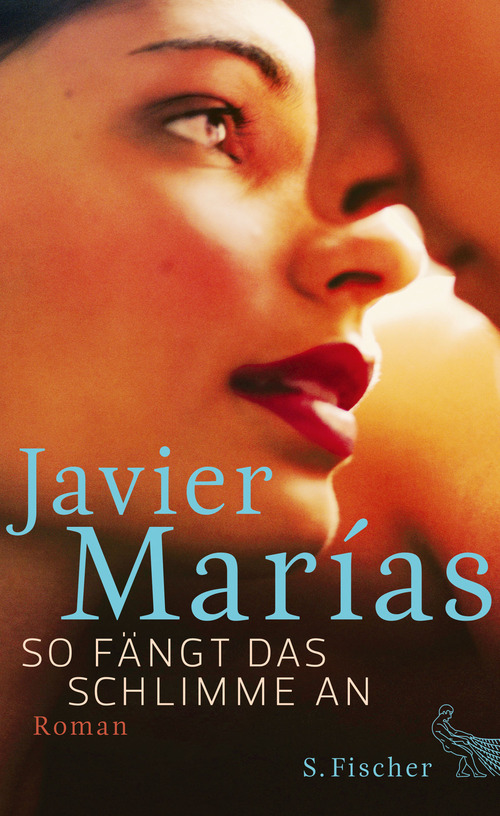
Javier Marías
So fängt das Schlimme an
Roman
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
FISCHER E-Books

Javier Marías, 1951 als Sohn eines vom Franco-Regime verfolgten Philosophen geboren, veröffentlichte seinen ersten Roman mit neunzehn Jahren. Seit seinem Bestseller ›Mein Herz so weiß‹ gilt er weltweit als interessantester Erzähler Spaniens. Sein umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Nelly-Sachs-Preis sowie dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Seine Bücher wurden in über vierzig Sprachen übersetzt.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Liebe, Leidenschaft und ein rätselhafter Todesfall – der große spanische Erzähler und Bestseller-Autor Javier Marías in Höchstform Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der unglücklichen Ehe von Eduardo und Beatriz? Auch Juan, Freund und engster Vertrauter, kennt die Wahrheit nicht. Als er Beatriz‘ Geliebter wird, überstürzen sich erschütternde Ereignisse. Jahre später erkennt Juan: Wenn wir uns der Vergangenheit nicht stellen, wird alles Leben aus der Lüge kommen. Der Spanier Javier Marías ist ein erbarmungsloser Kenner der menschlichen Herzen, ihrer dunklen Seiten und verborgenen Winkel. Ein überwältigendes Meisterwerk.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2014
unter dem Titel ›Así empieza lo malo‹
im Verlag Alfaguara, Madrid 2014
© Javier Marías, 2014 published by agreement with Casanova & Lynch Agencia Literaria S. L., Barcelona
and Michi Strausfeld, Barcelona-Berlin
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Coverabbildung: Getty Images
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403519-2
Für Tano Díaz Yanes,
nach fünfundvierzig Jahren Freundschaft,
weil er mir immer ein Capote zuwirft,
wenn der Stier sich auf mich stürzt.
Und für Carme López Mercader,
die es, kaum glaublich, immer noch nicht müde wurde,
mir zuzuhören. Noch nicht.
Nicht allzu lang ist die Geschichte her – weniger lang, als ein Leben gewöhnlich dauert, und wie gering ist ein Leben, wenn es vorüber ist, sich in ein paar Sätzen erzählen lässt und im Gedächtnis nur noch Asche bleibt, die sich beim kleinsten Beben löst, davonfliegt beim geringsten Wind –, und doch wäre sie heute unmöglich. Damit meine ich das, was den beiden, Eduardo Muriel und seiner Frau Beatriz Noguera, als jungen Menschen geschehen war, und nicht so sehr, was mir mit ihnen geschah, als ich der junge Mann war und ihre Ehe ein langes, unauflösliches Unglück. Letzteres wäre sehr wohl noch möglich: das, was mir geschah, denn es geschieht mir selbst heute noch oder ist ein und dasselbe, das niemals aufhört. Und vermutlich könnte auch wieder passieren, was sich mit van Vechten zutrug, genau wie anderes aus jener Zeit. Van Vechtens hat es wohl immer gegeben, sie sterben nicht aus, es wird sie weiter geben, bestimmte Figuren wandeln sich nie, ob in der Wirklichkeit oder in der Fiktion, ihrer Zwillingsschwester, sie wiederholen sich im Laufe der Jahrhunderte, als mangelte es beiden Sphären an Phantasie oder als wäre es unausweichlich (beide letztlich Werk der Lebenden, vielleicht besitzen die Toten mehr Erfindungskraft), ja man könnte meinen, wir erfreuten uns an einem einzigen Schauspiel, einer einzigen Erzählung, wie kleine Kinder. Mit unendlichen Varianten, in altmodischem oder modernem Kostüm, aber im Grunde immer die gleiche. Deshalb wird es zu jeder Zeit Eduardo Muriels und Beatriz Nogueras gegeben haben, von den Statisten gar nicht zu reden; ebenso Juan de Veres in rauen Mengen, denn so hieß und heiße ich, Juan Vere oder Juan de Vere, je nachdem, wer meinen Namen sagt oder denkt. Nichts Originelles hat meine Figur.
Damals gab es hierzulande die Scheidung nicht, und schon gar nicht hätte man hoffen können, dass es sie eines Tages wieder geben würde, als Muriel und seine Frau geheiratet hatten, zwanzig Jahre bevor ich in ihr Leben eindrang, oder vielleicht waren eher sie durch meines gezogen, das eines Debütanten sozusagen. Aber sobald wir in der Welt sind, geschehen uns Dinge, ihr schwaches Rad greift uns auf, voll Skepsis und Überdruss, schleift uns lustlos mit, denn es ist alt und hat schon viele Leben gemächlich zerrieben im Licht seines trägen Turmwächters, des kalten Monds, der vor sich hin döst und nur aus einem Augenschlitz zusieht, er kennt die Geschichten, bevor sie geschehen. Es reicht, dass jemand Notiz nimmt – oder ein achtloses Auge auf uns wirft –, schon können wir uns nicht mehr entziehen, sosehr wir uns verstecken und mucksmäuschenstill bleiben, keinerlei Initiative ergreifen, nichts tun. Sosehr man sich unsichtbar machen will, man wurde gesichtet wie am Horizont ein Treibgut im Ozean, das niemand übersehen kann, dem er ausweichen oder sich nähern muss; man zählt für die anderen, und die anderen zählen mit einem, bis man verschwunden ist. Ganz so war es bei mir nicht. Ich blieb nicht wirklich passiv, gab nicht vor, ein Trugbild zu sein, versuchte nicht, mich unsichtbar zu machen.
Immer habe ich mich gefragt, wie es jemand hatte wagen können – und das über Jahrhunderte –, eine Ehe zu schließen, solange diese Entscheidung endgültig war; vor allem die Frauen, für die es noch schwerer war, sich Erleichterung zu verschaffen, oder die sich doppelt und dreifach anstrengen mussten, es zu verheimlichen, ja fünffach, wenn sie von solchen Erleichterungen beschwert zurückkehrten, ein neues Wesen bemänteln mussten, noch bevor es ein Gesicht ausgebildet und der Welt gezeigt hatte: vom Augenblick seiner Empfängnis an, seines Entdeckens oder Erahnens – vom Moment der Ankündigung gar nicht zu reden –, und es dann für sein ganzes Leben in einen Schwindler verwandelten, oftmals ohne dass es je etwas von dem Betrug oder seiner unehelichen Herkunft erfuhr, nicht einmal im Alter, als schon kaum mehr jemand hätte dahinterkommen können. Zahllos sind die Geschöpfe, die den Falschen für ihren Vater, die Halbbrüder für Brüder gehalten und ihren Glauben und Irrtum mit ins Grab genommen haben oder vielmehr die Täuschung, die ihre unerschütterlichen Mütter ihnen von Geburt an auferlegt hatten. Im Unterschied zu den Krankheiten und Schulden – die man sich im Spanischen ebenso »einhandelt« wie die Ehe, sie teilen sich dasselbe Verb, als brächten sie gleichermaßen schlechte Prognosen oder Unheil mit sich, in jedem Fall aber Mühsal – gab es bei der Ehe ganz gewiss keine Heilung und kein Abbezahlen. Oder nur beim Tod eines der Eheleute, seit langem stillschweigend herbeigesehnt oder auch herbeigeführt, eingefädelt oder gezielt betrieben, meist noch stillschweigender, ein unbekennbares Geheimnis. Oder natürlich beim Tod beider, dann blieb nichts mehr übrig, nur die unwissenden Kinder, wenn es welche gab und sie noch am Leben waren, und eine kurze Erinnerung. Höchstens noch eine Geschichte, hin und wieder. Eine zarte Geschichte, fast nie erzählt, da man die intimen gewöhnlich verschweigt – all die Mütter, unerschütterlich bis zum letzten Atemzug, und die Nichtmütter ebenso –; oder vielleicht doch, aber flüsternd, damit es nicht ganz so ist, als hätte es sie nie gegeben, damit sie nicht im stummen Kopfkissen versickert, in das sich das weinende Gesicht drückt, damit sie nicht nur das schläfrige, träge Auge des Mondes sieht, des kalten Nachtwächters.
Eduardo Muriel trug einen schmalen Schnurrbart, als hätte er ihn sich wachsen lassen, als man noch Errol Flynn nacheiferte, und später vergessen, ihn abzuschaffen oder aufzupolstern, einer dieser Männer mit festen Gewohnheiten, was ihr Äußeres angeht, die nicht merken, dass die Zeit vergeht und die Moden sich ändern oder dass sie älter werden – als ginge sie das nichts an oder als käme es nicht in Frage, als fühlten sie sich unbehelligt vom Lauf der Zeit –, und gewissermaßen tun sie recht daran, sich nicht zu sorgen oder Notiz zu nehmen: Indem sie sich von ihrem Alter abkoppeln, halten sie es sich vom Leib; indem sie ihm äußerlich nicht nachgeben, nehmen sie es letztlich nicht an, und so umschleichen die Jahre sie ängstlich – sonst tun sie fast vor jedem groß –, kommen näher, wagen aber nicht, Besitz von ihnen zu ergreifen, nisten weder in ihrem Geist noch suchen sie ihr Äußeres heim, lassen nur einen gemächlichen Schneeregen darauf fallen, einen Schatten. Er war groß, weit größer als der Durchschnitt seiner Generation, die auf die meines Vaters folgte, wenn es nicht noch dieselbe war. Deshalb wirkte er auf den ersten Blick kräftig und schlank, auch wenn seine Figur nicht im strengen Sinn männlich war: Die Schultern waren etwas zu schmal für seine Statur, weshalb der Unterleib sich zu verbreitern schien, obwohl er dort keineswegs zu Rundungen neigte, auch keine unpassend ausladenden Hüften hatte, der Ausgangspunkt endlos langer Beine, mit denen er beim Sitzen nicht wusste, wohin. Wenn er sie verschränkte (was ihm noch am liebsten war), erreichte der Fuß des oberen Beins ganz natürlich den Boden, was manchen Frauen, die sich etwas auf ihre Waden einbilden – sie sollen nicht baumeln, verdickt oder verformt vom stützenden Knie –, künstlich gelingt, perspektivisch verlängert mit Hilfe hoher Absätze. Wegen der schmalen Schultern trug Muriel Sakkos mit Schulterpolstern, so gut wie unsichtbar oder vom Schneider in Form eines umgekehrten Trapezes angefertigt (noch in den Siebzigern und Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts ging er zum Schneider oder bestellte ihn ins Haus, als derlei kaum mehr üblich war). Die Nase war schnurgerade, ohne einen Anflug von Krümmung trotz ihrer beachtlichen Größe, und im dichten Haar, nass gescheitelt, wie es gewiss schon in der Kindheit seine Mutter gekämmt hatte – diesem fernen Diktat zuwiderzuhandeln, hatte er wohl nicht für nötig erachtet –, glänzten ein paar graue Fäden, verstreut im dominierenden Dunkelbraun. Der schmale Schnurrbart dämpfte kaum das Spontane, Strahlende, Jugendliche seines Lächelns. Er bemühte sich, es zu zügeln oder zurückzuhalten, das gelang ihm nicht oft, unter der Oberfläche seines Naturells verbarg sich Heiterkeit oder eine Vergangenheit, die auftauchte, ohne dass man das Lot in große Tiefen senken musste. In seichten Gewässern stellte sie sich jedoch nicht ein, dort schwamm eine Art auferlegte, unfreiwillige Bitterkeit, als deren Urheber er sich womöglich gar nicht sah, eher als ihr Opfer.
Aber am auffälligsten war für den, der ihn zum ersten Mal vor sich sah oder auf einer der seltenen Frontalaufnahmen in der Presse, die Klappe über dem rechten Auge, eine klassische Augenklappe wie im Theater, ja wie im Kino, schwarz, gewölbt und straff gehalten durch ein Gummiband von gleicher Farbe, das diagonal die Stirn kreuzte und hinter dem linken Ohrläppchen festgemacht wurde. Schon immer habe ich mich gefragt, warum diese Klappen reliefartig sind, ich meine nicht die aus Stoff, die nur abdecken, sondern die unverrückbaren, wie eingepassten, aus Gott weiß was für einem starren, kompakten Material. (Es sah aus wie Bakelit, am liebsten hätte ich mit dem Fingernagel dagegen geklopft, hätte erforscht, wie es sich anfühlte, was ich bei der meines Arbeitgebers selbstverständlich niemals wagte; wie es klang, wusste ich dagegen, denn manchmal, wenn er nervös oder verärgert war, aber auch, wenn er überlegte, bevor er ein Urteil fällte oder mit einer Rede begann, den Daumen unter der Achsel wie die winzige Gerte eines Offiziers oder Kavalleristen, der die Reihe seiner Truppen oder seiner Pferde abschreitet, tat Muriel genau das, er trommelte mit dem Rand des Fingernagels gegen die harte Klappe, als riefe er den nicht vorhandenen oder untauglichen Augapfel zu Hilfe, ein Geräusch, das ihm behagen musste und tatsächlich angenehm klang, krick krick krick; auch wenn es einen ein wenig schauderte, wie er da den fehlenden beschwor, bis man sich an die Geste gewöhnt hatte.) Vielleicht soll diese Wölbung den Eindruck erwecken, dass sich ein Auge darunter befindet, auch wenn dort nur eine leere Höhle ist, ein Loch, eine Vertiefung, eine Mulde. Vielleicht sind diese Klappen gerade deshalb konvex, damit sie die entsetzliche Höhlung überspielen, die sie in manchen Fällen verbergen; wer weiß, vielleicht ruht dahinter eine vollendete Kugel aus Kristall oder Marmor, die Pupille und die Iris makellos mit müßigem Realismus aufgemalt, auch wenn sie niemand zu Gesicht bekommt hinter der schwarzen Hülle oder nur ihr Eigentümer, wenn der Tag vorüber ist und er sie müde vor dem Spiegel aufdeckt und herausnimmt, womöglich.
Wenn das eine Auge unweigerlich Aufmerksamkeit erregte, zog das taugliche, freiliegende sie nicht weniger an, das linke, mit seinem tiefen, dunklen Blau wie das abendliche, fast schon nächtliche Meer, das in seiner Einzahl alles aufzunehmen, alles zu bemerken schien, als hätte sich die eigene Kraft und die des unsichtbaren, blinden Gefährten in ihm gebündelt oder die Natur es für den Verlust des anderen mit zusätzlicher Durchdringungskraft entschädigt. So stark, so schnell war dieses Auge, dass ich manchmal ganz allmählich und unauffällig versuchte, mich aus seiner Reichweite zu entfernen, damit es mich nicht mit seinem scharfen Blick verletzte, bis Muriel dann schimpfte: »Rück ein Stück nach rechts, du bist fast außerhalb meines Blickfelds, ich muss mich ja verrenken, denk dran, meines ist begrenzter als deines.« Zu Anfang, als mein Blick noch nicht wusste, wo er verweilen sollte, und meine Aufmerksamkeit vom lebendigen Meeresauge zur toten, magnetischen Klappe sprang, konnte er mich gut und gern ermahnen: »Juan, ich spreche mit dem sehenden Auge zu dir, nicht mit dem verstorbenen, also sei so nett, hör mir zu und lass dich nicht von dem ablenken, das kein Wort mehr von sich gibt.« Muriel sprach ganz offen über seine halbierte Sehkraft, im Unterschied zu denen, die einen unbehaglichen Schleier des Schweigens über ihre Gebrechen oder Behinderungen breiten, so augenfällig oder spektakulär sie auch sein mögen. Manch Einarmiger gesteht nie die Schwierigkeiten ein, die der klar ersichtliche Mangel einer Gliedmaße mit sich bringt, und tut fast so, als könnte er jonglieren; manch Einbeiniger macht sich mit einer Krücke an den Aufstieg zum Annapurna; manch Blinder geht immer wieder ins Kino und beschwert sich bei dialogfreien, bildreichen Szenen, sie seien unscharf; manch Invalide im Rollstuhl gibt vor, nichts von seinem Vehikel zu wissen, will unbedingt Stufen erklimmen und verachtet die Rampen, die es heute überall gibt; manch Glatzkopf tut aufgeregt, als würde er entsetzlich zerzaust, die imaginäre Mähne in wütendem Wogen, sobald ein Windstoß aufkommt. (Ihre Sache, es steht ihnen frei, mir fällt es nicht ein, sie zu kritisieren.)
Aber als ich ihn zum ersten Mal fragte, was geschehen, wie sein stilles Auge verstummt sei, antwortete er so schneidend, wie er es Leuten gegenüber sein konnte, bei denen ihm der Geduldsfaden riss, selten bei mir, den er gewöhnlich voll Wohlwollen und Zuneigung behandelte: »Damit wir uns verstehen: Du bist nicht hier, um mir Fragen über Dinge zu stellen, die dich nichts angehen.«
In dieser Anfangszeit ging mich kaum etwas an, auch wenn sich das schnell änderte, es reicht, jemanden verfügbar, bei der Hand, in Wartestellung zu haben, damit man ihm nach und nach vertraut oder Aufgaben erfindet; und »hier« bedeutete bei ihm zu Hause, obwohl es nach einiger Zeit auch so etwas meinte wie »an meiner Seite«, wenn ich ihn mal auf eine Reise begleiten, mal bei den Dreharbeiten aufsuchen oder an einem Abendessen oder einem Pokerabend mit Freunden teilnehmen sollte, im Grunde nur als Lückenbüßer, wie mir scheint, ein bewundernder Zeuge mehr. In seinen geselligsten Phasen, die zum Glück nicht selten waren – oder sollte man sagen, in seinen weniger melancholischen oder gar misanthropischen, regelmäßig fiel er von einem Extrem ins andere, als säße sein Gemüt auf einer recht gemächlichen Wippe, die seiner Frau gegenüber plötzlich schneller schwang, aus Gründen, die ich mir nicht erklären konnte und die in ferner Vergangenheit liegen mussten –, hatte er gern Publikum, Zuhörer, ja ließ sich gern ein wenig anfeuern.
Bei ihm zu Hause, wenn wir vormittags zusammentrafen, damit er mir, sofern nötig, Anweisungen geben oder eine Weile Reden schwingen konnte, fand ich ihn oft rücklings auf dem Wohnzimmerboden oder dem des angrenzenden Arbeitszimmers (beide Räume von einer Schiebetür getrennt, die fast immer offen stand, später vereinte man die Zimmer tatsächlich zu einem einzigen großzügigen Raum). Vielleicht bewogen ihn dazu die Schwierigkeiten, im Sitzen die Beine unterzubringen, und es war für ihn bequemer so, der Länge nach ausgestreckt, ohne Hürden noch Hindernisse, mal auf dem Wohnzimmerteppich, mal auf den Dielen des Arbeitszimmers. Auf dem Boden trug er natürlich keines seiner Sakkos, die er dort nur zerknautscht hätte, sondern Hemd und Weste oder einen Pullover mit V-Ausschnitt, allerdings immer eine Krawatte, in seinem Alter schien ihm dieses Accessoire unverzichtbar zu sein, zumindest in der Stadt, auch wenn sich damals alle Bekleidungsregeln bereits in Luft aufgelöst hatten. Als ich ihn zum ersten Mal so sah – auf dem Boden liegend wie eine Kurtisane aus dem 19. Jahrhundert oder wie ein verunglückter Zeitgenosse –, war ich überrumpelt und in Sorge, glaubte, er hätte einen Anfall, wäre ohnmächtig geworden oder gestolpert und käme nicht mehr auf die Beine.
»Was haben Sie, Don Eduardo? Geht es Ihnen nicht gut? Soll ich Ihnen helfen? Sind Sie ausgerutscht?« Dienstfertig streckte ich ihm die Arme entgegen, um ihm aufzuhelfen. Nach anfänglichem Ringen (er drängte mich, ihn einfach zu duzen) hatten wir vereinbart, dass ich ihn siezen, aber beim Vornamen nennen sollte, ohne das »Don«, aber es fiel mir schwer, es wegzulassen, es kam mir automatisch über die Lippen und entschlüpfte mir noch immer.
»Unsinn«, entgegnete er vom Boden aus und machte nicht die geringsten Anstalten, aufzustehen oder sich vor mir zu schämen; er blickte auf meine rettenden Hände, als wären sie zwei Fliegen, die ihn umschwirrten und ihm lästig waren. »Siehst du nicht, dass ich hier in aller Ruhe rauche? Da.« Und er hielt mir schwenkend eine Pfeife, fest am Kopf gepackt, vors Gesicht. Er rauchte vor allem Zigaretten und außer Haus nichts anderes, aber bei sich griff er zwischendurch zur Pfeife, als wollte er ein Bild vervollständigen, das im Grunde nur wir wenigen sahen (er holte sie nicht einmal bei den gelegentlichen Einladungen hervor, die er meist ganz spontan gab), das Bild war wohl für ihn selbst gedacht: Augenklappe, Pfeife, schmaler Schnurrbart, dichtes Haar mit hohem Scheitel, maßgeschneiderte Anzüge, manchmal mit Weste, als wäre er unbewusst beim Bild der Galane seiner Kindheit oder Jugendzeit hängengeblieben, in den dreißiger, vierziger Jahren, nicht nur bei Errol Flynns (dem Urbild, mit dem er das strahlende Lächeln gemein hatte), sondern bei Schauspielern, von denen wir heute nur noch ein verschwommenes Bild haben, wie Ronald Colman, Robert Donat, Basil Rathbone, auch David Niven und Robert Taylor, die etwas länger überdauerten, ihnen allen glich er, sosehr sie sich voneinander unterschieden. Da er Spanier war, erinnerte er hin und wieder auch an die Braungebrannteren, die erst recht andersartig und exotisch wirkten, Gilbert Roland und César Romero, vor allen an Ersteren mit seiner großen Nase, schnurgerade wie die seine.
»Und was machen Sie da auf dem Boden, wenn ich fragen darf? Reine Neugier, keinerlei Einwand, Gott bewahre. Ich möchte nur Ihre Gewohnheiten verstehen, das ist alles. Wenn es denn eine Gewohnheit ist.«
Er vollführte eine resignierte Gebärde der Ungeduld, als wäre mein Erstaunen nichts Neues für ihn, als hätte er früher schon anderen die gleiche Erklärung geben müssen.
»Nichts Ungewöhnliches. Was ist dabei? Ich mache das oft. Da gibt es nichts zu verstehen, und ja, es ist eine Gewohnheit. Darf man sich nicht auf dem Boden ausstrecken, auch wenn einem nichts passiert ist, einfach aus Vergnügen? Und aus Bequemlichkeit.«
»Aber natürlich, Don Eduardo, Sie können Balanceübungen machen, wenn Sie Lust dazu haben, das versteht sich doch von selbst. Mit chinesischen Tellern sogar.« Diese Bemerkung ließ ich hinterlistig einfließen, damit feststand, dass seine Haltung so normal nicht war, wie er vorgab, nicht bei einem reifen Mann, einem Familienvater dazu, auf dem Boden lümmeln sonst junge Kerle und Kinder, und er hatte drei davon im Haus. Ich war mir auch nicht sicher, ob man wirklich chinesische Teller nannte, was mir da in den Sinn gekommen war, man lässt mehrere davon auf flexiblen Stäben kreisen, lang und dünn, die man auf den Fingerkuppen balanciert, ich habe keinerlei Vorstellung, wie man das bewerkstelligt und zu welchem Zweck. Aber bestimmt hatte er mich verstanden. »Hier stehen doch zwei Sofas bereit«, fügte ich hinzu und deutete ins Wohnzimmer hinter mir, er lag im Arbeitszimmer. »Es hätte mich nicht die Spur beunruhigt, wenn Sie auf einem davon gelegen hätten, sogar im Schlaf oder in Trance. Aber auf dem Boden, bei all dem Staub … Das erwartet man nicht unbedingt, verzeihen Sie.«
»In Trance? Ich, in Trance? Wie denn in Trance?« Das schien ihn getroffen zu haben, aber schon kam ein halbes Lächeln durch, als hätte es ihn zugleich amüsiert.
»Na ja, nur so eine Redensart. Grübelnd, meditierend oder hypnotisiert.«
»Ich hypnotisiert? Von wem? Wie hypnotisiert?« Nun konnte er ein kurzes offenes Lächeln nicht unterdrücken. »Du meinst Selbsthypnose? Ich mich selbst? Am Morgen? À quoi bon?«, schloss er auf Französisch, kurze Ausflüge in diese Sprache waren nicht selten bei den Gebildeten seiner und der vorhergehenden Generation, die zweite Sprache, die sie gewöhnlich erlernt hatten. Ja, sehr bald schon hatte ich gemerkt, dass meine kleinen Scherze nicht unwillkommen waren, fast niemals schob er den Riegel vor, sondern ging ein wenig darauf ein; wenn er es nicht ausführlicher tat, dann kaum aus mangelnder Lust, sondern nur, damit ich mir nicht allzu schnell zu viel herausnahm, eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, ich bewunderte und respektierte ihn. Nach dem Ausflug ins Französische hielt er inne. Wieder streckte er die rauchende Pfeife in die Höhe, um den folgenden Worten Nachdruck zu verleihen: »Der Boden ist der sicherste Ort, den es gibt, solide und bescheiden, wo man die beste Sicht auf den Himmel oder die Decke hat, wo man am besten denken kann. Und auf dem hier liegt keine einzige Staubflocke«, betonte er. »Gewöhn dich dran, mich hier unten zu sehen, denn hier kann man weder herunter- noch tiefer fallen, was sehr von Vorteil ist, wenn man Entscheidungen zu treffen hat, denn dabei sollte man immer von der schlimmsten Hypothese ausgehen, ja sogar von der Verzweiflung und ihrem Pendant, der Niedertracht, so werden wir nicht weich und machen uns nichts vor. Zerbrich dir also nicht den Kopf und setz dich, ich will dir etwas diktieren. Und lass endlich das ›Don‹ weg, wie oft soll ich dir das noch sagen. ›Don Eduardo‹«, er äffte mich nach, er war ein begnadeter Imitator. »Das macht mich alt und klingt nach Galdós, den ich nur schwer ertrage, mit zwei Ausnahmen, und bei einem so ausufernden Werk macht ihn das zum Despoten. Los, schreib.«
»Von da aus wollen Sie diktieren? Von da unten?«
»Ja, von hier aus, was dagegen? Dringt meine Stimme nicht zu dir? Sag bloß, wir müssen zum HNO-Arzt mit dir, das würde nichts Gutes verheißen in deinem Alter. Wie alt warst du noch mal? Fünfzehn?« Auch ihm lagen der Scherz und die Übertreibung.
»Dreiundzwanzig. Ja, natürlich dringt Ihre Stimme zu mir. Sie ist mächtig und männlich, wie Sie wissen.« Ich fing mit den Scherzen nicht nur an, immer, wenn Muriel einen mit mir machte, gab ich ihn zurück oder antwortete zumindest im gleichen unernsten Ton. Wieder lächelte er unwillkürlich, mehr mit dem Auge als mit den Lippen. »Aber ich sehe Ihr Gesicht nicht, wenn ich mich an meinen Platz setze. Ich wäre dann hinter Ihrem Rücken, und das ist unhöflich, nicht wahr?« Gewöhnlich saß ich in einem Sessel gegenüber dem seinen, wenn wir die Korrespondenz erledigten, zwischen uns sein Schreibtisch aus dem 18. Jahrhundert; aber nun lag er nahe der Wohnzimmerschwelle hinter meinem Sessel.
»Dann dreh den Stuhl um, damit er zu mir sieht. Was für ein kolossales Problem, er ist doch nicht am Boden festgeschraubt.«
Er hatte recht, und ich machte es so. Jetzt lag er buchstäblich zu meinen Füßen, quer davor, eine extravagante Konstellation, der Chef horizontal auf dem Boden und der Sekretär – oder was auch immer ich darstellen sollte – eine Handbreit davon entfernt, ihm bei der geringsten unfreiwilligen, abrupten oder falsch berechneten Bewegung einen Tritt in die Rippen oder die Hüfte zu verpassen. Ich zückte mein Notizbuch (später tippte ich die Briefe auf der alten Maschine, die er mir geliehen hatte und die noch gut funktionierte, und gab sie ihm zum Durchlesen und Unterschreiben).
Aber Muriel legte nicht gleich los. Die eher liebenswerte, latent heitere Miene von eben war einer der Versunkenheit oder Reflexion gewichen oder der von Kümmernissen, die man vor sich herschiebt, weil man ihnen nicht die Stirn bieten, nicht in sie hinabtauchen will, und die deshalb stets zurückkehren, wieder und wieder, und bei jedem Ansturm tiefer werden, da sie nicht verschwunden sind, während man sie auf Distanz oder fern der Gedanken hielt, nein, sie sind in der Abwesenheit gleichsam gewachsen, haben nicht aufgehört, den Geist unterschwellig oder unterirdisch zu belauern, als wären sie die Vorboten einer erstorbenen Liebe, mit der man sich schließlich abfinden wird, die man aber noch nicht einmal erahnt: diese Wogen von Kälte, Ärger, Überdruss gegenüber einem geliebten Menschen, die anrollen, kurz verweilen und sich wieder zurückziehen; und immer, wenn sie fort sind, redet man sich ein, dass ihr Besuch bloß Trugbild war – eine Folge der Unzufriedenheit mit sich selbst oder des Missmuts im Allgemeinen, ja sogar der widrigen Umstände oder der Hitze – und dass sie nicht wiederkehren. Nur, um beim nächsten Mal festzustellen, dass die Wogen immer hartnäckiger werden, ein längeres Verweilen mit anschwemmen und den Geist ein wenig mehr vergiften und bedrücken, ihn mehr über sich zweifeln und fluchen lassen. Es dauert, bis dieses Gefühl der Lieblosigkeit Form annimmt, mehr noch, bis der Geist es artikuliert (›Ich glaube, ich ertrage sie nicht mehr, ich sollte ihr die Tür verschließen, es muss sein‹), und wenn das Bewusstsein es endlich angenommen hat, bleibt noch ein gutes Stück Weg, bevor es in Worte gefasst und derjenigen mitgeteilt wird, die verlassen werden soll und die nichts ahnt und sich nichts ausmalt – ebenso wenig wie wir, die wir selbst verlassen: betrügerisch, feige, zögernd, träge wollen wir das Unmögliche: der Schuld ausweichen, uns das Verletzen ersparen –, derjenigen, die es nicht glauben kann, sich grämen muss, vielleicht in ihrer Bleichheit sterben.
Muriel legte die Hände auf die Brust, eine davon zur Faust geballt, denn er hielt die Pfeife darin, die ausgegangen war und die wieder anzuzünden er sich nicht die Mühe machte. Anstatt wie angekündigt mit dem Diktat zu beginnen, verharrte er zwei Minuten in Schweigen, während deren ich ihn fragend ansah, den Federhalter gezückt, bis er einzutrocknen drohte und ich die Kappe wieder aufsetzte. Von einem Moment auf den nächsten schien er vergessen zu haben, was er sich vorgenommen hatte, als wäre ihm ein Gedanke in die Quere gekommen, eine Angelegenheit, ein bereits durchgekautes Dilemma, das alles andere weggefegt hatte, nur mich nicht, den möglichen, vom Zufall ausgesuchten Ratgeber oder den bloßen Zuhörer seiner Kümmernisse. Vom Boden aus warf er zweifelnde, fast verstohlene Blicke zu mir, als läge ihm etwas auf der Zunge – zwei-, dreimal öffnete er den Mund, holte Luft und schloss ihn wieder –, was er jedoch immer noch nicht freigeben wollte, das heißt, für meine Ohren; als grübelte er, ob er mich an einer Frage teilhaben lassen sollte, die ihn beunruhigte oder verstörte, ja sogar innerlich verzehrte. Er räusperte sich einmal, zweimal. Die Worte kämpften darum, sich ihren Weg zu bahnen, von der Vorsicht gebremst, vom Hang zur Geheimnistuerei oder zumindest von der Diskretion, als wäre es eine heikle Sache, die nicht bekannt werden, vielleicht nicht einmal ausgesprochen werden durfte, das Ausgesprochene schwebt in der Luft und ist schwer wieder einzufangen. Ich wartete wortlos, ohne zu drängen oder ihn zum Sprechen aufzufordern, wartete voll Vertrauen und Geduld, denn damals wusste ich bereits – das lernt man schnell, als Kind schon –, dass alles, was man zu gern hinauslassen, erzählen, fragen, vorschlagen möchte, fast immer hervorbricht, am Ende quillt es heraus, als könnte keine Kraft – keine Gewalt, die man sich antut, auch keine Vernunft – es jemals bremsen, die Schlachten gegen unsere hitzige Zunge verlieren wir fast regelmäßig. (Oder gegen die unbändige Zunge, die tyrannische.)
»Du, der du einer anderen Generation angehörst und die Dinge gewiss auf deine Weise siehst«, fing Muriel endlich an, noch behutsam und tastend. »Du, der du jung bist, aus einer anderen Generation«, wiederholte er, um Zeit zu gewinnen, sich noch unterbrechen und schweigen zu können, »was würdest du tun, wenn man dir erzählt, dass ein uralter Freund …?« Er machte eine Pause, als wollte er das Gesagte verwerfen und es anders formulieren. »Wie soll ich es angehen, dir erklären … Dass ein langjähriger Freund nicht immer der war, der er heute ist? Nicht so, wie man ihn kennt und wie er heute ist oder wie der, für den man ihn immer gehalten hat?«
Er rang offensichtlich immer noch mit sich, wie die Folge ins Leere laufender, wirrer Fragen zeigte. Muriel war sonst nicht wirr, im Gegenteil, er stellte gern Präzision zur Schau, auch wenn er auf dem Weg dorthin manchmal zu Abschweifungen neigte. Je nach Antwort konnte er noch einen Rückzieher machen (»Egal, lassen wir das«, oder »Lass gut sein, vergiss es«, oder »Nein, besser, ich ziehe dich da nicht mit rein, es ist nicht deine Angelegenheit und wenig erfreulich; meine Zweifel wirst du auch nicht aus der Welt schaffen, sie nicht einmal verstehen«). Also beschloss ich, zunächst geduldig zu bleiben und eine Miene konzentrierter Aufmerksamkeit aufzusetzen, als wäre ich in höchster Spannung und wartete nur auf seine Frage, als wäre nichts in meinem Leben von größerem Interesse; da er jedoch nichts weiter hinzufügte – selbst erstaunt über seine wirren Reden –, begriff ich, dass es an mir war, mit Worten nachzuhelfen, und bevor sich seine Zunge wieder zurückzog, wagte ich die Antwort:
»Was meinen Sie, einen Verrat? Einen Verrat an Ihnen?«
Ich sah, dass er keinen Irrtum zulassen konnte, auch wenn es immer noch ein Irrtum über etwas Nebulöses, Düsteres, über ein Nichts war, und ich ahnte, dass er unweigerlich fortfahren musste, ein wenig zumindest.
Er steckte die Pfeife in den Mund, kaute darauf herum und stieß seine Worte dann zwischen den Zähnen hervor, als wollte er lieber nicht allzu deutlich verstanden werden. Oder als wäre das, was er sagte, bloß ein Bluff.
»Nein. Das ist ja der Haken. Wenn es so wäre, wüsste ich, wie ich damit umgehen, die Angelegenheit anpacken müsste. Wenn es mich persönlich beträfe, würde ich ohne Bedenken zu ihm gehen und versuchen, die Dinge klarzustellen. Oder mich gegen ihn stellen, wenn die Sache unverzeihlich wäre und sich bewahrheitete, ein casus belli. Aber so ist es ganz und gar nicht. Das Erzählte betrifft mich nicht, hat nichts mit mir oder unserer Freundschaft zu tun. Berührt sie nicht, und doch …« Er beendete den Satz nicht, verkroch sich wieder in sich selbst, es fiel ihm schwer, zuzugeben, was er sich ausmalte.
Ich glaubte nicht etwa, was ich erwiderte, aber ich dachte oder ahnte, dass ich ihm dadurch etwas würde entlocken können; sobald man uns etwas erzählt oder andeutet – etwas Heikles, Schlüpfriges oder Verbotenes, das wir für schwerwiegend halten und das man uns eigentlich gar nicht erzählen will –, wollen wir dem Berichtenden unbedingt etwas entlocken. Es ist fast ein Reflex oder, wie man es früher nannte, ein Sport.
»Warum ignorieren Sie es dann nicht? Weshalb lassen Sie den Dingen nicht ihren Lauf? Es könnte die Unwahrheit sein, Verleumdung oder ein Irrtum. Wenn es Sie nicht persönlich betrifft, ich weiß nicht, machen Sie es einfach nicht zu Ihrer Angelegenheit und Schluss. Sie können ihn auch auf den Kopf zu fragen. Er soll es bestätigen oder dementieren. Wenn Sie so gute Freunde sind, wird er die Wahrheit sagen. Etwa nicht?«
Muriel nahm die Pfeife aus dem Mund und legte die freie Hand an die Wange, schwer zu sagen, was sich auf was stützte, das ist kaum zu entscheiden, wenn jemand auf dem Boden liegt. Er wandte mir das scharfsinnige Auge zu, das er bisher ziellos oben hatte schweifen lassen, über die Decke, die obersten Regalbretter der Bibliothek, ein Bild von Francesco Casanova an der Arbeitszimmerwand, er war äußerst stolz, dass er ein Ölbild des jüngeren Bruders des berühmten Giacomo besaß, des Lieblingsmalers von Katharina der Großen, wie er mir mehr als einmal erklärt hatte (»Von Russland«, fügte er hinzu, als zweifelte er an meinen Geschichtskenntnissen, nicht ohne Grund). Er sah mich an und versuchte, sich ein Bild von meiner Gutwilligkeit oder meinem Grad an Naivität zu machen, ob ich tatsächlich Lösungen beisteuern wollte oder einfach nur hilfsbereit war; oder schlimmer noch, ein Klatschmaul. Anscheinend fand meine Haltung seine vorläufige Billigung, denn nach endlosen Sekunden der Musterung, die mich nervös machten und fast zu einer Selbstprüfung veranlassten, antwortete er:
»Aber nein. Niemand bekennt so etwas freiheraus, alle Welt würde sich weigern, vor wem auch immer, einem Freund, einem Feind, einem Unbekannten, einem Richter, erst recht vor seiner Frau oder seinen Kindern. Was für eine Antwort könnte ich schon erwarten. Ob ich verrückt sei. Für wen ich ihn halten, wie schlecht ich ihn kennen würde. Das seien Gerüchte oder die schäbige Abrechnung eines verbitterten, verschlagenen Menschen, der einen unstillbaren Groll gegen ihn hege, einen, der niemals vergeht. Nein und nochmals nein. Er würde wissen wollen, wer mit so einer Geschichte zu mir gekommen sei. Und gewiss wäre unsere Freundschaft damit beendet, allerdings auf seine Initiative hin, nicht auf meine. Er wäre dann der Enttäuschte. Würde den Beleidigten spielen. Oder sich zu Recht beleidigt fühlen, wenn alles die Unwahrheit wäre.« Er hielt einen Moment inne, als stellte er sich vielleicht die absurde Szene vor, die Bitte um Aufrichtigkeit. »Sei nicht einfältig, Juan. Häufig gibt es nur ein ›Nein‹, ein ›Nein‹, das nichts erklärt, das unbrauchbar ist. Man bekäme keine andere Antwort, mag sie nun wahr sein oder nicht. Ein ›Ja‹ kann oftmals nützen. Fast nie ein ›Nein‹, wenn es um etwas Gemeines, Beschämendes geht oder darum, unbedingt etwas zu erreichen oder die eigene Haut zu retten. An sich ist es gar nichts wert. Es zu akzeptieren ist reine Glaubenssache, und glauben müssen wir, nicht der, der ›Nein‹ antwortet. Außerdem ist der Glaube unbeständig und zerbrechlich, er schwankt, fängt sich wieder, erstarkt, bekommt Risse. Und geht verloren. Der Glaube ist nie vertrauenswürdig.«
›Was zum Teufel hat man ihm erzählt, was soll dieser düstere oder ihm plötzlich verdüsterte Freund gesagt oder getan haben?‹, dachte, fragte ich mich. ›Nach all den Jahren Helligkeit.‹ Vielleicht dachte ich das gar nicht, sondern habe es nur heute so im Gedächtnis, da ich nicht mehr jung bin, fast so alt wie Muriel damals oder älter noch, es ist unmöglich, das Grünschnäblige der grünen Jahre wiederzuerlangen, wenn man einen weiten Weg seitdem gegangen ist, undenkbar, nicht zu verstehen, was man früher einmal nicht verstand, sobald man es verstanden hat, die Unwissenheit kehrt nicht zurück, nicht einmal, wenn man von der Zeit berichtet, in der man sie noch genießen durfte oder ihr Opfer war, ein jeder verfälscht, der sich beim Erzählen die Maske der Unschuld aufsetzt, die seiner Kindheit, Pubertät oder Jugend, der vorgibt – eisiges, bereiftes Auge –, den Blick des Kindes anzunehmen, das er nicht mehr ist, wie auch der Greis verfälscht, der sich vom Standpunkt des reifen Mannes aus erinnert und nicht von dem des Greisenalters, das seine Weltsicht prägt, seine Kenntnis der Menschen und seiner selbst, ebenso wie die Toten verfälschen würden – könnten sie sprechen oder flüstern –, wenn sie sich an die Stelle der törichten, unvollendeten Lebenden setzten, die sie einmal waren, und vortäuschten, noch nichts von Hingang und Wandel zu wissen, nicht am Ende all dessen zu sein, was sie einmal tun und sagen konnten, nachdem schon alles für sie getan und gesagt ist und es keine Möglichkeit der Überraschung mehr gibt, der Berichtigung, der Improvisation, das Konto ist gelöscht, und niemand wird es je wieder eröffnen … ›Er hat es als »so etwas« umschrieben, »niemand bekennt so etwas«, das muss schon eine zwielichtige, schändliche Geschichte sein, die er erfahren hat, was mag dahinterstecken? Von einem »verbitterten, verschlagenen Menschen« hat er geredet, da musste ich unweigerlich an eine Frau denken, auch wenn beides ebenso gut zu einem Mann passen mag, das will ich meinen, warum auch nicht, und doch, aus seinem Mund klang es für mich so, als käme die Information von einer Frau … Er zögert noch, ob er mir erzählen soll, worum es geht, was er zu seinem Leidwesen erfahren hat. Er befürchtet, wenn er es mir anvertraut, wird alles noch wirklicher, noch gewisser erscheinen; je mehr er es an die große Glocke hängt, umso verbriefter wird es sein, umso mehr verdammt er seinen Freund, und es ist nur natürlich, dass er das vermeiden möchte. Aber ebenso wenig kann er einfach von sich weisen, was er gehört hat, vielleicht quält und beunruhigt es ihn so sehr, dass er es nicht für sich behalten kann, tagaus, tagein nagt der Gedanke an ihm, drängt sich in seine Nächte, aber er weiß nicht, mit wem er darüber sprechen soll, ohne ihm größere Tragweite zu geben, größeren Ernst zu verleihen. Vielleicht sieht er in mir den Belanglosesten seiner Bekannten, gerade aufgrund meiner Jugend, meiner spärlichen Erfahrung, meiner Unfähigkeit, in seiner Welt der längst Erwachsenen zu agieren. Und sollte mir einfallen, es auszuplaudern, dann mangelt es meiner Stimme an Gewicht und Glaubwürdigkeit. Deshalb wird er mich auserwählt haben, meiner Bedeutungslosigkeit wegen‹, dachte ich. ›Erzählt er es mir, hat er es im Grunde niemandem erzählt. Gewiss fühlt er sich bei mir sicherer als bei jedem anderen, mich kann er entlassen, aus den Augen, aus dem Sinn, kann mich fast ausstreichen, ich wäre nichts als eine Leerstelle, vorher wie nachher. Aber in dem Fall kann ich auch nachhaken, bohren, herauskitzeln. Mich hört man nicht, bei mir drohen keine Konsequenzen.‹
»Ich kann keine Meinung dazu äußern, Don Eduardo, Eduardo«, korrigierte ich mich gleich, und in meinen Ohren klang es respektlos und schief, »wenn Sie nicht etwas deutlicher werden. Sie haben mich gefragt, was ich tun würde. Wenn ich nicht weiß, worum es geht, kann ich schlecht antworten. Und wenn Sie sagen, zu Ihrem Freund gehen würde auch nicht zur Wahrheit führen, er würde so etwas abstreiten und sein ›Nein‹ wäre nutzlos … Nun, dann weiß ich nicht, was Sie tun können. Dem Verantwortlichen zusetzen, der Ihnen die Geschichte erzählt hat, dafür sorgen, dass er es widerruft, zurücknimmt? Wenig wahrscheinlich, nicht wahr, dass jemand einen Rückzieher macht, nachdem er etwas Hässliches aufgedeckt hat, das ein schlechtes Licht auf jemanden wirft. Nachforschungen über Dritte anstellen, die Geschichte überprüfen? Sie werden wissen, ob das möglich ist, häufig ist das nicht der Fall. Also, denke ich, hängt alles davon ab, was dieses Etwas ist, bis zu welchem Punkt es neben Ihrer Freundschaft bestehen kann und inwieweit Sie dessen Schatten ertragen. Ich sagte bereits, man kann auch vergessen, verdrängen, den Dingen ihren Lauf lassen. Wenn man die Wahrheit unmöglich wissen kann, sind wir vermutlich frei, zu entscheiden, worin sie besteht.«
Das Meeresauge sah mich auf andere Art an, voller Neugier, vielleicht mit einer Spur Argwohn, als hätte Muriel keine so pragmatische Überlegung von mir erwartet, der Jugend sagt man fehlende Beherrschung nach, ein gewisses Maß an Unnachgiebigkeit, eine Aversion gegen die Ungewissheit, die faulen Kompromisse, eine Art Fanatismus bei der Suche nach der Wahrheit, so nichtig und beiläufig sie sein mag.
»Im Grunde ist es immer unmöglich. Man weiß niemals«, entgegnete er. »Die Wahrheit ist eine Kategorie …« Er unterbrach sich, was er sagte, dachte er, während er es sagte, es war kein Satz, den er sich vorher zurechtgelegt hatte; oder eben doch, und er rief ihn sich ins Gedächtnis wie ein Zitat. »Die Wahrheit ist eine Kategorie, die außer Kraft gesetzt ist, solange man lebt.« Er sann ein paar Sekunden nach, blickte zur Decke, als sähe er sie dort oben erscheinen, ganz wie die Wörter und Namen, die früher die Lehrer bedächtig an die Tafel schrieben. »Solange man lebt«, wiederholte er. »Ja, es ist zwecklos, ihr hinterherzulaufen, eine Zeitverschwendung, eine Quelle der Konflikte, eine Dummheit. Und doch können wir nicht anders. Oder wir können nicht umhin, nach ihr zu fragen, da wir die Gewissheit haben, dass es sie gibt, irgendwo, an einem Ort, in einer Zeit, zu der wir keinen Zugang haben. Das Wahrscheinlichste ist bestimmt, dass ich niemals mit Sicherheit wissen werde, ob dieser Freund einmal getan hat, was man mir von ihm erzählt. Aber ich weiß auch eins von beiden, nein, von dreien: Entweder er hat es getan oder hat es nicht getan oder etwas dazwischen, nicht so schwarz, wie man es mir gemalt hat, nicht so weiß, wie er es mir schildern würde. Dass ich dazu verdammt bin, es nicht herauszufinden, bedeutet nicht, dass es die Wahrheit nicht gibt. Das Schlimmste ist, dass inzwischen selbst der Betroffene sie womöglich nicht mehr kennt. Wenn viele Jahre vergangen sind, und so viele müssen es gar nicht sein, dann erzählen die Leute sich die Ereignisse, wie es ihnen passt, ja glauben die eigene Version, die eigene Verzerrung. Oftmals gelingt es ihnen, sie auszulöschen, sie zu vertreiben, sie wegzupusten wie eine Pusteblume«, er tat so, als halte er eine zwischen den Fingern, blies nicht, »sie reden sich ein, es hätte sie nie gegeben oder ihre Rolle dabei wäre eine andere gewesen. Es gibt Fälle aufrichtigen Vergessens oder ehrlicher Verfälschung, in denen der Lügner nicht lügt oder nicht bewusst lügt. Manchmal ist nicht einmal der Urheber einer Tat in der Lage, uns vom Zweifel zu befreien; er ist ganz einfach nicht mehr befähigt, die Wahrheit zu erzählen. Er hat sie erfolgreich verwischt, erinnert sich nicht, verwechselt sie oder kennt sie nicht mehr. Und doch ist sie da, es ändert nichts daran, dass es sie gibt. Etwas ist geschehen oder nicht geschehen, und wenn es geschah, dann auf ganz bestimmte Weise, es war so, wie es stattgefunden hat. Nimm nur diesen Ausdruck, ›stattfinden‹, den wir als Synonym für ›geschehen, sich ereignen‹ gebrauchen. Er ist seltsam angemessen und präzise, denn genau so ist es mit der Wahrheit, sie hat eine Stätte, und dort bleibt sie; sie hat eine Zeit und bleibt auch dort. Sie bleibt in ihnen eingesperrt, die Türen öffnen sich nicht mehr, wir können weder zu der einen noch in die andere reisen, um einen Blick hineinzuwerfen. Wir müssen uns mit groben Schätzungen und Annäherungen begnügen, können sie nur umkreisen, aus der Distanz nach ihr spähen oder durch Schleier und Nebel hindurch, vergebens, es ist töricht, sein Leben damit zu vergeuden. Und dennoch, dennoch …«
Er hustete, ein nervöser Husten, wie mir schien, der Ohnmacht oder der Unruhe. Er richtete sich auf, drehte sich ein wenig zur Seite, um die Streichhölzer aus seiner Hosentasche zu ziehen und die Pfeife wieder anzuzünden, den Ellbogen auf den Boden gestützt. Dabei zog er auch eine alte Pillendose aus Silber hervor, im Deckel eingelegt ein winziger Kompass, den er in seinem Gefängnis aus Glas immer betrachtete, wenn er besonders nachdenklich war, nicht wusste, wie oder ob er fortfahren sollte, wenn er zweifelte und wieder zweifelte, als hoffte er, die Nadel würde ihm die Richtung weisen, einmal von ihrem Norden abweichen. Ich hatte das Gefühl, dass er nicht nur zweifelte, ob er mir das mutmaßliche Delikt, die Niedertracht oder Gemeinheit seines Freundes offenbaren sollte (momentan wusste ich, dass es sich um keinen Verrat handelte), sondern ob er mir im Zusammenhang damit etwas auftragen sollte, eine Mission, vielleicht zu spionieren, nachzuforschen, ob ich, wie auch immer, eingreifen sollte; aber ohne Angaben würde ich schwerlich helfen können, selbst mit ihnen sogar. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass ihm vor allem die Ent