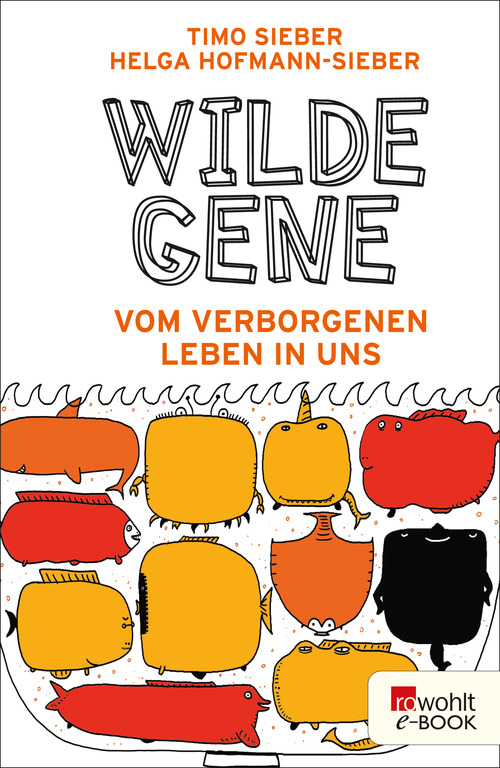
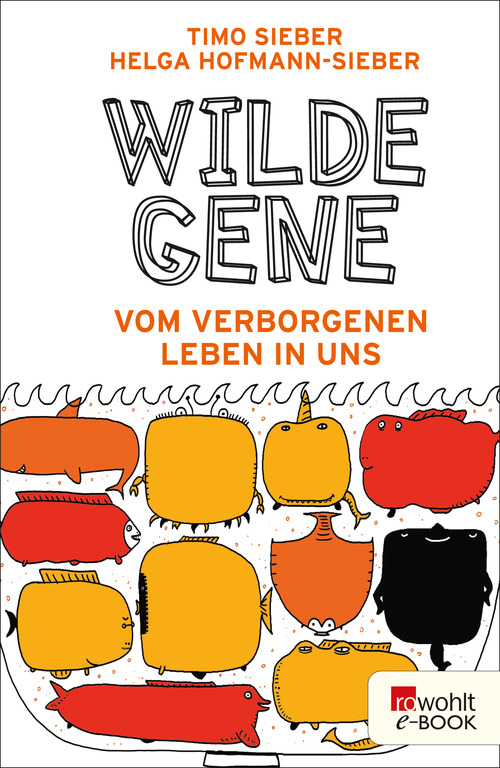
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Redaktion Regina Carstensen
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
Illustration Oliver Weiss
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
ISBN Printausgabe 978-3-499-63117-7 (1. Auflage 2016)
ISBN E-Book 978-3-644-55911-0
www.rowohlt.de
ISBN 978-3-644-55911-0
Für Maike und Adrian
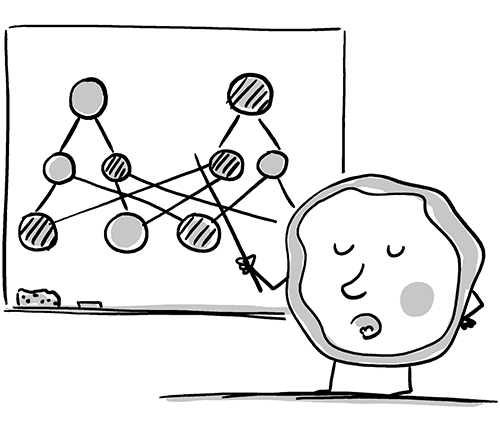
Hier räumen wir mit allen Vorurteilen auf, erledigen die Gesundheitstipps und schnallen uns an für die Reise zu den wilden Genen.
So. Jetzt haben wir den Salat. Sie halten dieses Buch in Händen und wollen jetzt wissen, worum es darin geht. Haben Sie es irgendwo in einem Buchladen eher zufällig aus dem Regal gefischt? Oder hat ein finsterer Algorithmus beschlossen, dass das doch ganz prima zu den Suchbegriffen passt, die Sie in den letzten Wochen so ins Netz philosophiert haben? Womöglich hat es Ihnen auch eine Freundin oder ein Freund mit den Worten «Hier, lies das. Dieses Buch hat mein Leben von Grund auf verändert!» über den Tisch geschoben. Egal wie: Wahrscheinlich wird dieses Buch Ihr Leben nicht verändern. Sie werden durch den Konsum dieser Lektüre nicht schlanker oder glücklicher. Es ist auch kein medizinisches Buch, das Ihnen Tipps gibt, um ein gesünderes Leben zu führen. Kein Stück! Na gut: Rauchen und Alkohol sind schlecht, essen Sie nicht zu viel, schlafen Sie nicht zu wenig und versuchen Sie gelegentlich ein wenig zu lachen. Das war’s aber auch schon.
…
Sie sind noch da? Gut. Dann kommen wir zum Punkt: Dieses Buch will nichts mehr und nichts weniger, als Ihnen erzählen, wie großartig Sie sind. Jawohl: Sie! Sie und alles andere, was auf diesem Planeten so kreucht und fleucht, vom Bakterium über irgendwelche Winz-Würmer bis hin zu dem miesepetrigen Zoo-Elefanten, der Ihnen Ihr sorgfältig geschnittenes Gemüse wieder vor die Füße wirft. Allesamt sind wunderbar, großartig und lebendig. Und darum geht es hier: um das Leben und vor allem um die Gene, die unsichtbar dahinterstecken.
Dieses Buch ist ein Ausflug ins Innere des Lebens, auf dem Ihnen ein wirklich wilder Haufen von Genen begegnen wird: Sie springen in der DNA herum, verändern sich durch Fehler und wandern von einem Wirt zum nächsten, wie ein Junggesellenabschied auf St. Pauli. Das klingt nach einer gehörigen Prise Chaos, doch genau das ist notwendig, um alles am Laufen zu halten und evolutionär voranzukommen. Zugleich organisieren sich die Gene in diesem Durcheinander aber auf wundersame Weise und erschaffen komplexe Lebewesen. Dabei halten sie sich eisern an eine einzige Regel, die da lautet: «Was geht, wird auch gemacht!» Also, meistens.
Wenn Sie die wild herumhüpfenden Gene heil überstanden haben, geben Sie das Buch an einen Freund weiter und sagen Sie vielleicht so was wie: «Hier, lies das. Dieses Buch hat mein Leben von Grund auf verändert!»

Die Geschichte geht los mit dreisten Gentlemen, die komische Krawatten tragen, eine Dame beklauen und dann berühmt werden. Nebenbei wird noch die DNA entdeckt, ihre Struktur aufgeklärt, und Superman und Clark Kent zeigen, wie ein Gen funktioniert.
Wir haben Besuch bekommen. Wie aus dem Nichts ist sie aufgetaucht – Tante Hedwig. Meine Frau und ich sehen uns an. «Wusstest du davon?», zische ich leise. Die leichte Panik in ihren Augen und das fast unmerkliche Zucken ihrer Mundwinkel sind mir Antwort genug.
Hedwig holt indessen zum nächsten Überraschungsschlag aus. Gekonnt schiebt sie sich mit ihrem großen Koffer an mir vorbei und wendet sich unserem Nachwuchs zu. «Mönsch! Bist du aber groß geworden!» Haare werden verwuschelt und zarte Kinderwangen zwischen Daumen und Zeigefinger in den tantentypischen Schwitzkasten genommen. «Du siehst ja ganz aus wie der Papa! Ganz der Papa! Sind die Gene. Na ja, verwächst sich vielleicht noch … Gib der Tante doch mal ein Küsschen. Wir werden jetzt viel Zeit miteinander haben …» Und während ich noch versuche, mich aus meiner Schockstarre zu lösen, trifft mich die Erkenntnis so unvermittelt wie ein Sommergewitter im November: Sie ist gekommen, um zu bleiben.
Dass sich Verwandte häufig ähneln (im Guten wie im Schlechten), ist uns allen schon lange klar. Aber was sind eigentlich diese mysteriösen Gene, die an der ganzen Geschichte schuld sein sollen?
Angefangen hat alles um 1854, als sich der Mönch und Aushilfslehrer Gregor Mendel (die Prüfung zum richtigen Lehrer hat er zeitlebens nicht bestanden) Gedanken darüber machte, wie sich Eigenschaften vererben. Na ja, «Gedanken machen» ist etwas untertrieben: Er hat etliche tausend Erbsenpflanzen gezüchtet, gekreuzt und untersucht. Seine Beobachtungen hat er dann statistisch ausgewertet. Heute gilt er als «Vater der Genetik». (Möglicherweise hat er nebenbei auch festgestellt, dass der Konsum großer Mengen Hülsenfrüchte im Kloster auch seine Schattenseiten hat, oder besser: für dicke Luft sorgt – das ist allerdings nicht im Detail überliefert.)
Mendel konnte zeigen, dass die Vererbung von Merkmalen, wie zum Beispiel Blütenfarbe und Wuchshöhe, festen Regeln folgt: Jede Erbsenpflanze schien ein mysteriöses «Etwas» in zwei Kopien zu enthalten, in denen die verschiedenen Merkmale der Pflanze festgeschrieben waren. Je eine Kopie davon ließ sich pro Elternpflanze an die einzelnen Nachkommen weitergeben. Außerdem wurde klar, dass das «Etwas», das da vererbt wurde, nicht ein einziger Block war, sondern aus einzelnen Teilen bestand, die bestimmte Merkmale festlegen konnten. Mendel hatte allerdings keinen blassen Schimmer, was diese Vererbungseinheiten sein könnten.
Schließlich veröffentlichte er seine Arbeiten. Es waren bahnbrechende, völlig neue Gedanken, die er da zu Papier gebracht hatte. Und wie das bei bahnbrechenden Ideen gerne so ist, wurden sie erst einmal nicht als solche erkannt. Die Fachwelt interessierte sich nicht für die Entdeckungen des Mönchs. Mendel glaubte allerdings fest daran, dass er etwas Wichtiges entdeckt hatte. Überliefert sind seine Worte: «Meine Zeit wird schon kommen!» Und sie kam auch. 30 Jahre später. Seine Arbeiten wurden um 1900 von drei Botanikern «wiederentdeckt», überprüft und in ihrer wahren Bedeutung erkannt. Mendel hätte das sicher sehr gefreut, nur leider war er zu diesem Zeitpunkt längst tot. Trotzdem: Der Startschuss der Genetik fiel in einem Klostergarten.
Das Wort «Gen» tauchte erst 1909 auf. Der Däne Wilhelm Johannsen leitete es vom griechischen genos (Familiengeschlecht) ab. Vielleicht weil er zu dem Schluss gelangte, dass man etwas Kurzes, Prägnantes brauchte, um diese «Vererbungseinheiten» zu benennen, die wohl für die Weitergabe von Merkmalen verantwortlich waren. Für ihn war ein Gen aber weniger ein reales Stück Materie, sondern eher ein Konzept. Damals dachten viele Wissenschaftler so.
Was die Natur der Gene anging, hatte man zwei große Fragen. Zum einen wie körperliche Eigenschaften – etwa «weiße Blütenfarbe» – von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Und zum anderen wie Eigenschaften überhaupt entstehen. Wie kommt es, dass eine Erbsenblüte weiß ist? Wie erzeugt die Pflanze diese Farbe?
Um den Ursachen von Eigenschaften auf den Grund zu gehen, könnte man wie Mendel mit großen Pflanzen oder mit Tieren arbeiten. Das wird allerdings schnell schwierig, da solche Untersuchungen lange dauern und die Eigenschaften dieser Lebewesen komplex sind. Glücklicherweise gibt es aber auch Lebewesen mit wesentlich einfacheren Eigenschaften. Zum Beispiel die Fähigkeit von Hefen, aus Zucker Alkohol zu erzeugen. Das ist eine schlichte chemische Reaktion: die Umwandlung eines Stoffes in einen anderen (eigentlich zwei, denn es entsteht dabei noch Kohlendioxid). Lebewesen nutzen für solche Stoffumsetzungen sogenannte Enzyme. Wenn in einem Lebewesen bestimmte Enzyme vorhanden sind, kann es einen speziellen Stoff in einen anderen umwandeln, sonst nicht. Wenn man so will, ist ein Enzym also die kleinste mögliche Eigenschaft.
Seit 1926 weiß man auch, was Enzyme eigentlich sind: Proteine. Proteine sind ein wahres Wunderwerk der Natur! Sie bestehen aus 20 sehr verschiedenen Bausteinen, den Aminosäuren, die sich in ihrer Anordnung beliebig kombinieren lassen und zu langen Ketten verknüpft werden können. Diese Ketten falten sich zu dreidimensionalen Gebilden zusammen, die die unterschiedlichsten Funktionen erfüllen können. (Ziemlich beeindruckende Leistung. Wer das bezweifelt, darf gerne mal versuchen, eine Schnur so zu verknödeln, dass daraus eine funktionierende Schere oder ein Modell des Eiffelturms entsteht.) Unsere Zellen nutzen eine Vielzahl von Proteinen für fast alle Dinge, die sie zum Leben brauchen. Proteine sind die Arbeitspferde des Lebens.
Nachdem klar war, dass ein Enzym eine einfache Eigenschaft vermitteln kann, wurde 1941 die Behauptung aufgestellt, dass ein Gen etwas ist, das bestimmt, wie ein Enzym aussieht. Diese Hypothese bekam den schönen selbsterklärenden Namen «Ein-Gen-ein-Enzym-Hypothese» verpasst und sollte nicht lange Bestand haben. Man entdeckte nämlich ziemlich bald, dass es auch Proteine gab, die keine Enzyme waren, sondern andere Aufgaben erledigten. Zum Beispiel können Proteine problemlos große Strukturen aufbauen (unsere Haare bestehen fast nur aus dem Protein Keratin). Daher taufte man das Konzept in «Ein-Gen-ein-Protein-Hypothese» um – und war vorläufig sehr zufrieden mit sich. Als man allerdings einige Jahre später herausfand, dass Proteine häufig nicht nur aus einer Kette von Aminosäuren (einem sogenannten Polypeptid), sondern aus mehreren bestehen können, gab es wieder einen neuen Namen. Na, wollen Sie raten? Die «Ein-Gen-ein-Polypeptid-Hypothese». Und lassen Sie uns ein bisschen vorgreifen: Auch das war noch nicht das Ende der Geschichte.
Jetzt wissen wir zwar, dass Proteine körperliche Eigenschaften von Lebewesen vermitteln können, aber wir wissen immer noch nicht, wie sie vererbt werden und was die Gene eigentlich sind. Erste Ideen zur Natur der Gene gab es schon kurz nach 1900, als man beobachtete, dass bei der Teilung von Zellen große fädige Strukturen, die Chromosomen, im Mikroskop sichtbar wurden. Die Chromosomen teilten sich dabei gleichmäßig auf die Tochterzellen auf. Das war verdächtig. Konnten sie die Informationsspeicher der Zellen sein? Als man sie näher untersuchte, fand man heraus, dass sie aus Protein und aus DNA bestanden. DNA, im Deutschen DNS, steht für Desoxyribonukleinsäure, ein wunderbares Wort und ideal, wenn Sie beim Scrabble mal ein «X» und ein «Y» gleichzeitig loswerden müssen. Gibt satte 51 Punkte!
Aber was von beidem war jetzt die Erbsubstanz? An die DNA glaubte am Anfang kaum jemand. Man kannte sie schon seit längerem, aber man wusste nur wenig Konkretes über sie. Sie schien in den Zellen nur so herumzuliegen und nicht viel zu machen. Außerdem bestand sie aus sehr wenigen Baustücken: den Basen G, A, T und C (Guanin, Adenin, Thymin, Cytosin) sowie aus Phosphat und Zucker.
Im Vergleich zu Proteinen mit ihren 20 verschiedenen Aminosäurebausteinen war das geradezu trivial. Außerdem, hey, Proteine können Enzyme sein und die vielfältigsten Aufgaben übernehmen, warum dann nicht auch die Informationsspeicherung? Diese Idee setzte sich durch und hielt sich lange. Erst als Mitte der vierziger Jahre gezeigt wurde, dass sich durch das Übertragen von DNA Eigenschaften von Bakterium zu Bakterium weitergeben lassen, änderte sich die Lehrmeinung. Langsam. Es dauerte noch fast zehn Jahre, bis die DNA endlich allgemein als Träger der Erbinformation akzeptiert war. Wie sagte Albert Einstein so schön? «Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.»
Stellen Sie sich vor, wie das gewesen sein muss, als dieser Schritt endlich getan war: Sie gehen abends nichtsahnend ins Bett, wachen am nächsten Morgen wieder auf, schlurfen zum Frühstückstisch, öffnen die Zeitung – und da steht schwarz auf weiß: Sie haben Desoxyribonukleinsäure! Und dieses unaussprechliche Zeug ist auch noch irgendwie dafür verantwortlich, dass Ihre Kinder Ihnen so verflixt ähnlich sehen.
Eine solche Erkenntnis verändert die Welt über Nacht. Und der Wissenschaftler wittert: Da liegen Nobelpreise in der Luft! Der nächste zentrale Schritt – das war allen klar – bestand darin, die Struktur der DNA aufzuklären. Wie sah so ein Molekül aus? Ein Wettrennen um die Beantwortung dieser Frage entbrannte, an dem die renommiertesten Köpfe teilnahmen. Gewonnen haben es zwei Wissenschaftler, die wohl kein Buchmacher auf dem Zettel hatte: James Watson und Francis Crick.
Obwohl die beiden auch heute noch die wohl größten Popstars der Biologie sind, war ihr Erfolg damals wirklich nicht abzusehen. Francis Crick, ein Brite, hatte Physik studiert und im Zweiten Weltkrieg Seeminen entwickelt. Nach dem Krieg wandte er sich der Biologie zu und werkelte in Cambridge recht erfolglos an seiner Doktorarbeit herum (er versuchte die Struktur des Sauerstofftransportproteins Hämoglobin zu bestimmen). Sein Chef hielt ihn für einen Schwätzer, der nichts Rechtes zustande brachte und ihm «Ohrensausen» verursachte.
Eines schicksalhaften Tages lief Crick jedoch der junge Amerikaner James Watson über den Weg. Dieser Watson war nun ein bisschen ein Wunderkind und hatte mit fünfzehn begonnen, Zoologie zu studieren. Jetzt war er zweiundzwanzig, hatte promoviert und war mit einem Stipendium nach Großbritannien gekommen. Die Chemie zwischen den beiden Männern stimmte sofort, und sie beschlossen, gemeinsam das Rätsel der DNA zu lösen. Das war gewagt, denn sie waren nicht wirklich Experten auf dem Gebiet und sollten eigentlich auch an ganz anderen Projekten arbeiten, die sie aber von nun an weitgehend ignorierten.
Richtig ins Rollen kam die Geschichte 1951. Watson saß ganz hinten in einem Vortrag, um nebenbei ungestört ein wenig in der Zeitung blättern zu können, und lauschte mit halbem Ohr. Vorne präsentierte Rosalind Franklin aus dem benachbarten London ihre neuesten Ergebnisse. Sie war führend auf dem Gebiet der Röntgenstrukturanalyse, und während Watson sich überlegte, wie sie ihr Äußeres vielleicht etwas aufpeppen könnte, verkündete sie ihre aktuellsten Erkenntnisse und Daten zur DNA-Struktur. Ihre Bilder waren besser als alles, was man bis dato gesehen hatte. Das dürfen Sie sich nicht wie ein Modell der DNA vorstellen, wie Sie es vielleicht von Abbildungen her kennen, das waren vielmehr ein paar dunkle, verwaschene Flecken auf einem Röntgenfilm, denen nur wenige Eingeweihte eine Bedeutung zuordnen konnten. Watson war jetzt hellwach: Franklin zeigte zwar ihre Röntgenfilme und mathematischen Analysen, aber sie entwarf kein Modell der molekularen Struktur. Ihm wurde klar, dass die DNA eine regelmäßige Helix-Struktur haben müsste, ähnlich einer Wendeltreppe. Das Rennen der Strukturaufklärung bog in die Zielgerade ein! Er und Crick begannen fieberhaft an dieser Struktur zu arbeiten.
«Arbeiten» hieß in ihrem Fall allerdings nicht, dass sie selbst irgendwelche Experimente gemacht hätten. Nein, sie nutzten die bekannten Fakten und die Informationsfetzen, die sich Watson aus dem Vortrag der Kollegin gemerkt hatte. Damit fischten sie in einem fremden Teich, und Watsons Vorgesetzter John Kendrew bestand darauf, dass sie das Modell, das sie entwickelt hatten, Rosalind Franklin und ihrem Kollegen Maurice Wilkins vorstellten.
Franklin war wenig begeistert von dem, was sie da zu sehen bekam, und es zeigte sich, dass das DNA-Modell der beiden Männer völlig unhaltbar war. Watson und Crick erlebten eine üble Blamage. Ihr Institutsleiter war peinlich berührt und zitierte sie am nächsten Tag zu sich: Schluss mit der Arbeit an der DNA! Das sollten die Kollegen Franklin und Wilkins in London machen, und auf Watson und Crick würden schließlich noch andere Aufgaben warten, zum Beispiel Cricks angefangene Doktorarbeit!
Das hätte das Ende sein sollen. War es aber nicht. Crick und Watson gaben nicht auf. Im nächsten Jahr, 1952, kam der große österreichisch-amerikanische Chemiker Erwin Chargaff nach Cambridge, der sich ebenfalls der Analyse der DNA widmete. Insbesondere beschäftigte er sich mit ihren chemischen Bestandteilen, den vier Basen A, G, C und T. Wie diese Bausteine allerdings in der DNA zusammenhingen, war noch unklar. Aber Chargaff hatte immerhin beobachtet, dass die Häufigkeit der Basen gekoppelt war: G und C waren immer gleich häufig, ebenso wie A und T. Crick und Watson suchten das Gespräch und blamierten sich erneut bis auf die Knochen. Sie machten unqualifizierte Bemerkungen, und es wurde klar, dass sie im Grunde keine Ahnung von Chemie hatten. Chargaff bezeichnete sie später als wissenschaftliche Clowns mit Ehrgeiz und Angriffslust bei völliger Verachtung für die Chemie.
Aber auch das hielt die zwei jungen Männer nicht auf. Wenig später besuchte Watson erneut das Labor von Franklin und Wilkins. Nachdem Franklin ihn hochkant hinausgeworfen hatte (er hatte versucht, ihr eine unveröffentlichte und daher vertrauliche Arbeit eines Konkurrenten zu zeigen), lief er Wilkins in die Arme. Das Verhältnis zu Wilkins war besser, denn Watson und Crick genossen das Schöne im Leben und schmissen Partys, zu denen sie Wilkins regelmäßig einluden. Wilkins zeigte ihm begeistert Franklins letzte Forschungsergebnisse und Daten, die deutlicher als je zuvor die DNA-Struktur zeigten.
Mit den neuen Informationen fuhr Watson zurück nach Cambridge und begann zusammen mit Crick ohne Unterbrechung an einem DNA-Modell zu arbeiten. Schließlich war es so weit: Am Morgen des 28. Februar 1953 knackten sie das Rätsel! Es war eine Doppelhelix. Mit die Ersten, die das erfuhren, waren übrigens die Gäste des Eagles Pub, der Stammkneipe von Watson und Crick, denn Crick rief noch am selben Tag gewohnt bescheiden durchs Lokal, dass sie das «Geheimnis des Lebens» entdeckt hätten!
Wenig später veröffentlichte das dynamische Duo sein Modell auf gerade mal einer Seite Text mit einer kleinen Skizze der Doppelhelix (die von Cricks Frau Odile gezeichnet worden war) – und es wurde über Nacht zum schillernden Star der wissenschaftlichen Welt. Die beiden würdigten übrigens auch den Beitrag von Franklin und Wilkins. In einem Satz. Ihre Arbeit sei von deren «Ergebnissen und Ideen stimuliert worden». Dies ist ein Paradebeispiel dafür, dass es bei der Verteilung von Ruhm und Ehre in der wissenschaftlichen Welt oft alles andere als fair zugehen kann. Immerhin wurde Franklin und Wilkins eingeräumt, in derselben Zeitschrift, in der Watson und Crick ihr DNA-Doppelhelix-Modell beschrieben hatten, auch die Daten zu veröffentlichen, die zu der großen Entdeckung geführt hatten.
Einen zusätzlich bitteren Nachgeschmack bekommt die Geschichte, wenn man bedenkt, dass Rosalind Franklin, ohne deren Röntgenanalysen die Entdeckung nie geschehen wäre, im Alter von nur 37 Jahren an Krebs starb. Es ist wahrscheinlich, dass ihre Arbeit mit den krebserregenden Röntgenstrahlen Franklin das Leben kostete, während sie Watson und Crick berühmt machte. Die Nutznießer erhielten 1962 gemeinsam mit Wilkins den Nobelpreis. Rosalind Franklin ging leer aus, da die Auszeichnung nur an Lebende vergeben wird.
Was für ein Licht wirft das alles auf Watson und Crick? Einerseits haben sie kein einziges Experiment zur Aufstellung ihres Modells selbst gemacht und mit nicht veröffentlichten Daten anderer Wissenschaftler jongliert. Das ist wirklich nicht die feine englische Art und läuft dem wissenschaftlichen Ehrenkodex zuwider. Die ganze Geschichte gilt daher heute auch als klassisches Beispiel dafür, wie man sich in der Wissenschaft eben nicht verhalten sollte. Andererseits haben sie Zähigkeit bewiesen und sich nicht von ihrem Ziel abbringen lassen. Sie haben die Informationen, die ihnen zur Verfügung standen, kombiniert und diese schließlich zu einem passenden Modell der DNA zusammengefügt. Das war zweifellos eine große intellektuelle Leistung, auf der Generationen von Wissenschaftlern unser heutiges Verständnis des Lebens aufgebaut haben. Sind die zwei jetzt Helden oder eher das Gegenteil? Fällen Sie Ihr Urteil selbst.
Aber zurück zur berühmten Doppelhelix. Watsons und Cricks Modell sieht aus wie eine verdrehte Strickleiter. Die beiden «Seilstränge» der Leiter sind Ketten von fest verbundenen DNA-Bausteinen oder Nukleotiden. Das «Seil» wird dabei durch Verknüpfungen von Zucker und Phosphaten aus den einzelnen Bausteinen zusammengehalten. Das ist ziemlich stabil. Das eigentlich Spannende sind aber die «Sprossen». Hier begegnen sich die Basen aus den beiden «Seilen». Und wenn ein A und ein T oder ein G und ein C aufeinandertreffen, dann ziehen sie sich an (das Ganze nennt sich auch «Watson-und-Crick-Basenpaarung»). Kommen andere Paare zusammen, funkt es nicht. Die Kräfte, die zwischen den Basen wirken, sind deutlich schwächer als die, die die Seile zusammenhalten. Das funktioniert in etwa so wie ein Klettverschluss, denn man kann die zwei Teile relativ leicht voneinander trennen.
Das ist ja alles ganz schick, aber warum ist die Aufklärung der DNA-Struktur nun der Mondlandungsmoment der Genetik gewesen? Man wusste mit einem Mal, wie die DNA Informationen speichert: In langen Ketten aus DNA-Bausteinen. Es gibt also eine fixe Anordnung, eine Reihenfolge. Sagen wir so: Wenn Sie wissen, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in einem Buch stehen, können Sie es lesen. Wenn Sie das nicht wissen, haben Sie eine Tüte Buchstabennudeln: Das ist vielleicht appetitlich, aber der Informationsgehalt geht gegen null.
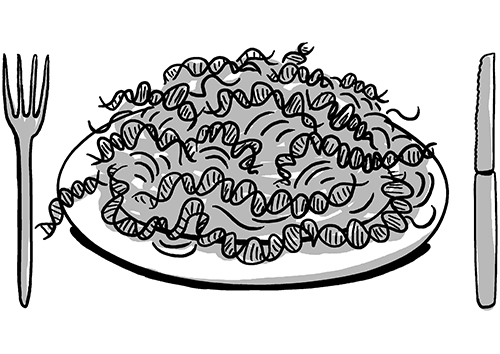
Die Struktur verriet aber noch mehr als das. Denn um eine Reihenfolge festzulegen, würde ja eine Kette völlig reichen. Warum dann aber zwei Stränge? Nun, die beiden Stränge sind nicht unabhängig voneinander: Wenn der eine an einer bestimmten Stelle ein «A» enthält, muss der andere dort ein «T» enthalten. Der zweite Strang ist daher nur eine spiegelbildliche Kopie des ersten. Watson und Crick haben sofort erkannt, wozu dieses Doppelgemoppel gut ist: Ein Strang kann als Vorlage zur Herstellung eines zweiten dienen. Hat man also einen DNA-Doppelstrang und teilt ihn in zwei einzelne Stränge (was ja wegen der «Klettverschluss»-Verbindung zwischen beiden recht gut geht), kann man daraus zwei neue Doppelstränge herstellen und so weiter. Die Struktur hat uns somit auch gezeigt, wie die Vervielfältigung der Erbinformation funktionieren muss.
Das war schon ein großartiger Moment. Wunderbar! Das Geheimnis des Lebens war gelöst! Die Wissenschaft feierte eine rauschende Party mit allem Pipapo.
Im grellen Licht des nächsten Morgens folgte jedoch die Ernüchterung: Man wusste jetzt zwar, wie die DNA im Prinzip aussieht, aber AGTTCGATCCAAGTCT? Das sagt einem jetzt noch nicht direkt, wieso Tante Hedwig sich so einer außerordentlich robusten Gesundheit erfreut oder warum dem Nachbarn die Haare ausgehen. Kurz: Man wusste jetzt zwar, wie die DNA gebaut war, man hatte aber keinen Schimmer, wie die Information von der Zelle genutzt wurde. Was die Wissenschaftler besonders interessierte, war, mit welchem Code die Protein-Bauanleitungen in der DNA gespeichert waren. Immerhin hatte man bereits entdeckt, dass Proteine viele wichtige Funktionen in den Zellen erfüllen. Da zupfte sich mancher den Laborkittel wieder gerade, schüttelte den letzten Rest Konfetti aus dem Haar und ging sich den verkaterten Kopf kratzend zurück ins Labor.
Die Frage nach dem Code verursachte den Biologen über lange Zeit ziemliches Kopfzerbrechen. Man möchte sich da James Watson vorstellen, wie er einsam in einer schummrigen Hotelbar sitzt, den Kopf tief über sein Whiskeyglas gesenkt hält und murmelt: «Dieser mistige Code muss doch zu brechen sein … aber wie? Wie?» – «Entschuldigung», meldet sich da eine schnarrende Stimme mit russischem Akzent, «aber sagten Sie da gerade Codebrechen?» Diese Stimme gehört George Gamow, einem russisch-amerikanischen Physiker, der gerade nach Belegen für die Urknalltheorie suchte. Allerdings war Gamow fasziniert vom Rätsel des genetischen Codes und beschloss zusammen mit Watson, die Sache mal richtig anzugehen. Richtig und mit Stil! Daher gründeten die beiden 1954 den «RNA-Tie-Club» (also den «RNA-Krawatten-Club»). Einen Gentlemen’s-Club für die naturwissenschaftlichen Schwergewichte ihrer Zeit.
Die erklärten Ziele des Clubs waren es herauszufinden, wie die DNA Information codiert, wie man also von der DNA zum Protein kommt und was – wenn überhaupt – die RNA damit zu tun hat. Moment, wieso RNA? Die haben wir Ihnen bisher unterschlagen, aber das korrigieren wir sofort. RNA klingt erst einmal ganz ähnlich wie DNA und ist es auch. Die beiden sind von ihrer Struktur her quasi Geschwister und unterscheiden sich chemisch nur in zwei Dingen: Die RNA verwendet einen leicht anderen Zucker («Ribose» in der RNA statt «Desoxyribose» in der DNA, daher ribonucleic acid, RNA, statt desoxyribonucleic acid, DNA) und ersetzt die Base T (Thymin) durch U (Uracil). Aber wie das bei Geschwistern oft so ist, auch wenn sie sich im Grunde sehr ähnlich sind, verhalten sie sich ganz unterschiedlich. Während die DNA meist in langen Doppelsträngen vorliegt, existiert die RNA in der Regel in einer Unzahl kurzer, einzelsträngiger Stücke, die noch dazu chronisch kurzlebig sind (was heute noch Biologen in die Verzweiflung treiben kann). Damals wusste man über die kleine labile Schwester RNA recht wenig, aber man vermutete, dass sie etwas mit der Herstellung von Proteinen zu tun habe könnte.
Der RNA-Tie-Club war eine vollkommen eigene Welt. Er war eine Institution, die von heutigen Wissenschaftsorganisationen in etwa so weit entfernt ist wie eine Stammtischrunde von der Telekom-Hauptversammlung. Aus heutiger Sicht wirkt er wunderbar kauzig und verschroben. Der Club oder die «RNA-Tie-Bruderschaft», wie Gamow die Gruppe manchmal nannte, bestand aus 20 handverlesenen Mitgliedern, denen je eine der natürlichen Aminosäuren zugeordnet war. Gamow benannte sich nach der ersten Aminosäure im Alphabet: Alanin oder Ala. Watson war «der Pro» (steht für Prolin, aber auch für den Profi … Sie sehen schon: Er war ein bisschen Coolness gegenüber nicht abgeneigt). Crick war natürlich mit von der Partie, und zwar als «Tyr» (Tyrosin. «Tyr» ist allerdings gleichzeitig der Name eines altnordischen Kriegsgotts, dessen wir immer noch einmal die Woche gedenken, denn nach ihm ist der Tyrs Tag = tuesday = Dienstag benannt). Und so ging es weiter. Dann gab es noch vier Ehrenmitglieder, benannt nach den vier DNA-Bausteinen. Jedes Mitglied des Gentlemen’s-Clubs wurde mit einer der namensgebenden Krawatten (schwarz mit einer gelb-grünen Helix; vier US-Dollar das Stück) und einer passenden Krawattennadel mit dem persönlichen Aminosäurekürzel ausgestattet. Schön auch die Organisationsstruktur und die «Ämter». Zum Beispiel gab es einen offiziellen Club-Pessimisten (Crick) und den offiziellen Club-Optimisten (Watson). Wie das wohl in der Praxis aussah? Vielleicht so:
Crick: «Mein Glas ist schon wieder halb leer …»
Watson: «Super – dann passt wieder was rein!»
Die Clubmitglieder schrieben sich untereinander Briefe, um sich auszutauschen, und trafen sich zweimal im Jahr. Dann wurden bei Zigarren, Whiskey und Bier gute und schlechte, aber in der Regel unfertige Ideen hin und her geworfen.
Nachdem für Watson und Crick das Spekulieren ohne eigene Daten bereits sehr erfolgreich gewesen war, machten sie gleich mit Begeisterung weiter. Francis Crick formulierte in den Jahren des RNA-Tie-Clubs so einige Ideen. Die wohl berühmteste davon war die, dass die Information aus Nukleinsäuren (also RNA oder DNA) auf andere Nukleinsäuren übertragen oder zur Produktion von Proteinen genutzt werden kann, während Proteine nicht als Informationsquelle dienen können. Er bezeichnete diese Überlegung als das «zentrale Dogma» der Molekularbiologie, und in den kommenden Jahren zeigte sich, dass er damit (fast immer) richtiglag: Die Information des Erbguts wird in kurzen Happen auf kurzlebige RNA-Moleküle, sogenannte Boten- oder Messenger-RNAs, übertragen, die wiederum als Informationsquelle für die Bildung von Proteinen dienen. Also DNA zu RNA zu Protein. (Es gibt ein paar Ausnahmen, aber dazu später mehr.)
Aber wie war die Information in der DNA gespeichert? Was war der Code? Das, was man 1954 wusste, passte bequem auf einen Bierdeckel: 20 Aminosäuren werden durch vier verschiedene DNA-Bausteine beschrieben. Das war sicher. Sonst gab es nicht viel, mit dem man arbeiten konnte. Aber wenn man so im schummrigen Licht zusammensaß, diskutierte, lachte und trank, war man sich doch ziemlich sicher, dass der eigene genetische Code großartig, perfekt und logisch sein musste. Schließlich war das Leben, das auf ihm fußte, bis in unwirtlichste Ecken der Welt vorgedrungen, von den lichtlosen Tiefen der Ozeane bis hin zum ewigen Eis der höchsten Gipfel. Wenn man sich nun überlegt, wie der beste und logischste Code aussieht, der mit der DNA machbar ist, dann sollte das doch genau der Code sein, den auch das Leben verwendet. Was für eine elektrisierende Herausforderung! Die Mitglieder des Clubs stürzten sich mit Feuereifer darauf. Entsprechend auch ihr Motto: «Do or die, don’t try!», das vom Clubmitglied Max Delbrück geprägt wurde.
Also los! Gamow überlegte, dass man, um 20 Aminosäuren zu codieren, mindestens drei Positionen in der DNA brauchte. Eine Position konnte schließlich von vier verschiedenen Bausteinen belegt sein und somit vier Möglichkeiten unterscheiden. Zwei verbundene Positionen ergaben schon (4 × 4 =) 16 und drei Positionen (4 × 4 × 4 =) 64 Kombinationen. Sydney Brenner (ebenfalls Clubmitglied) konnte später zeigen, dass immer drei zusammenhängende DNA-Positionen ein Codewort für eine Aminosäure bilden, das auch als «Codon» bezeichnet wird. Aber wieso gab es dann genau 20 Aminosäuren, wo es doch 64 mögliche Codierungen gab? Gamow und seine Codeknacker vermuteten, dass es dafür einen Grund gab, ja sogar geben musste. Eine ihrer Theorien war, dass nur die Kombination der DNA-Bausteine im Codon von Bedeutung ist, aber nicht ihre Reihenfolge, und dass alle Codons, die zum Beispiel ein A, ein G und ein C enthalten (AGC, ACG, CGA, CAG, GAC und CGA), dieselbe Aminosäure codieren mussten. Wenn das so ist, ist die Kodierungskapazität nicht 64, sondern 20. Voilà! Quasi zwingende Logik. Gamow und sein Club dachten sich noch viele weitere Theorien aus. Die meisten Ideen waren beeindruckend, komplex, aber leider auch falsch.
Die Lösung des Rätsels kam wieder von jemandem, mit dem keiner gerechnet hatte: Marshall Nirenberg und Heinrich Matthaei vom NIH (National Institutes of Health; USA) – beide waren selbstverständlich keine Mitglieder im Club. Sie konzentrierten sich auch nicht auf hochkomplexe Codemodelle, sondern zeigten mit einem eleganten Experiment, das das RNA-Codon «UUU» die Aminosäure Phenylalanin codiert (übrigens am 15. Mai 1961 um drei Uhr morgens … auch das scheint mal wieder eine Entdeckung zu sein, die ohne Kaffee so nicht möglich gewesen wäre).
Im August desselben Jahres stellte Nirenberg seine Arbeiten auf einem großen Kongress in Moskau vor. Er war erst Mitte dreißig und hatte in seinem Feld noch nicht viel vorzuweisen. Er kannte keinen, und ihn kannte auch niemand. Daher erschien zu seinem Vortrag auch nur eine kleine Gruppe von rund 30 Wissenschaftlern, und selbst die folgten dem Vortrag nicht wirklich mit brennendem Interesse (Nirenberg sagte später, das Publikum hätte keinerlei Regung gezeigt und sei «absolutely dead» gewesen). Es schien fast so, als ob diese große Entdeckung komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden sollte. Aber wie das manchmal ist, Nirenberg hatte am Vorabend Watson getroffen und ihm von seinen Ergebnissen berichtet. Der war skeptisch, aber als «Optimist von Amts wegen» quasi verpflichtet, der Sache nachzugehen. Er bat also einen Bekannten, sich den Vortrag mal anzusehen. Als der ihm berichtete, dass die Daten solide aussahen, gab Watson die Information an Crick weiter, und der brachte den Veranstalter der Konferenz dazu, dass Nirenberg seinen Vortrag am folgenden Tag noch einmal halten durfte. Diesmal jedoch vor rund tausend Zuhörern. Und dann war auf einmal alles ganz anders: Es gab stehende Ovationen, und Nirenberg wurde gefeiert.
Die Beachtung hatte allerdings ihren Preis, denn sie war der Startschuss zu einem neuen wissenschaftlichen Wettrennen mit dem Ziel, die restlichen Codons zu entschlüsseln. Und Nirenberg hätte dieses Rennen wohl gegen etablierte, große Labore verloren, wenn nicht zahlreiche Kollegen aus seinem Institut ihre eigene Arbeit beiseitegelegt hätten, um ihm zu helfen. Manchmal gibt es solche großen Akte der Kollegialität, auch unter Wissenschaftlern.
Nur fünf Jahre später, 1966, kannte man die Bedeutung aller 64 Codons. Wissen Sie, was 1966 noch geschah? Star Trek lief zum ersten Mal im Fernsehen. Und was hätte wohl Spock, dieses spitzohrige Klischee eines Wissenschaftlers, zu dem genetischen Code gesagt, den man jetzt so taufrisch entschlüsselt auf dem Tisch hatte? «Faszinierend» oder «Das ist nicht logisch»? Wahrscheinlich beides, denn der Code wirkte im Vergleich zu den eleganten Modellen des RNA-Tie-Clubs geradezu stümperhaft und unlogisch. Es gab keinen Grund, warum ausgerechnet 20 Aminosäuren codiert werden, und auch keine zwingende logische Verknüpfung zwischen Codons und einzelnen Aminosäuren. Das wirkte alles recht beliebig, und Gamow und seine Kollegen waren von der scheinbaren Banalität ihres eigenen Erbguts sicher enttäuscht. Crick bezeichnete den Code als Zufall, der sich zu Beginn des Lebens ergeben hatte und der seitdem gewissermaßen in der DNA eingefroren war.
Aber zu den Details: Von den 64 Codons werden 61 genutzt, um Aminosäuren zu codieren. Manche von bis zu sechs verschiedenen Codons, andere nur von einem einzigen. (Wenn es in einem Code mehrere Codewörter für ein Klarwort gibt, spricht man übrigens von einem «degenerierten Code» – klingt gar nicht sehr nett.) Die restlichen drei Codons stehen nicht für Aminosäuren, sondern sind «Stopp-Codons», die signalisieren: «Hier ist der Bauplan für das Protein zu Ende, bitte keine weiteren Aminosäuren anhängen!» Den Anfang eines Protein-Bauplans signalisiert das Codon, das auch die Aminosäure Methionin codiert.
Damit wissen wir jetzt, wie der Bauplan aussieht, wir kennen den Anfang, wissen, wie die Aminosäuren codiert werden, und wir kennen das Ende.
Das ist schon mal nicht schlecht, aber der Bauplan allein reicht noch nicht. Stellen Sie sich zum Beispiel Folgendes vor: Sie haben einen Bauplan für eine Tigerfalle: Grabe ein Loch, lege dünne Äste darüber und bringe einen appetitlichen Köder an. Sie packen also den Spaten und legen los. Als Sie Stunden später zufrieden vor Ihrem fertigen Werk stehen und sich Schweiß und Dreck von der Stirn wischen, kommt die Mutter Ihres besten Freundes auf Sie zugestöckelt: «Wo bleibst du denn? Die Hochzeitszeremonie geht gleich los! Und wieso steht die Torte hier draußen ruu
u
u
u
u
ummm(s)!»
Sie sehen das Problem? Der Plan funktioniert hervorragend (wie die zornige Stimme von jenseits der Grasnarbe bestätigt), aber Zeit und Ort waren schlecht gewählt. Bei den Genen ist das genauso. Auch hier ist es enorm wichtig, in welchen Zellen sie wann und wie stark aktiv sind. Wie diese Gen-Regulation funktioniert, wurde in den sechziger Jahren anhand des sogenannten Lac-Operons aufgeklärt.
Bietet man Bakterien (hier wurden Escherichia coli, Darmbakterien, genutzt – das Lieblingsmodellsystem der Molekularbiologie) eine Nährlösung mit Traubenzucker (Glukose) und Milchzucker (Lactose) an, verbrauchen sie zuerst den Traubenzucker, das ist für sie leichter und nahrhafter. Erst wenn der Traubenzucker verbraucht ist, vertilgen sie den Milchzucker.
Auf Gen-Ebene sieht das so aus: Das Lac-Operon enthält Baupläne für Proteine, die dafür sorgen, dass der Milchzucker in die Bakterien aufgenommen und dort verbraucht wird. Die Kontrolle darüber, ob und wie stark diese Pläne zur Herstellung von Proteinen benutzt werden, hat der sogenannte Promotor. Das ist ein DNA-Bereich in unmittelbarer Nähe der Baupläne, der die Funktion einer Schaltzentrale einnimmt. Ist kein Milchzucker in der Zelle vorhanden, ist diese Schaltzentrale blockiert. Verantwortlich dafür ist der Lac-Repressor – ein Protein, das sich auf die DNA setzt und ein Ablesen der Baupläne behindert. Man kann sich den Mechanismus ein bisschen vorstellen wie einen Tag, an dem man versucht, seine E-Mails zu beantworten – und permanent klingelt das Telefon. Das behindert. Die eine oder andere E-Mail wird man dabei schon auf den Weg bringen, aber effizientes Arbeiten ist etwas anderes.
Genauso ist das beim Lac-Operon. Trotz des Repressors wird immer eine kleine Menge der Proteine hergestellt. Solange aber auch Traubenzucker zur Verfügung steht, werden diese Proteine inaktiviert. Erst wenn der Traubenzucker verbraucht ist, kann Milchzucker in die Zelle transportiert werden. Dort angekommen, heftet sich der Milchzucker an den Repressor, der sich daraufhin von der DNA löst. Jetzt ist das Lac-Operon aktiv und produziert mit Vollgas die hier codierten Proteine, und zwar so lange, bis der Milchzucker aufgebraucht ist. Danach setzt sich der Repressor wieder auf den Promotor und schaltet ihn ab.
Wenn Ihnen der Milchzuckerabbau zu trocken ist, haben wir noch ein anderes Beispiel für Genregulation: Superman, ein Gen, das eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der männlichen Merkmale in der Blüte der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) spielt (noch so ein Lieblingsmodell der Biologen – Nicht-Biologen bezeichnen dieses zarte Pflänzchen meist vereinfachend als «Unkraut»). Gehemmt wird die Aktivität von Superman durch das Protein, das im Gen Kryptonite codiert ist. Ach ja, und es existiert auch noch ein weiteres Gen, das Superman sehr ähnlich ist – wenn auch weniger potent. Es hört auf den Namen clark kent.
So funktionieren also unsere Gene. Ein Stück DNA stellt eine kurze RNA her (eine Boten- oder Messenger-RNA, kurz mRNA genannt), die wiederum ein Protein codiert. Und das Protein tut etwas, das eine (vielleicht winzig kleine) Eigenschaft darstellt. Präzise, geradlinig und exakt … Aber so einfach lässt sich das Leben nicht auf den Punkt bringen. Unsere Biologie ist kreativ und erfinderisch. Wenn etwas funktioniert, wird es gemacht. Eine Funktion, die direkt von einer RNA und nicht von einem Protein übernommen wird? Klar, warum nicht. mRNAs nach ihrer Produktion noch einmal zurechtschneiden, um ein verändertes Protein herzustellen? Super Sache! Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen.
Aber wie lautet nun die offizielle Definition des Begriffs «Gen»? Wenn Ihnen da jetzt nicht sofort eine perfekte Formulierung über die Lippen kommt, machen Sie sich nichts daraus. Das ist wirklich schwierig, denn immer wenn man meint, eine gute Definition gefunden zu haben, scheint irgendein Lebewesen einen neuen Spezialfall aus dem Hut zu zaubern. 2006 haben sich daher 25 Wissenschaftler für zwei Tage zusammengesetzt und über einer aktuellen Definition gebrütet. Herausgekommen ist Folgendes: «Ein Gen ist eine lokalisierbare Region genetischen Materials, die einer Vererbungseinheit entspricht, die mit regulatorischen Bereichen, transkribierten und/oder anderen funktionalen Sequenzbereichen verbunden ist.»
Das klingt etwas sperrig und wird bestimmt auch nicht die letzte Definition bleiben. Für unsere Zwecke könnte man vereinfacht sagen: Ein Gen ist ein Stück Erbinformation, die notwendig ist, um eine spezielle Funktion zu erfüllen. Aber halten Sie die Augen auf, wer weiß, wie die Natur diesen Definitionsversuch kontert …
Fest steht, dass die DNA als Informationsträger und die Proteine als operative Einheit die Grundlage für das Leben auf unserer Erde liefern. Unterstützt werden sie von der RNA, die gewissermaßen als Mädchen für alles zwischen DNA und Protein vermittelt, gleichzeitig aber auch Information speichern oder selbst als Enzym wirken kann.
Aber wo kommen RNA, DNA und Proteine eigentlich her? Und wie fügen sie sich zum großen Bild des Lebens zusammen?

Hier stellen wir die Frage: Was war zuerst da? Das Huhn, das Ei oder doch etwas ganz anderes? Außerdem geht es darum, wie Quizmaster entstehen und ob irgendwelche Aliens vielleicht ihren Müll hier vergessen haben.
«Nimm mir doch mal das Gepäck ab.» Tante Hedwig drückt mir lässig ihren bleischweren Koffer, einen tropfnassen geblümten Mantel und einen Hut in die Arme, der eigentlich nur aus einem überromantisierten englischen Film stammen kann. Dann marschiert sie in die Wohnung und sieht sich prüfend um. «Sooo, was machen wir denn heute Schönes?» Alle Beteiligten wissen, dass es sich hierbei um eine rein rhetorische Frage handelt, und so sitzen wir wenig später um den Couchtisch, und Hedwig schlägt das alte Fotoalbum auf. Die Seiten rascheln trocken. Ich werfe verstohlen einen Blick auf die Uhr und dann auf die zwei Alben, die noch ungeöffnet im Koffer liegen. Das kann dauern. Mustere die Kekse, die Hedwig mitgebracht hat. Sehen so aus wie die vom letzten Jahr. Die waren nicht so besonders, schmeckten irgendwie nach komprimiertem Staub vergangener Jahrzehnte. Starre die Dinger eindringlich an und nehme mir vor, sie bei nächster Gelegenheit unauffällig zu entsorgen. Ob die wohl bioabbaubar sind?
«Greif ruhig zu!», sagt Hedwig, die mich beobachtet hat.
Alle Augen ruhen auf mir. Meine Hände werden schweißnass. Mist. Ich nehme also einen Keks und stecke ihn in den Mund. «Lecker, danke!», will ich lügen, aber über ein Geräusch, das irgendwo zwischen einem «Hmmh» und einem Huster liegt, komme ich nicht hinaus. Es sind die Kekse vom letzten Jahr …
«Ach schau, und hier bist du, wie du als kleiner Steppke mal ohne Hose aus der Umkleide ausgebüxt bist … Und hier hat dich der Verkäufer unter dem Arm zurückgebracht, nachdem du den Teppich in der Kinderabteilung eingewässert hast.»
Wehrlos höre ich zu und versuche verzweifelt, genug Spucke zusammenzubekommen, um den Keks zu schlucken. Als ich meine Zunge schließlich wieder einigermaßen frei bewegen kann, hat sich Hedwig schon bis in die Schwarz-Weiß-Ära vorgearbeitet und erzählt peinliche Geschichten von Leuten, deren Verwandtschaft zu lebenden Personen nur unter Zuhilfenahme diverser «Ur»- und «Groß»-Vorsilben zu beschreiben ist.
Die Stunden vergehen, und während draußen langsam die Sonne untergeht, bin ich dankbar dafür, dass Steinzeitmenschen sich noch nicht fotografiert haben, sonst ginge das hier noch weiter bis in die Unendlichkeit, bis: «Und das ist Gorrk mit seiner lieben Tante Urugu. Der ist übrigens eines Nachts schreiend aus seiner Höhle gerannt. Keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall hat ihn da ein Säbelzahntiger erwischt. Tja …»
Wenn man einen Blick zurück in die Vergangenheit wirft, landet man irgendwann bei der Frage nach dem Ursprung des Lebens (und damit auch dem Ursprung der Gene und vielleicht dem allerersten Gen). Wissenschaftlich kann man sich dem mit einem Gedankenexperiment nähern: «Wenn ich eine Schaufel Kohlenstaub in eine Regentonne werfe, ein Fläschchen Ammoniak dazugieße, das Ganze mit heißem Wasser überbrühe und mit ein paar exotischen Salzen abschmecke – wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es plötzlich ‹Plopp› macht und sich ein tropfnasser Günther Jauch aus der Brühe erhebt?»

Was die chemischen Grundbestandteile angeht, ist so ein Mensch wirklich nicht sonderlich kompliziert: In der Hauptsache besteht er aus Wasserstoff und Sauerstoff – beides zusammen zu einem guten Teil in Form von Wasser – sowie Kohlenstoff und Stickstoff. Dazu kommen noch etwas Calcium, Chlor, Phosphor, Kalium, Schwefel, Natrium und Magnesium.
Ist natürlich sehr unwahrscheinlich, denn ein Mensch ist eine hoch organisierte Angelegenheit, die eben nicht einfach so spontan aus Einzelteilen entsteht. (Wenn nicht, gäbe es wahrscheinlich überall Quizmaster, die einen beim Einkaufen mit 500-Euro-Fragen überraschen. Und auch bei dem einen «echten» Günther Jauch, den es gibt, ist davon auszugehen, dass er auf eher konventionellem Wege entstanden ist.) Der Zuwachs an Komplexität ist gewaltig, quasi ein Sprung von der Straße auf das Dach eines Hochhauses. Sofern man kein Cape und eine kräftige Kryptonit-Allergie hat, ist so etwas eigentlich unmöglich – es sei denn, man nimmt die Treppe. Die Treppe ist der Trick! Denn wenn man den unmöglichen Komplexitätssprung in kleine Einzelschritte zerlegt, wird er durchaus machbar.
Lassen Sie uns den Gedanken weiterspinnen. Wenden wir jetzt also den Blick von der herrlichen Aussicht ab, die wir von unserem evolutionären Hochhaus aus genießen und gehen die Treppe hinunter. Jede Stufe führt uns dabei in der Entwicklung zurück. Wir werden kleiner (und haariger …) und haben das dringende Bedürfnis, auf einen Baum zu klettern. Das legt sich aber ein paar Stockwerke später wieder. Schließlich hopsen, kriechen, krabbeln wir zurück in die Brandung eines namenlosen Meeres. Irgendwo, irgendwann verlieren wir das Licht in diesem Ozean, und alles wird dunkel: Wir haben den Punkt erreicht, bevor es Augen gab. Ein guter Moment, um einmal kurz zu verschnaufen und einen Blick zurück auf unsere Augen zu werfen.
Die Entwicklung der Augen war lange Zeit ein Rätsel: Um eine Evolutionsstufe hinaufzusteigen, muss eine zufällige Veränderung auftreten, die zum einen vererbbar ist und die gleichzeitig einen Vorteil bietet. Auf den ersten Blick ist es schwer vorstellbar, wie das beim Auge passiert sein soll. Einerseits ist dieses Organ so komplex, das es kaum in einem Schritt entstanden sein könnte, andererseits: Wie sollte ein halbfertiges Auge funktionieren und einen evolutionären Vorteil bieten? Schon dem britischen Naturforscher Charles Darwin bereitete dieses Problem Kopfzerbrechen, und es war lange Zeit ein Lieblingsargument der Evolutionskritiker.