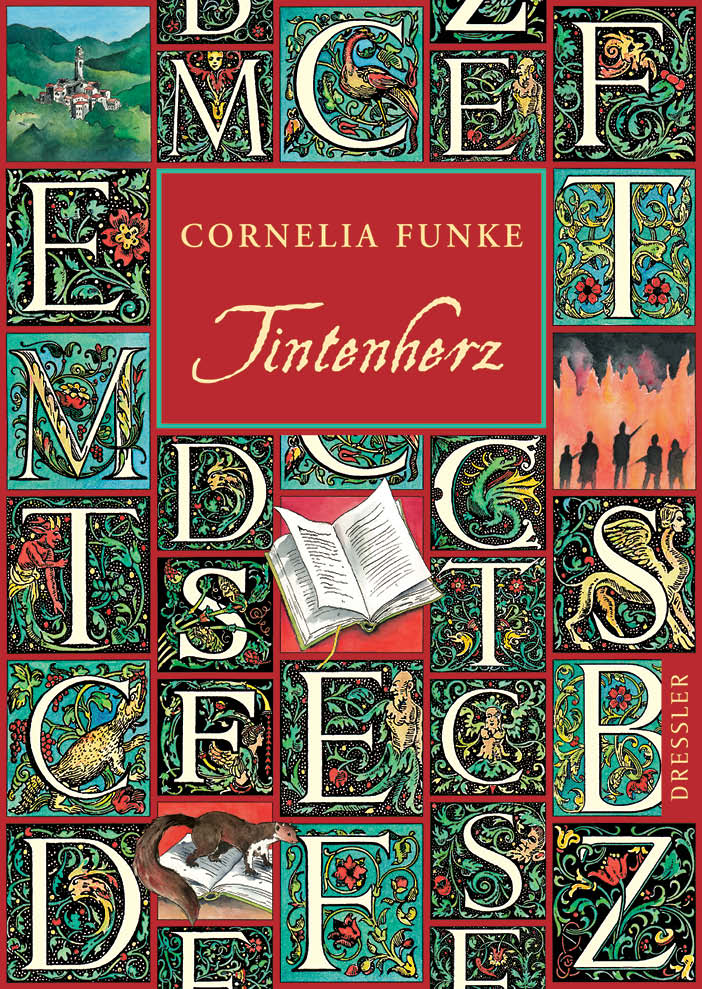
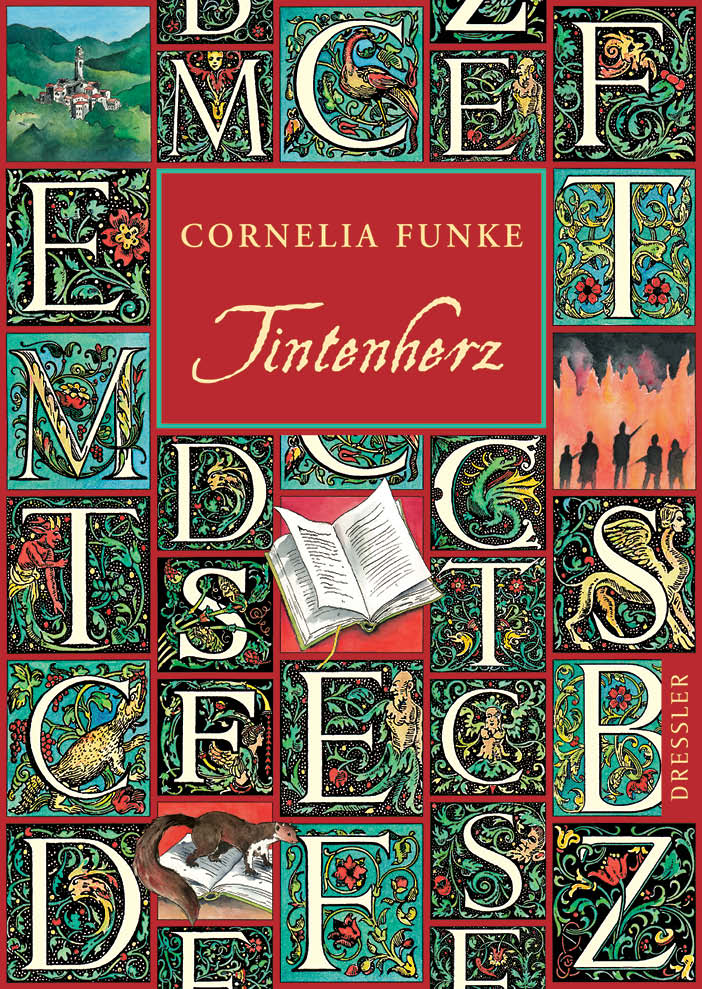
Lust auf mehr?
www.dressler-verlag.de
www.dressler-verlag.de/ebooks


Für Anna, die
sogar den »Herrn der Ringe« zur Seite legte,
um dieses Buch zu lesen. (Kann man mehr
von einer Tochter verlangen?)
Und für Elinor,
die mir ihren Namen lieh,
obwohl ich ihn nicht für eine
Elbenkönigin brauchte.



Kam, kam.
Kam ein Wort, kam,
kam durch die Nacht,
wollte leuchten, wollte leuchten.
Asche.
Asche, Asche.
Nacht.
Paul Celan, Engführung

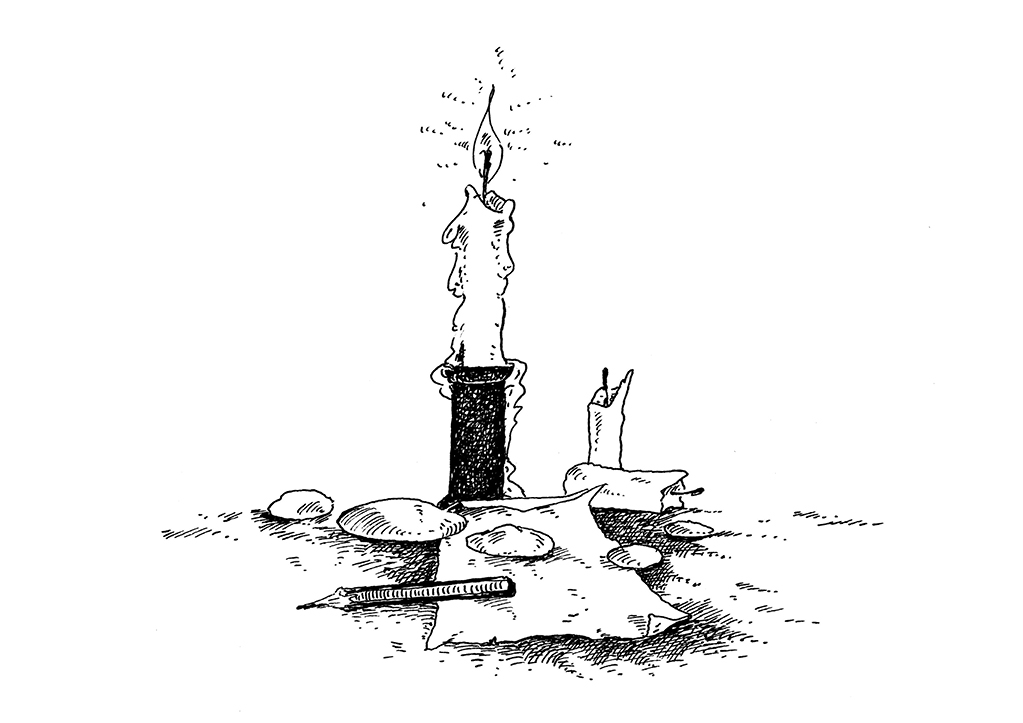

Der Mond schimmerte im Auge des Schaukelpferdes und auch im Auge der Maus, wenn Tolly sie unter dem Kissen hervorholte, um sie anzuschauen. Die Uhr tickte, und in der Stille meinte er kleine nackte Füße über den Boden laufen zu hören, dann Kichern und Wispern und ein Geräusch, als würden die Seiten eines großen Buches umgeblättert.
Lucy M. Boston, Die Kinder von Green Knowe

Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste Meggie bloß die Augen schließen und schon hörte sie ihn, wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften. Irgendwo in der Dunkelheit bellte ein Hund, und Meggie konnte nicht schlafen, sooft sie sich auch von einer Seite auf die andere drehte.
Unter ihrem Kissen lag das Buch, in dem sie gelesen hatte. Es drückte den Einband gegen ihr Ohr, als wollte es sie wieder zwischen seine bedruckten Seiten locken. »Oh, das ist bestimmt sehr bequem, so ein eckiges, hartes Ding unterm Kopf«, hatte ihr Vater gesagt, als er zum ersten Mal ein Buch unter ihrem Kissen entdeckte. »Gib zu, es flüstert dir nachts seine Geschichte ins Ohr.« – »Manchmal!«, hatte Meggie geantwortet. »Aber es funktioniert nur bei Kindern.« Dafür hatte Mo sie in die Nase gezwickt. Mo. Meggie hatte ihren Vater noch nie anders genannt.
In jener Nacht – mit der so vieles begann und so vieles sich für alle Zeit änderte – lag eins von Meggies Lieblingsbüchern unter ihrem Kissen, und als der Regen sie nicht schlafen ließ, setzte sie sich auf, rieb sich die Müdigkeit aus den Augen und zog das Buch unter dem Kissen hervor. Die Seiten raschelten verheißungsvoll, als sie es aufschlug. Meggie fand, dass dieses erste Flüstern bei jedem Buch etwas anders klang, je nachdem, ob sie schon wusste, was es ihr erzählen würde, oder nicht. Aber jetzt musste erst einmal Licht her. In der Schublade ihres Nachttisches hatte sie eine Schachtel Streichhölzer versteckt. Mo hatte ihr verboten, nachts Kerzen anzuzünden. Er mochte kein Feuer. »Feuer frisst Bücher«, sagte er immer, aber schließlich war sie zwölf Jahre alt und konnte auf ein paar Kerzenflammen aufpassen. Meggie liebte es, bei Kerzenlicht zu lesen. Drei Windlichter und drei Leuchter hatte sie auf dem Fensterbrett stehen. Sie hielt das brennende Streichholz gerade an einen der schwarzen Dochte, als sie draußen die Schritte hörte. Erschrocken pustete sie das Streichholz aus – wie genau sie sich viele Jahre später noch daran erinnerte! –, kniete sich vor das regennasse Fenster und blickte hinaus. Und da sah sie ihn.
Die Dunkelheit war blass vom Regen und der Fremde war kaum mehr als ein Schatten. Nur sein Gesicht leuchtete zu Meggie herüber. Das Haar klebte ihm auf der nassen Stirn. Der Regen triefte auf ihn herab, aber er beachtete ihn nicht. Reglos stand er da, die Arme um die Brust geschlungen, als wollte er sich wenigstens auf diese Weise etwas wärmen. So starrte er zu ihrem Haus herüber.
Ich muss Mo wecken!, dachte Meggie. Aber sie blieb sitzen, mit klopfendem Herzen, und starrte weiter hinaus in die Nacht, als hätte der Fremde sie angesteckt mit seiner Reglosigkeit. Plötzlich drehte er den Kopf und Meggie schien es, als blickte er ihr direkt in die Augen. Sie rutschte so hastig aus dem Bett, dass das aufgeschlagene Buch zu Boden fiel. Barfuß lief sie los, hinaus auf den dunklen Flur. In dem alten Haus war es kühl, obwohl es schon Ende Mai war.
In Mos Zimmer brannte noch Licht. Er war oft bis tief in die Nacht wach und las. Die Bücherleidenschaft hatte Meggie von ihm geerbt. Wenn sie sich nach einem schlimmen Traum zu ihm flüchtete, ließ sie nichts besser einschlafen als Mos ruhiger Atem neben sich und das Umblättern der Seiten. Nichts verscheuchte böse Träume schneller als das Rascheln von bedrucktem Papier.
Aber die Gestalt vor dem Haus war kein Traum.
Das Buch, in dem Mo in dieser Nacht las, hatte einen Einband aus blassblauem Leinen. Auch daran erinnerte Meggie sich später. Was für unwichtige Dinge im Gedächtnis kleben bleiben!
»Mo, auf dem Hof steht jemand!«
Ihr Vater hob den Kopf und blickte sie abwesend an, wie immer, wenn sie ihn beim Lesen unterbrach. Es dauerte jedes Mal ein paar Augenblicke, bis er zurückfand aus der anderen Welt, aus dem Labyrinth der Buchstaben.
»Da steht einer? Bist du sicher?«
»Ja. Er starrt unser Haus an.«
Mo legte das Buch weg. »Was hast du vorm Schlafen gelesen? Dr. Jekyll und Mr Hyde?«
Meggie runzelte die Stirn. »Bitte, Mo! Komm mit.«
Er glaubte ihr nicht, aber er folgte ihr. Meggie zerrte ihn so ungeduldig hinter sich her, dass er sich auf dem Flur die Zehen an einem Stapel Bücher stieß. Woran auch sonst? Überall in ihrem Haus stapelten sich Bücher. Sie standen nicht nur in Regalen wie bei anderen Leuten, nein, bei ihnen stapelten sie sich unter den Tischen, auf Stühlen, in den Zimmerecken. Es gab sie in der Küche und auf dem Klo, auf dem Fernseher und im Kleiderschrank, kleine Stapel, hohe Stapel, dicke, dünne, alte, neue … Bücher. Sie empfingen Meggie mit einladend aufgeschlagenen Seiten auf dem Frühstückstisch, trieben grauen Tagen die Langeweile aus – und manchmal stolperte man über sie.
»Er steht einfach nur da!«, flüsterte Meggie, während sie Mo in ihr Zimmer zog.
»Hat er ein Pelzgesicht? Dann könnte es ein Werwolf sein.«
»Hör auf!« Meggie sah ihn streng an, obwohl seine Scherze ihre Angst vertrieben. Fast glaubte sie schon selbst nicht mehr an die Gestalt im Regen … bis sie wieder vor ihrem Fenster kniete. »Da! Siehst du ihn?«, flüsterte sie.
Mo blickte hinaus, durch die immer noch rinnenden Regentropfen, und sagte nichts.
»Hast du nicht geschworen, zu uns kommt nie ein Einbrecher, weil es nichts zu stehlen gibt?«, flüsterte Meggie.
»Das ist kein Einbrecher«, antwortete Mo, aber sein Gesicht war so ernst, als er vom Fenster zurücktrat, dass Meggies Herz nur noch schneller klopfte. »Geh ins Bett, Meggie«, sagte er. »Der Besuch ist für mich.«
Und dann war er auch schon aus dem Zimmer – bevor Meggie ihn fragen konnte, was das, um alles in der Welt, für ein Besuch sein sollte, der mitten in der Nacht erschien. Beunruhigt lief sie ihm nach; auf dem Flur hörte sie, wie er die Kette vor der Haustür löste, und als sie in die Eingangsdiele kam, sah sie ihren Vater in der offenen Tür stehen.
Die Nacht drang herein, dunkel und feucht, und das Rauschen des Regens klang bedrohlich laut.
»Staubfinger!«, rief Mo in die Dunkelheit. »Bist du das?«
Staubfinger? Was war das für ein Name? Meggie konnte sich nicht entsinnen, ihn je gehört zu haben, und doch klang er vertraut, wie eine ferne Erinnerung, die nicht recht Gestalt annehmen wollte.
Zuerst blieb es still draußen. Nur der Regen fiel, wispernd und flüsternd, als habe die Nacht plötzlich eine Stimme bekommen. Doch dann näherten sich Schritte dem Haus, und aus der Dunkelheit tauchte der Mann auf, der auf dem Hof gestanden hatte. Der lange Mantel, den er trug, klebte ihm an den Beinen, nass vom Regen, und als der Fremde in das Licht trat, das aus dem Haus nach draußen leckte, glaubte Meggie für den Bruchteil eines Augenblicks, einen kleinen pelzigen Kopf über seiner Schulter zu sehen, der sich schnüffelnd aus seinem Rucksack schob und dann hastig wieder darin verschwand.
Staubfinger fuhr sich mit dem Ärmel über das feuchte Gesicht und streckte Mo die Hand hin.
»Wie geht es dir, Zauberzunge?«, fragte er. »Ist lange her.«
Mo ergriff zögernd die ausgestreckte Hand. »Sehr lange«, sagte er und blickte dabei an seinem Besucher vorbei, als erwartete er, hinter ihm noch eine andere Gestalt aus der Nacht auftauchen zu sehen. »Komm rein, du wirst dir noch den Tod holen. Meggie sagt, du stehst schon eine ganze Weile da draußen.«
»Meggie? Ach ja, natürlich.« Staubfinger ließ sich von Mo ins Haus ziehen. Er musterte Meggie so ausführlich, dass sie vor Verlegenheit nicht wusste, wo sie hinsehen sollte. Schließlich starrte sie einfach zurück.
»Sie ist groß geworden.«
»Du erinnerst dich an sie?«
»Sicher.«
Meggie fiel auf, dass Mo zweimal abschloss.
»Wie alt ist sie jetzt?« Staubfinger lächelte ihr zu. Es war ein seltsames Lächeln. Meggie konnte sich nicht entscheiden, ob es spöttisch, herablassend oder einfach nur verlegen war. Sie lächelte nicht zurück.
»Zwölf«, antwortete Mo.
»Zwölf? Du meine Güte.« Staubfinger strich sich das tropfnasse Haar aus der Stirn. Es reichte ihm fast bis zur Schulter. Meggie fragte sich, welche Farbe es wohl hatte, wenn es trocken war. Die Bartstoppeln um den schmallippigen Mund waren rötlich wie das Fell der streunenden Katze, der Meggie manchmal ein Schälchen Milch vor die Tür stellte. Auch auf seinen Backen sprossen sie, spärlich wie der erste Bart eines jungen Mannes. Die Narben konnten sie nicht verdecken, drei lange blasse Narben. Sie ließen Staubfingers Gesicht aussehen, als wäre es irgendwann zerbrochen und wieder zusammengesetzt worden.
»Zwölf Jahre alt«, wiederholte er. »Natürlich. Damals war sie … drei, nicht wahr?«
Mo nickte. »Komm, ich gebe dir was zum Anziehen.« Er zog seinen Besucher mit sich, voll Ungeduld, als hätte er es plötzlich eilig, ihn vor Meggie zu verbergen. »Und du«, sagte er über die Schulter zu ihr, »du gehst schlafen, Meggie.« Dann zog er ohne ein weiteres Wort die Tür der Werkstatt hinter sich zu.
Meggie stand da und rieb die kalten Füße aneinander. Du gehst schlafen. Manchmal warf Mo sie aufs Bett wie einen Sack Nüsse, wenn es wieder mal zu spät geworden war. Manchmal jagte er sie nach dem Abendessen durchs Haus, bis sie atemlos vor Lachen in ihr Zimmer entkam. Und manchmal war er so müde, dass er sich auf dem Sofa ausstreckte und sie ihm einen Kaffee kochte, bevor sie schlafen ging. Aber nie, niemals zuvor hatte er sie so ins Bett geschickt wie eben.
Eine Ahnung, klebrig von Angst, machte sich in ihrem Herzen breit: dass mit diesem Fremden, dessen Name so seltsam und doch vertraut klang, etwas Bedrohliches in ihr Leben geschlüpft war. Und sie wünschte sich – mit solcher Heftigkeit, dass sie selbst erschrak –, dass sie Mo nicht geholt hätte und dass Staubfinger draußen geblieben wäre, bis der Regen ihn fortgeschwemmt hätte.
Als die Tür zur Werkstatt noch einmal aufging, schrak sie zusammen.
»Du stehst ja immer noch da«, sagte Mo. »Geh ins Bett, Meggie. Los.« Er hatte diese kleine Falte über der Nase, die nur erschien, wenn ihm etwas wirklich Sorgen machte, und blickte durch sie hindurch, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders. Die Ahnung in Meggies Herzen wuchs und spreizte schwarze Flügel.
»Schick ihn wieder weg, Mo!«, sagte sie, während er sie auf ihr Zimmer zuschob. »Bitte! Schick ihn weg. Ich kann ihn nicht leiden.«
Mo lehnte sich in ihre offene Tür. »Wenn du morgen aufstehst, ist er fort. Ehrenwort.«
»Ehrenwort? Ohne gekreuzte Finger?« Meggie blickte ihm fest in die Augen. Sie sah immer, wenn Mo log – auch wenn er sich noch so viel Mühe gab, es vor ihr zu verbergen.
»Ohne gekreuzte Finger«, sagte er und hielt zum Beweis beide Hände hoch.
Dann schloss er die Tür hinter sich, obwohl er wusste, dass sie das nicht mochte. Meggie presste lauschend das Ohr dagegen. Sie hörte Geschirr klappern. Ah, der Fuchsbart bekam einen Tee zum Aufwärmen. Ich hoffe, er bekommt eine Lungenentzündung, dachte Meggie. Er musste ja nicht gleich daran sterben wie die Mutter ihrer Englischlehrerin. Meggie hörte, wie der Kessel in der Küche pfiff und Mo mit einem Tablett voll klapperndem Geschirr zurück in die Werkstatt ging.
Nachdem er die Tür zugezogen hatte, wartete sie vorsichtshalber noch ein paar Sekunden, auch wenn es ihr schwerfiel. Dann schlich sie wieder hinaus auf den Flur.
An der Tür zu Mos Werkstatt hing ein Schild, ein schmales Blechschild. Meggie kannte die Wörter darauf auswendig. An den altmodisch spitzgliedrigen Buchstaben hatte sie mit fünf Jahren das Lesen geübt:
Manche Bücher müssen gekostet werden,
manche verschlingt man,
und nur einige wenige kaut man
und verdaut sie ganz.
Damals, als sie noch auf eine Kiste hatte klettern müssen, um das Schild zu entziffern, hatte sie geglaubt, dass das Kauen wörtlich gemeint war, und sich voll Abscheu gefragt, warum Mo ausgerechnet die Worte eines Bücherschänders an seine Tür gehängt hatte.
Inzwischen wusste sie, was gemeint war, aber heute, in dieser Nacht, interessierten sie die geschriebenen Wörter nicht. Die gesprochenen Wörter wollte sie verstehen, die geraunten, leisen, fast unverständlichen Wörter, die die beiden Männer hinter der Tür wechselten.
»Unterschätz ihn nicht!«, hörte sie Staubfinger sagen. Seine Stimme klang so anders als Mos Stimme. Keine Stimme klang so wie die ihres Vaters. Mo konnte Bilder mit ihr in die blanke Luft malen.
»Er würde alles tun, um es zu bekommen!« Das war wieder Staubfinger. »Und alles, glaub mir, heißt alles.«
»Ich werde es ihm nie geben.« Das war Mo.
»Aber er wird es so oder so bekommen! Ich sage es dir noch mal: Sie haben deine Spur.«
»Das wäre nicht das erste Mal. Bisher konnte ich sie immer abschütteln.«
»Ach ja? Und wie lange, denkst du, geht das noch gut? Und was ist mit deiner Tochter? Willst du mir etwa erzählen, dass es ihr gefällt, ständig von Ort zu Ort zu ziehen? Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.«
Hinter der Tür wurde es so still, dass Meggie kaum zu atmen wagte, aus Angst, die beiden Männer könnten es hören.
Dann sprach ihr Vater wieder, zögernd, als fiele es seiner Zunge schwer, die Wörter zu formen. »Und was … soll ich deiner Meinung nach tun?«
»Komm mit mir. Ich bring dich zu ihnen!« Eine Tasse klirrte. Ein Löffel schlug gegen Porzellan. Wie groß kleine Geräusche in der Stille werden. »Du weißt, Capricorn hält sehr viel von deinen Talenten, er würde sich sicherlich freuen, wenn du es ihm selber bringst! Der Neue, den er als Ersatz für dich aufgetrieben hat, ist ein furchtbarer Stümper.«
Capricorn. Noch so ein seltsamer Name. Staubfinger hatte ihn hervorgestoßen, als könnte ihm der Klang die Zunge zerbeißen. Meggie bewegte die kalten Zehen. Die Kälte zog ihr schon bis in die Nase und sie verstand nicht viel von dem, was die beiden Männer redeten, doch sie versuchte sich jedes einzelne Wort einzuprägen.
In der Werkstatt war es wieder still geworden.
»Ich weiß nicht …«, sagte Mo schließlich. Seine Stimme klang so müde, dass es Meggie das Herz zusammenzog. »Ich muss nachdenken. Was schätzt du, wann seine Männer hier sein werden?«
»Bald!«
Wie ein Stein fiel das Wort in die Stille.
»Bald«, wiederholte Mo. »Na gut. Dann werde ich mich bis morgen entscheiden. Hast du einen Platz zum Schlafen?«
»Oh, der findet sich immer«, antwortete Staubfinger. »Ich komme inzwischen ganz gut zurecht, obwohl mir immer noch alles zu schnell geht.« Sein Lachen klang nicht fröhlich. »Aber ich würde gern erfahren, wie du dich entscheidest. Ist es dir recht, wenn ich morgen wiederkomme? Gegen Mittag?«
»Sicher. Ich hole Meggie um halb zwei von der Schule ab. Komm danach.«
Meggie hörte, wie ein Stuhl zurückgeschoben wurde. Hastig huschte sie zu ihrem Zimmer zurück. Als die Tür der Werkstatt aufging, zog sie gerade ihre Tür hinter sich zu. Die Decke bis ans Kinn gezogen, lag sie da und belauschte, wie ihr Vater sich von Staubfinger verabschiedete. »Also, danke noch mal für die Warnung!«, hörte sie ihn sagen. Dann entfernten sich Staubfingers Schritte, langsam, stockend, als zögerte er fortzugehen, als hätte er noch nicht alles gesagt, was er sagen wollte.
Doch schließlich war er fort und nur der Regen trommelte immer noch mit nassen Fingern gegen Meggies Fenster.
Als Mo ihre Zimmertür öffnete, schloss sie rasch die Augen und versuchte, so langsam zu atmen, wie man es im tiefsten, unschuldigsten Schlaf tut.
Aber Mo war nicht dumm. Manchmal war er geradezu entsetzlich klug. »Meggie, streck mal einen Fuß aus dem Bett«, sagte er.
Widerstrebend schob sie die immer noch kalten Zehen unter der Decke hervor und legte sie in Mos warme Hand.
»Wusste ich’s doch«, sagte er. »Du hast spioniert. Kannst du nicht wenigstens ein einziges Mal tun, was ich dir sage?« Mit einem Seufzer schob er ihren Fuß zurück unter die köstlich warme Decke. Dann setzte er sich zu ihr aufs Bett, fuhr sich mit den Händen über das müde Gesicht und blickte aus dem Fenster. Sein Haar war dunkel wie Maulwurfsfell. Meggies Haar war blond wie das ihrer Mutter, von der sie nichts als ein paar blasse Fotos kannte. »Sei froh, dass du ihr mehr ähnelst als mir«, sagte Mo immer. »Mein Kopf würde sich gar nicht gut auf einem Mädchenhals machen.« Aber Meggie hätte ihm gern ähnlicher gesehen. Es gab kein Gesicht auf der Welt, das sie mehr liebte.
»Ich hab sowieso nichts von dem verstanden, was ihr geredet habt«, murmelte sie.
»Gut.«
Mo starrte aus dem Fenster, als stünde Staubfinger immer noch auf dem Hof. Dann stand er auf und ging zur Tür. »Versuch, noch etwas zu schlafen«, sagte er.
Aber Meggie wollte nicht schlafen. »Staubfinger! Was ist das überhaupt für ein Name?«, sagte sie. »Und wieso nennt er dich Zauberzunge?«
Mo antwortete nicht.
»Und dann der, der nach dir sucht … ich hab gehört, als Staubfinger es gesagt hat Capricorn. Wer ist das?«
»Niemand, den du kennenlernen solltest.« Ihr Vater drehte sich nicht um. »Ich dachte, du hättest nichts verstanden? Bis morgen, Meggie.«
Diesmal ließ er die Tür offen. Das Licht aus dem Flur fiel auf ihr Bett. Es mischte sich mit dem Schwarz der Nacht, das durchs Fenster hereinsickerte, und Meggie lag da und wartete, dass die Dunkelheit endlich verschwand und das Gefühl von drohendem Unheil mit sich nehmen würde.
Erst viel später begriff sie, dass das Unheil nicht in dieser Nacht geboren worden war. Es hatte sich nur zurückgeschlichen.


»Aber was fangen diese Kinder ohne Geschichtenbücher an?«, fragte Naftali.
Und Reb Zebulun gab zur Antwort: »Sie müssen sich damit abfinden. Geschichtenbücher sind nicht wie Brot. Man kann ohne sie leben.«
»Ich könnte nicht ohne sie leben«, meinte Naftali.
Isaac B. Singer, Naftali, der Geschichtenerzähler, und sein Pferd Sus

Es dämmerte gerade erst, als Meggie aus dem Schlaf fuhr. Über den Feldern verblasste die Nacht, als hätte der Regen den Saum ihres Kleides ausgewaschen. Auf dem Wecker war es kurz vor fünf und Meggie wollte sich auf die Seite drehen und weiterschlafen, als sie plötzlich spürte, dass jemand im Zimmer war. Erschrocken setzte sie sich auf und sah Mo vor ihrem offenen Kleiderschrank stehen.
»Morgen!«, sagte er, während er ihren Lieblingspullover in einen Koffer legte. »Tut mir leid, ich weiß, es ist sehr früh, aber wir müssen verreisen. Wie wär’s mit Kakao zum Frühstück?«
Meggie nickte schlaftrunken. Draußen zwitscherten die Vögel so laut, als wären sie schon seit Stunden wach.
Mo warf noch zwei von ihren Hosen in den Koffer, klappte ihn zu und trug ihn zur Tür. »Zieh dir etwas Warmes an«, sagte er. »Es ist kühl draußen.«
»Wohin verreisen wir?«, fragte Meggie, aber er war schon verschwunden. Verstört warf sie einen Blick nach draußen. Fast erwartete sie, Staubfinger dort zu sehen, doch auf dem Hof hüpfte nur eine Amsel über die regenfeuchten Steine. Meggie stieg in ihre Hose und stolperte in die Küche. Auf dem Flur standen zwei Koffer, eine Reisetasche und die Kiste mit Mos Werkzeug.
Ihr Vater saß am Küchentisch und schmierte Brote. Reiseproviant. Als sie in die Küche kam, sah er kurz auf und lächelte ihr zu, aber Meggie sah ihm an, dass er sich Sorgen machte.
»Wir können nicht verreisen, Mo!«, sagte sie. »Ich hab erst in einer Woche Ferien!«
»Und? Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass ich wegen eines Auftrags wegmuss, während du Schule hast.«
Da hatte er recht. Es kam sogar oft vor: Jedes Mal, wenn irgendein Antiquar, ein Büchersammler oder eine Bibliothek einen Buchbinder brauchte und Mo den Auftrag bekam, ein paar wertvolle alte Bücher von Schimmel und Staub zu befreien oder ihnen ein neues Kleid zu schneidern. Meggie fand, dass die Bezeichnung »Buchbinder« Mos Arbeit nicht sonderlich gut beschrieb, deshalb hatte sie ihm vor ein paar Jahren ein Schild für seine Werkstatt gebastelt, auf dem Mortimer Folchart, Bücherarzt stand. Und dieser Bücherarzt fuhr nie ohne seine Tochter zu seinen Patienten. So war es immer gewesen und so würde es immer sein, gleichgültig, was Meggies Lehrer dazu sagten.
»Wie ist es mit Windpocken? Hab ich die Entschuldigung schon mal benutzt?«
»Letztes Mal. Als wir zu diesem grässlichen Kerl mit den Bibeln mussten.« Meggie musterte Mos Gesicht. »Mo? Müssen wir weg wegen … gestern Nacht?«
Einen Augenblick lang dachte sie, er würde ihr alles erzählen – was immer es da zu erzählen gab. Aber dann schüttelte er den Kopf. »Unsinn, nein!«, sagte er und schob die Brote, die er geschmiert hatte, in einen Plastikbeutel. »Deine Mutter hatte eine Tante. Tante Elinor. Wir waren mal bei ihr, als du ganz klein warst. Sie will schon sehr lange, dass ich ihre Bücher in Ordnung bringe. Sie wohnt an einem der oberitalienischen Seen, ich vergess ständig, welcher es ist, aber es ist sehr schön dort, und es sind höchstens sechs, sieben Stunden Fahrt von hier.« Er sah sie nicht an, während er sprach.
Warum muss das gerade jetzt sein?, wollte Meggie fragen. Aber sie tat es nicht. Sie fragte auch nicht, ob er seine Verabredung am Nachmittag vergessen hatte. Sie hatte zu viel Angst vor den Antworten – und davor, dass Mo sie noch einmal belog.
»Ist sie genauso komisch wie die anderen?«, fragte sie nur. Mo hatte mit ihr schon so einiges an Verwandtschaft besucht. Sowohl seine Familie als auch die von Meggies Mutter war groß und, wie es Meggie vorkam, über halb Europa verstreut.
Mo lächelte. »Ein bisschen komisch ist sie schon, aber du wirst mit ihr klarkommen. Sie hat wirklich wunderbare Bücher.«
»Wie lange sind wir denn weg?«
»Kann schon etwas länger werden.«
Meggie trank einen Schluck Kakao. Er war so heiß, dass sie sich die Lippen verbrannte. Hastig presste sie sich das kalte Messer an den Mund.
Mo schob den Stuhl zurück. »Ich muss noch ein paar Sachen in der Werkstatt zusammenpacken«, sagte er. »Aber es dauert nicht lange. Du bist bestimmt todmüde, aber du kannst ja nachher im Bus schlafen.«
Meggie nickte nur und blickte zum Küchenfenster hinaus. Es war ein grauer Morgen. Über den Feldern, die sich die nahen Hügel hinaufzogen, hing Nebel, und Meggie kam es vor, als hätten sich die Schatten der Nacht zwischen den Bäumen versteckt.
»Pack den Proviant ein und nimm dir genug zum Lesen mit!«, rief Mo aus dem Flur. Als ob sie das nicht immer tat. Vor Jahren schon hatte er ihr eine Kiste für ihre Lieblingsbücher gebaut, für all ihre Reisen, kurze und lange, weite und nicht so weite. »Es tut gut, an fremden Orten seine Bücher dabeizuhaben«, sagte Mo immer. Er selbst nahm auch immer mindestens ein Dutzend mit.
Mo hatte die Kiste rot lackiert, rot wie Klatschmohn, Meggies Lieblingsblume, deren Blüten sich so gut zwischen ein paar Buchseiten pressen ließen und deren Stempel einem Sternmuster in die Haut drückten. Auf den Deckel hatte Mo mit wunderschönen, verschlungenen Buchstaben Meggies Schatzkiste geschrieben und innen war sie mit glänzend schwarzem Futtertaft ausgeschlagen. Von dem Stoff war allerdings kaum etwas zu sehen, denn Meggie besaß viele Lieblingsbücher. Und immer wieder kam ein Buch dazu, auf einer neuen Reise, an einem anderen Ort. »Wenn du ein Buch auf eine Reise mitnimmst«, hatte Mo gesagt, als er ihr das erste in die Kiste gelegt hatte, »dann geschieht etwas Seltsames: Das Buch wird anfangen, deine Erinnerungen zu sammeln. Du wirst es später nur aufschlagen müssen und schon wirst du wieder dort sein, wo du zuerst darin gelesen hast. Schon mit den ersten Wörtern wird alles zurückkommen: die Bilder, die Gerüche, das Eis, das du beim Lesen gegessen hast … Glaub mir, Bücher sind wie Fliegenpapier. An nichts haften Erinnerungen so gut wie an bedruckten Seiten.«
Vermutlich hatte er damit recht. Doch Meggie nahm ihre Bücher noch aus einem anderen Grund auf jede Reise mit. Sie waren ihr Zuhause in der Fremde – vertraute Stimmen, Freunde, die sich nie mit ihr stritten, kluge, mächtige Freunde, verwegen und mit allen Wassern der Welt gewaschen, weit gereist, abenteuererprobt. Ihre Bücher munterten sie auf, wenn sie traurig war, und vertrieben ihr die Langeweile, während Mo Leder und Stoffe zuschnitt und alte Seiten neu heftete, die brüchig geworden waren von unzähligen Jahren und ungezählten blätternden Fingern.
Einige Bücher kamen jedes Mal mit, andere blieben zu Hause, weil sie zum Ziel der Reise nicht passten oder einer neuen, noch unbekannten Geschichte Platz machen mussten.
Meggie strich über die gewölbten Rücken. Welche Geschichten sollte sie diesmal mitnehmen? Welche Geschichten halfen gegen die Angst, die gestern Nacht ins Haus geschlichen war? Wie wäre es mit einer Lügengeschichte?, dachte Meggie. Mo log sie an. Er log, obwohl er wusste, dass sie ihm die Lügen jedes Mal an der Nase ansah. Pinocchio, dachte Meggie. Nein. Zu unheimlich. Und zu traurig. Aber etwas Spannendes sollte schon dabei sein, etwas, das alle Gedanken aus dem Kopf trieb, auch die dunkelsten. Die Hexen, ja. Die Hexen würden mitkommen, die Hexen mit den kahlen Köpfen, die Kinder in Mäuse verwandeln – und Odysseus mitsamt dem Zyklopen und der Zauberin, die aus Kriegern Schweine macht. Gefährlicher als diese Reise konnte ihre doch nicht werden, oder?
Ganz links steckten zwei Bilderbücher, mit denen Meggie sich das Lesen beigebracht hatte – fünf Jahre alt war sie damals gewesen, die Spur ihres unfassbar winzigen, wandernden Zeigefingers war immer noch auf den Seiten zu sehen – und ganz unten, versteckt unter all den anderen, lagen die Bücher, die Meggie selbst gemacht hatte. Tagelang hatte sie an ihnen herumgeklebt und -geschnitten, hatte immer neue Bilder gemalt, unter die Mo schreiben musste, was darauf zu sehen war: Ein Engel mit einem glücklichen Gesicht, von Meggi für Mo. Ihren Namen hatte sie selbst geschrieben, damals hatte sie das e am Schluss immer weggelassen. Meggie betrachtete die ungelenken Buchstaben und legte das kleine Buch zurück in die Kiste. Mo hatte ihr natürlich beim Binden geholfen. Er hatte all ihre selbst gemachten Bücher mit Einbänden aus bunt gemustertem Papier versehen, und für die übrigen hatte er ihr einen Stempel geschenkt, der ihren Namen und den Kopf eines Einhorns auf der ersten Seite hinterließ, mal mit schwarzer, mal mit roter Tinte, je nachdem, wie es Meggie gefiel. Nur vorgelesen hatte Mo ihr nie aus ihren Büchern. Nicht ein einziges Mal.
Hoch in die Luft hatte er Meggie geworfen, auf den Schultern durchs Haus getragen oder ihr beigebracht, wie sie sich aus Amselfedern ein Lesezeichen basteln konnte. Aber vorgelesen hatte er ihr nie. Nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Wort, sooft sie ihm die Bücher auch auf den Schoß gelegt hatte. Also hatte Meggie sich selbst beibringen müssen, die schwarzen Zeichen zu entziffern, die Schatzkiste zu öffnen …
Meggie richtete sich auf.
Etwas Platz war noch in der Kiste. Vielleicht hatte Mo ja noch ein neues Buch, das sie mitnehmen konnte, besonders dick, besonders wunderbar …
Die Tür zu seiner Werkstatt war verschlossen.
»Mo?« Meggie drückte die Klinke herunter. Der lange Arbeitstisch war wie blank gefegt, nicht ein Stempel, nicht ein Messer, Mo hatte wirklich alles eingepackt. Hatte er doch nicht gelogen?
Meggie betrat die Werkstatt und sah sich um. Die Tür zur Goldkammer stand offen. Eigentlich war es nichts als eine Abstellkammer, aber Meggie hatte den kleinen Raum so getauft, weil ihr Vater dort seine wertvollsten Materialien lagerte: das feinste Leder, die schönsten Stoffe, marmorierte Papiere, Stempel, mit denen man Goldmuster in weiches Leder drückte … Meggie schob den Kopf durch die offen stehende Tür – und sah, wie Mo ein Buch in Packpapier einschlug. Es war nicht besonders groß und auch nicht sonderlich dick. Der Einband aus blassgrünem Leinen sah abgegriffen aus, doch mehr konnte Meggie nicht erkennen, denn Mo verbarg das Buch hastig hinter seinem Rücken, als er sie bemerkte.
»Was machst du hier?«, fuhr er sie an.
»Ich …« Meggie war einen Moment sprachlos vor Schreck, so finster war sein Gesicht. »Ich wollte nur fragen, ob du noch ein Buch für mich hast … die in meinem Zimmer habe ich alle gelesen und …«
Mo fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Sicher. Irgendwas finde ich bestimmt«, sagte er, aber seine Augen sagten immer noch: Geh weg. Geh weg, Meggie. Und hinter seinem Rücken knisterte das Packpapier. »Ich komm gleich zu dir«, sagte er. »Ich muss nur noch was einpacken, ja?«
Kurz darauf brachte er ihr drei Bücher. Aber das Buch, das er in Packpapier eingeschlagen hatte, war nicht dabei.
Eine Stunde später trugen sie alles hinaus auf den Hof. Meggie fröstelte, als sie nach draußen kam. Es war ein kühler Morgen, kühl wie der Regen der vergangenen Nacht, und die Sonne hing blass am Himmel, wie eine Münze, die jemand dort oben verloren hatte.
Sie wohnten erst seit knapp einem Jahr auf dem alten Hof. Meggie mochte den Ausblick auf die umliegenden Hügel, die Schwalbennester unterm Dach, den ausgetrockneten Brunnen, der einen so schwarz angähnte, als reichte er geradewegs bis hinunter ins Herz der Erde. Das Haus war ihr immer zu groß und zu zugig gewesen, mit all den leeren Zimmern, in denen fette Spinnen hausten, doch die Miete war günstig und Mo hatte genug Platz für seine Bücher und die Werkstatt. Außerdem gab es einen Hühnerstall neben dem Haus, und die Scheune, in der jetzt nur ihr alter Bus parkte, eignete sich bestens für ein paar Kühe oder ein Pferd. »Kühe muss man melken, Meggie«, hatte Mo gesagt, als sie einmal vorschlug, es doch wenigstens mit zwei oder drei Exemplaren zu versuchen. »Sehr, sehr früh am Morgen. Und jeden Tag.«
»Und was ist mit einem Pferd?«, hatte sie gefragt. »Sogar Pippi Langstrumpf hat ein Pferd, und die hat nicht mal einen Stall.«
Sie wäre auch mit ein paar Hühnern zufrieden gewesen oder einer Ziege, aber auch die musste man jeden Tag füttern, und dafür waren sie zu oft unterwegs. So blieb Meggie nur die orangerote Katze, die ab und zu vorbeigeschlichen kam, wenn es ihr zu anstrengend wurde, sich auf dem Nachbarhof mit den Hunden zu streiten. Der mürrische alte Bauer, der dort wohnte, war ihr einziger Nachbar. Manchmal heulten seine Hunde so jämmerlich, dass Meggie sich die Ohren zuhielt. Zum nächsten Ort, wo sie zur Schule ging und zwei ihrer Freundinnen wohnten, waren es mit dem Rad zwanzig Minuten, aber Mo brachte sie meist mit dem Auto hin, weil es ein einsamer Weg war und die schmale Straße sich an nichts als Feldern und dunklen Bäumen vorbeiwand.
»Himmel, was hast du da reingepackt? Ziegelsteine?«, fragte Mo, als er Meggies Bücherkiste aus dem Haus trug.
»Du sagst es doch selbst immer: Bücher müssen schwer sein, weil die ganze Welt in ihnen steckt«, antwortete Meggie – und brachte ihn zum ersten Mal an diesem Morgen zum Lachen.
Der Bus, der wie ein bunt geschecktes plumpes Tier in der verlassenen Scheune stand, war Meggie vertrauter als alle Häuser, in denen sie mit Mo je gewohnt hatte. Nirgends schlief sie so tief und fest wie in dem Bett, das er ihr in den Bus gebaut hatte. Einen Tisch gab es natürlich auch, eine Kochecke und eine Bank, unter deren Sitzfläche, wenn man sie hochklappte, Reiseführer, Straßenkarten und zerlesene Taschenbücher zum Vorschein kamen.
Ja. Meggie liebte den Bus, aber an diesem Morgen zögerte sie hineinzuklettern. Als Mo noch mal zum Haus zurückging, um die Tür abzuschließen, hatte sie plötzlich das Gefühl, dass sie nie zurückkommen würden, dass diese Reise anders werden würde als all die anderen, dass sie weiter und weiter fahren würden auf der Flucht vor etwas, das keinen Namen hatte. Zumindest keinen, den Mo ihr verriet.
»Also, auf nach Süden!«, sagte er nur, als er sich hinter das Lenkrad klemmte. Und so machten sie sich auf den Weg – ohne von jemandem Abschied zu nehmen, an einem viel zu frühen Morgen, der nach Regen roch.
Doch am Tor wartete Staubfinger schon auf sie.


»Hinter dem Wilden Wald kommt die weite Welt«, sagte die Ratte. »Und die geht uns nichts an, dich nicht und mich auch nicht. Ich war noch nie drin, und ich gehe auch nicht hinein, und du schon gar nicht, wenn du ein bißchen Verstand hast.«
Kenneth Grahame, Der Wind in den Weiden

Staubfinger musste hinter der Mauer an der Straße gewartet haben. Hundertmal und öfter war Meggie darauf hin- und herbalanciert, bis zu den rostigen Torangeln und wieder zurück, mit fest geschlossenen Augen, damit sie den Tiger deutlicher sehen konnte, der am Fuße der Mauer im Bambus lauerte, die Augen gelb wie Bernstein, oder die Stromschnellen, die rechts und links von ihr schäumten.
Jetzt stand nur Staubfinger da. Aber kein anderer Anblick hätte Meggies Herz schneller schlagen lassen. Er tauchte so plötzlich auf, dass Mo ihn fast überfuhr, nur im Pullover, die Arme fröstelnd um den Leib geschlungen. Sein Mantel war wohl noch feucht vom Regen, doch sein Haar war inzwischen getrocknet. Rotblond sträubte es sich über dem narbigen Gesicht.
Mo stieß einen unterdrückten Fluch aus, stellte den Motor ab und stieg aus dem Bus. Staubfinger setzte sein seltsames Lächeln auf und lehnte sich gegen die Mauer. »Wo willst du hin, Zauberzunge?«, fragte er. »Hatten wir nicht eine Verabredung? Auf die Art hast du mich schon einmal versetzt, erinnerst du dich?«
»Du weißt, warum ich es eilig habe«, antwortete Mo. »Es ist derselbe Grund wie damals.« Er stand immer noch neben der offenen Wagentür, angespannt, als könnte er es nicht erwarten, dass Staubfinger endlich aus dem Weg ging.
Aber der tat, als spürte er nichts von Mos Ungeduld. »Darf ich denn diesmal erfahren, wo du hinwillst?«, fragte er. »Beim letzten Mal musste ich vier Jahre lang nach dir suchen, und mit etwas Pech hätten Capricorns Männer dich vor mir gefunden.« Als er zu Meggie hinübersah, starrte sie feindselig zurück.
Mo schwieg eine Weile, bevor er antwortete. »Capricorn ist im Norden«, sagte er schließlich. »Also fahren wir nach Süden. Oder hat er seine Zelte inzwischen woanders aufgeschlagen?«
Staubfinger blickte die Straße hinunter. In den Schlaglöchern schimmerte der Regen der vergangenen Nacht. »Nein, nein!«, sagte er. »Nein, er ist immer noch im Norden. Das ist das, was man hört, und da du dich ja offenbar wieder mal entschlossen hast, ihm nicht zu geben, was er sucht, mache ich mich wohl besser auch schleunigst auf in den Süden. Ich möchte weiß Gott nicht der sein, von dem Capricorns Männer die schlechte Nachricht hören. Wenn ihr mich also ein Stück mitnehmen würdet … Ich bin reisefertig!« Die zwei Taschen, die er hinter der Mauer hervorzerrte, sahen aus, als wären sie bereits ein Dutzend Mal um den Globus gereist. Außer ihnen hatte Staubfinger nur noch seinen Rucksack dabei.
Meggie presste die Lippen aufeinander.
Nein, Mo!, dachte sie. Nein, wir nehmen ihn nicht mit! Aber sie brauchte ihren Vater bloß anzusehen, um zu wissen, dass seine Antwort anders lauten würde.
»Nun komm schon!«, sagte Staubfinger. »Was soll ich Capricorns Männern erzählen, wenn sie mich in die Finger bekommen?«
Verloren wie ein ausgesetzter Hund sah er aus, wie er so dastand. Und sosehr Meggie sich auch Mühe gab, etwas Unheimliches an ihm zu entdecken, im blassen Morgenlicht konnte sie nichts finden. Trotzdem wollte sie nicht, dass er mitkam. Auf ihrem Gesicht war das sicher zu deutlich zu lesen, aber keiner der beiden Männer achtete auf sie.
»Glaub mir, ich würde ihnen nicht lange verheimlichen können, dass ich dich gesehen habe«, fuhr Staubfinger fort. »Und außerdem …«, er zögerte, bevor er den Satz vollendete, »… außerdem bist du mir immer noch was schuldig, oder?«
Mo senkte den Kopf. Meggie sah, wie sich seine Hand fester um die offene Wagentür schloss. »Wenn du es so sehen willst«, sagte er. »Ja, ich nehme an, ich schulde dir was.«
Auf Staubfingers narbigem Gesicht machte sich Erleichterung breit. Schnell warf er sich den Rucksack über die Schulter und kam mit seinen Taschen auf den Bus zu.
»Wartet!«, rief Meggie, als Mo ihm entgegenging, um ihm mit den Taschen zu helfen. »Wenn er mitkommt, will ich erst wissen, warum wir weglaufen. Wer ist dieser Capricorn?«
Mo drehte sich zu ihr um. »Meggie …«, begann er in dem Tonfall, den sie nur zu gut kannte: Meggie, nun sei nicht so dumm. Meggie, nun komm schon.
Sie öffnete die Bustür und sprang hinaus.
»Meggie, verdammt noch mal! Steig wieder ein. Wir müssen los!«
»Ich steig erst wieder ein, wenn du es mir gesagt hast.«
Mo kam auf sie zu, aber Meggie schlüpfte ihm unter den Händen weg und lief durch das Tor auf die Straße.
»Warum sagst du es mir nicht?«, rief sie.
Die Straße lag so verlassen da, als gäbe es keine anderen Menschen auf der Welt. Ein sachter Wind hatte sich erhoben, er strich Meggie übers Gesicht und ließ die Blätter der Linde rauschen, die an der Straße stand. Der Himmel war immer noch fahl und grau, es wollte einfach nicht heller werden.
»Ich will wissen, was los ist!«, rief Meggie. »Ich will wissen, warum wir um fünf Uhr aufstehen mussten und warum ich nicht zur Schule muss. Ich will wissen, ob wir wiederkommen und wer dieser Capricorn ist!«
Als sie den Namen aussprach, sah Mo sich um, als könnte dieser Fremde, vor dem die beiden Männer offenbar so viel Angst hatten, im nächsten Augenblick aus der leeren Scheune treten, ebenso plötzlich, wie Staubfinger hinter der Mauer aufgetaucht war. Aber der Hof war leer und Meggie war zu wütend, um sich vor jemandem zu fürchten, von dem sie nur den Namen kannte. »Sonst hast du mir immer alles gesagt!«, rief sie ihrem Vater zu. »Immer.«
Aber Mo schwieg. »Ein paar Geheimnisse hat jeder, Meggie«, sagte er schließlich. »Und jetzt steig endlich ein. Wir müssen los.«
Staubfinger musterte erst ihn und dann Meggie mit ungläubigem Gesicht. »Du hast ihr nichts erzählt?«, hörte Meggie ihn mit gesenkter Stimme fragen.
Mo schüttelte den Kopf.
»Aber etwas musst du ihr sagen! Es ist gefährlich, wenn sie nichts weiß. Schließlich ist sie kein kleines Kind mehr.«
»Es ist auch gefährlich, wenn sie es weiß«, antwortete Mo. »Und es würde nichts ändern.«
Meggie stand immer noch auf der Straße. »Ich hab alles gehört, was ihr da redet!«, rief sie. »Was ist gefährlich? Ich steige nicht ein, bevor ich es nicht weiß.«
Mo sagte immer noch nichts.
Staubfinger sah ihn einen Moment lang unschlüssig an, dann stellte er seine Taschen wieder ab. »Also gut«, sagte er. »Dann erzähle ich ihr von Capricorn.«
Langsam kam er auf Meggie zu. Sie machte unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Du bist ihm schon begegnet«, sagte Staubfinger. »Es ist lange her, du wirst dich nicht erinnern, du warst noch so klein.« Er hielt die Hand auf Kniehöhe. »Wie soll ich dir erklären, wie er ist? Wenn du sehen müsstest, wie eine Katze einen jungen Vogel frisst, würdest du vermutlich weinen, nicht wahr? Oder versuchen, ihm zu helfen. Capricorn würde den Vogel an die Katze verfüttern, nur um zu sehen, wie sie ihn mit ihren Krallen zerreißt, und das Schreien und Zappeln des kleinen Dings würde ihm schmecken wie Honig.«
Meggie stolperte noch einen Schritt zurück, aber Staubfinger kam weiter auf sie zu.
»Ich nehme nicht an, dass du Spaß daran hast, Menschen Angst zu machen, bis ihre Knie so sehr zittern, dass sie kaum noch stehen können?«, fragte er. »Capricorn findet an nichts mehr Vergnügen. Du glaubst vermutlich auch nicht, dass du dir alles, was du willst, einfach nehmen kannst, egal wie, egal wo. Capricorn glaubt das schon. Und bedauerlicherweise besitzt dein Vater etwas, das er unbedingt haben will.«
Meggie blickte zu Mo hinüber, aber der stand nur da und sah sie an.
»Capricorn kann keine Bücher binden wie dein Vater«, fuhr Staubfinger fort. »Er versteht sich auf nichts besonders gut, nur auf das eine: das Angstmachen. Darin ist er der Meister. Er lebt davon. Obwohl ich glaube, dass er selbst gar nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Angst einem die Glieder lähmt und kleinmacht. Aber er weiß ganz genau, wie man sie ruft und verbreitet, in Häusern und Betten, in Herzen und Köpfen. Seine Männer tragen die Angst aus wie schwarze Post, sie schieben sie unter die Türen und in die Briefkästen, pinseln sie an Mauern und Stalltüren, bis sie sich ganz von selbst verbreitet, lautlos und stinkend wie die Pest.« Staubfinger stand jetzt ganz dicht vor Meggie. »Capricorn hat viele Männer«, sagte er leise. »Die meisten sind bei ihm, seit sie Kinder waren, und sollte Capricorn einem von ihnen befehlen, dir ein Ohr oder die Nase abzuschneiden, so wird der es ohne ein Wimpernzucken tun. Sie kleiden sich gern schwarz wie die Saatkrähen, nur ihr Anführer trägt ein weißes Hemd unter der rußschwarzen Jacke, und solltest du jemals einem von ihnen begegnen, dann mach dich klein, ganz klein, damit sie dich vielleicht übersehen. Verstanden?«
Meggie nickte. Sie konnte kaum atmen, so heftig schlug ihr Herz.
»Ich kann verstehen, dass dein Vater dir nie von Capricorn erzählt hat«, sagte Staubfinger und blickte sich zu Mo um. »Ich würde meinen Kindern auch lieber von netten Menschen erzählen.«
»Ich weiß, dass es nicht nur nette Menschen gibt!« Meggie konnte nicht verhindern, dass ihre Stimme vor Ärger zitterte. Vielleicht war auch etwas Angst dabei.
»Ach ja? Woher?« Da war es wieder, das rätselhafte Lächeln, traurig und überheblich zugleich. »Hast du es etwa schon einmal mit einem richtigen Bösewicht zu tun gehabt?«
»Ich hab von ihnen gelesen.«
Staubfinger lachte auf. »Nun, stimmt, das ist fast dasselbe«, sagte er. Sein Spott brannte wie Brennnesselgift. Er beugte sich zu Meggie herunter und sah ihr ins Gesicht. »Ich wünsche dir trotzdem, dass es beim Lesen bleibt«, sagte er leise.
Mo verstaute Staubfingers Taschen ganz hinten im Bus. »Ich hoffe, du hast da nichts drin, was uns um die Ohren fliegen könnte«, sagte er, während Staubfinger sich hinter Meggies Sitz hockte. »Bei deinem Handwerk würde mich das nicht wundern.«
Bevor Meggie fragen konnte, was für ein Handwerk das war, öffnete Staubfinger seinen Rucksack und hob behutsam ein verschlafen blinzelndes Tier heraus. »Da wir offenbar eine längere gemeinsame Reise vor uns haben«, sagte er zu Mo, »möchte ich deiner Tochter jemanden vorstellen.«
Fast so groß wie ein Kaninchen war das Tier, aber viel schlanker, mit einem Schwanz, der buschig wie ein Pelzkragen gegen Staubfingers Brust drückte. Es bohrte schmale Krallen in seinen Ärmel, während es Meggie mit glänzend schwarzen Knopfaugen musterte, und als es gähnte, entblößte es nadelspitze Zähne.
»Das ist Gwin«, erklärte Staubfinger. »Wenn du willst, kannst du ihm die Ohren kraulen. Er ist gerade sehr schläfrig, da wird er schon nicht beißen.«
»Tut er das sonst?«, fragte Meggie.
»Allerdings«, sagte Mo, während er sich wieder hinter das Steuer schob. »Wenn ich du wäre, würde ich die Finger von dem kleinen Biest lassen.«
Aber Meggie konnte von keinem Tier die Finger lassen, selbst wenn es noch so spitze Zähne hatte. »Es ist ein Marder oder so was, stimmt’s?«, fragte sie, während sie vorsichtig mit den Fingerspitzen über eins der runden Ohren strich.
»So etwas in der Art.« Staubfinger griff in die Hosentasche und schob Gwin ein Stück trockenes Brot zwischen die Zähne. Meggie kraulte den kleinen Kopf, während er kaute – und stieß mit den Fingerspitzen auf etwas Hartes unter dem seidigen Fell: winzige Hörner, gleich neben den Ohren. Erstaunt zog sie die Hand zurück. »Marder haben Hörner?«
Staubfinger zwinkerte ihr zu und ließ Gwin zurück in den Rucksack klettern. »Der hier schon«, sagte er.
Meggie beobachtete verwirrt, wie er die Riemen zuzog. Sie glaubte, Gwins Hörnchen immer noch unter den Fingern zu spüren.
»Mo, wusstest du, dass Marder Hörner haben?«, fragte sie.
»Ach was, die hat Staubfinger dem bissigen kleinen Teufel angeklebt. Für seine Vorstellungen.«
»Was für Vorstellungen?« Meggie sah erst Mo und dann Staubfinger fragend an, aber Mo ließ nur den Motor an und Staubfinger zog seine Stiefel aus, die eine ebenso weite Reise hinter sich zu haben schienen wie seine Taschen, und streckte sich mit einem tiefen Seufzer auf Mos Bett aus. »Kein Wort, Zauberzunge«, sagte er, bevor er die Augen schloss. »Ich verrate nichts über deine Geheimnisse, aber dafür plauderst du auch nicht die meinen aus. Außerdem muss es für dieses erst dunkel werden.«
Meggie zerbrach sich bestimmt eine Stunde lang immer noch den Kopf darüber, was diese Antwort bedeuten könnte. Aber noch mehr beschäftigte sie eine andere Frage.
»Mo«, fragte sie, als Staubfinger hinter ihnen zu schnarchen begann, »was will dieser … Capricorn von dir?« Sie senkte die Stimme, bevor sie den Namen aussprach, als könnte sie ihm damit etwas von seiner Bedrohlichkeit nehmen.
»Ein Buch«, antwortete Mo, ohne den Blick von der Straße zu wenden.
»Ein Buch? Warum gibst du es ihm nicht?«
»Das geht nicht. Ich werd es dir bald erklären, aber nicht jetzt. In Ordnung?«
Meggie blickte aus dem Busfenster. Die Welt, die vorbeizog, sah schon jetzt fremd aus – fremde Häuser, fremde Straßen, fremde Felder, selbst die Bäume und der Himmel sahen fremd aus, aber daran war Meggie gewöhnt. Noch nie hatte sie sich an einem Ort wirklich zu Hause gefühlt. Mo war ihr Zuhause, Mo und ihre Bücher und vielleicht noch dieser Bus, der sie von einem fremden Ort zum anderen brachte.
»Diese Tante, zu der wir fahren«, fragte sie, als sie durch einen endlos langen Tunnel fuhren, »hat sie Kinder?«
»Nein«, antwortete Mo. »Und ich fürchte, sie mag sie auch nicht besonders. Aber wie gesagt, du wirst schon mit ihr klarkommen.«
Meggie seufzte. Sie erinnerte sich an einige Tanten, und mit keiner war sie sonderlich gut klargekommen.
Aus den Hügeln waren Berge geworden, die Hänge zu beiden Seiten der Straße wurden immer schroffer, und irgendwann sahen die Häuser nicht nur fremd, sondern anders aus. Meggie versuchte, sich die Zeit zu vertreiben, indem sie die Tunnel zählte, doch als der neunte sie verschluckte und die Dunkelheit gar kein Ende nehmen wollte, schlief sie ein. Sie träumte von Mardern in schwarzen Jacken und einem Buch in braunem Packpapier.

»Mein Garten bleibt mein Garten«, sagte der Riese, »alle verstehen das, und niemand soll darin spielen als ich.«
Oscar Wilde, Der selbstsüchtige Riese

Meggie wachte davon auf, dass es still war.
Das gleichmäßige Brummen des Motors, das sie in den Schlaf gelullt hatte, war verstummt, und der Fahrersitz neben ihr war leer. Meggie brauchte einige Zeit, bis sie sich erinnerte, warum sie nicht in ihrem Bett lag. An der Windschutzscheibe klebten winzige tote Fliegen, und der Bus parkte vor einem Eisentor. Es sah Furcht einflößend aus mit all den matt glänzenden Spitzen, ein Tor aus Spießen, das nur darauf wartete, dass jemand versuchte, sich hinüberzuschwingen und zappelnd daran hängen blieb. Sein Anblick erinnerte Meggie an eine ihrer Lieblingsgeschichten, die vom selbstsüchtigen Riesen, der keine Kinder in seinem Garten haben wollte. Genau so hatte sie sich sein Tor immer vorgestellt.
Mo stand auf der Straße, zusammen mit Staubfinger. Meggie stieg aus und lief zu ihnen. Die Straße grenzte zur Rechten an einen dicht bewachsenen Abhang, der steil abfiel zum Ufer eines großen Sees. Die Hügel auf der anderen Seite ragten aus dem Wasser wie Berge, die darin ertrunken waren. Das Wasser war fast schwarz, am Himmel machte sich schon der Abend breit und spiegelte sich dunkel in den Wellen. In den Häusern am Ufer flammten die ersten Lichter auf wie Glühwürmchen oder herabgefallene Sterne.
»Schön, nicht wahr?« Mo legte Meggie den Arm um die Schultern. »Du magst doch Räubergeschichten. Siehst du die Burgruine da? Auf der hat mal eine berüchtigte Räuberbande gehaust. Ich muss Elinor danach fragen. Sie weiß alles über diesen See.«
Meggie nickte nur und lehnte den Kopf gegen seine Schulter. Ihr war schwindlig vor Müdigkeit, aber Mos Gesicht war zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch nicht mehr dunkel vor Sorge. »Wo wohnt sie denn nun?«, fragte sie und verkniff sich ein Gähnen. »Doch wohl nicht hinter dem Stacheltor da, oder?«
»O doch. Das ist der Eingang zu ihrem Grundstück. Nicht sehr einladend, stimmt’s?« Mo lachte und zog Meggie über die Straße. »Elinor ist sehr stolz auf dieses Tor. Sie hat es eigens anfertigen lassen, nach einem Bild in einem Buch.«
»Ein Bild vom Garten des selbstsüchtigen Riesen?«, murmelte Meggie, während sie durch die kunstvoll verschlungenen Eisenstäbe lugte.
»Der selbstsüchtige Riese?« Mo lachte. »Nein, ich glaube, es war eine andere Geschichte. Obwohl die sehr gut zu Elinor passen würde.«
An das Tor grenzten zu beiden Seiten hohe Hecken, die jede Sicht auf das, was hinter ihnen lag, mit dornigen Zweigen verwehrten. Aber auch durch die Eisenstäbe konnte Meggie außer ausladenden Rhododendronbüschen und einem breiten Kiesweg, der bald zwischen ihnen verschwand, nichts Verheißungsvolles entdecken.
»Das sieht nach reicher Verwandtschaft aus, nicht wahr?«, raunte Staubfinger ihr ins Ohr.