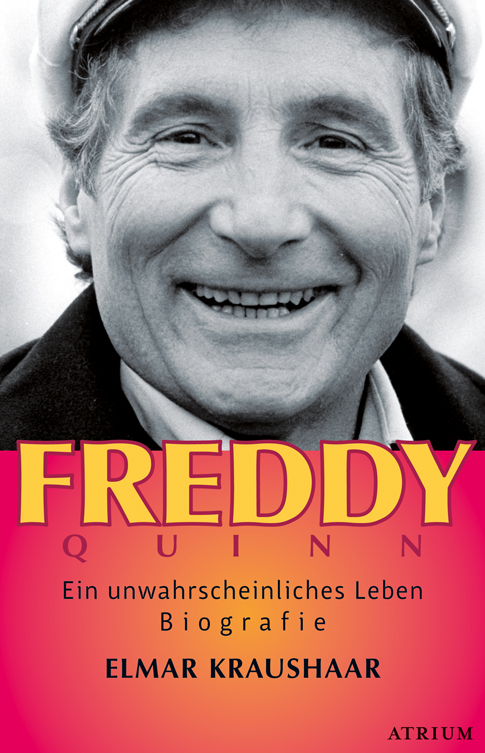
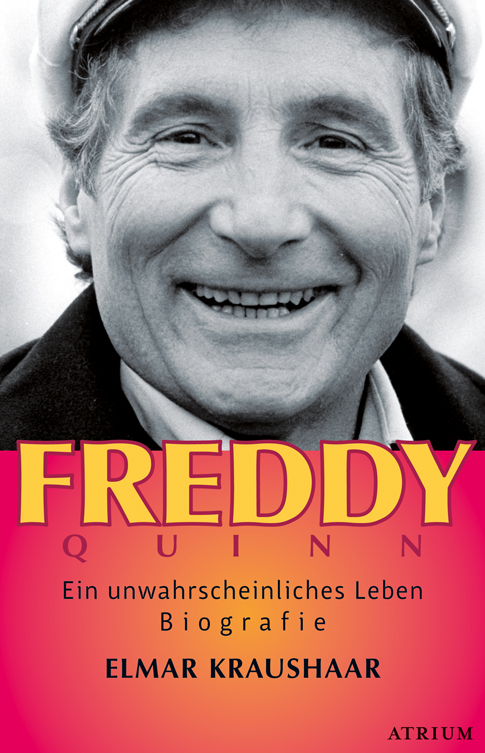
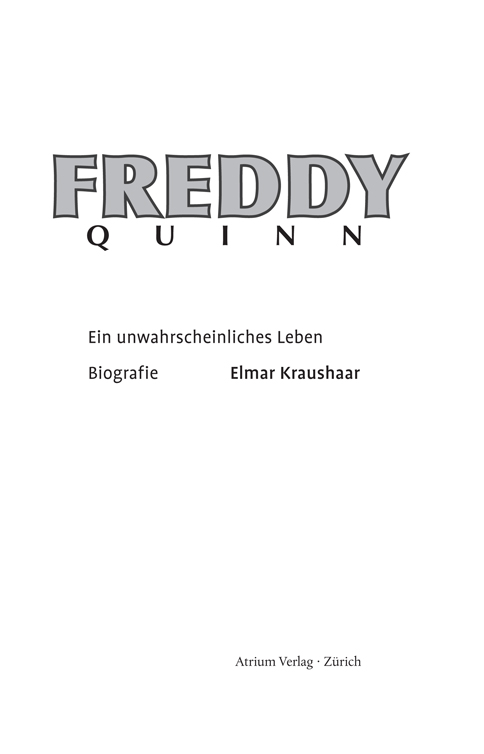
»Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.«
Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein
Es ist laut geworden zum Schluss. »Ich will nicht, dass Sie über mich schreiben!«, schreit Freddy Quinn ins Telefon. »Ich werde dagegen vorgehen! Und ich werde nicht mit Ihnen kooperieren! Sie wollen doch nur wieder Lügen über mich verbreiten wie all die anderen Journalisten auch! Und außerdem«, jetzt wird er noch lauter, »Ihnen geht es doch nur um das große Geld mit meinem Namen!« Jetzt reicht es mir aber. Was bildet sich dieser Mann ein? Glaubt er wirklich, dass sein Name immer noch eine Garantie ist für die schnelle Mark? Ich reiße mich zusammen, verabschiede mich wortkarg und lege auf.
Das war also mein vorläufig letztes Telefongespräch mit Freddy Quinn im April 2005. Ein unerfreuliches Gespräch. Mit dem Anwalt hat er mir gedroht, falls ich über ihn schreibe, über die Paparazzi geklagt, die angeblich Tag und Nacht sein Haus belagern, über Deutschland geschimpft, in dem nur Neider und Denunzianten leben. Nein, Freddy Quinn mag die Journalisten nicht, mag keine Leute, die zu viele Fragen stellen, meidet die Öffentlichkeit, wenn es um seine Person und seine Geschichte geht. »Kein Wort über die drei Bs«, lautet sein Standardspruch: »Nichts über das Bett, die Bank und das Beten!« »Könnte es sein, dass du hinter einem Paravent lebst?«, hat ihn Joachim Fuchsberger mal in einer Talkshow gefragt und damit zum Ausdruck gebracht, wie wenig die Öffentlichkeit eigentlich weiß von Freddy Quinn. Obwohl laut einer Umfrage rund achtundneunzig Prozent aller Deutschen seinen Namen kennen. Was für eine Diskrepanz!
Dabei hatte es so interessant angefangen. Nachdem ich im Laufe meiner Berufsjahre schon einige Male über Freddy Quinn geschrieben hatte, sollte ich ihn im Dezember 1994 kennenlernen. Ich war mit der Bitte um ein Interview an ihn herangetreten, im Auftrag von Bear Family Records, die die Wiederveröffentlichung seiner Lieder auf CD planten und der Box ein Porträt des Sängers beilegen wollten. Nach einigem Hin und Her war ein Termin zustande gekommen, wir trafen uns in einem Restaurant am Stadtrand von Hamburg, unweit – wie ich später erfuhr – von dem Haus, in dem er lebt. Zunächst aßen wir gemeinsam, mit dabei waren seine – so wurde sie mir vorgestellt – Managerin Lilli Blessmann sowie die Haushälterin. Kaum war das Essen serviert, zeigte mir Freddy Quinn zum ersten Mal die Rote Karte. Mit einem Nicken in die Runde hatte ich allen einen »Guten Appetit!« gewünscht und wollte mit der Suppe beginnen. »Was fällt Ihnen eigentlich ein?«, fuhr er mich an: »Wir sind hier Gäste von Frau Blessmann, und nur sie kann uns einen ›Guten Appetit‹ wünschen. Was haben Sie nur für ein Benehmen!« Das kann ja heiter werden, dachte ich bei mir und blieb fortan auf der Hut.
Nach dem Essen, Lilli Blessmann und die Haushälterin hatten sich verabschiedet, zogen Freddy Quinn und ich uns zurück in ein Nebenzimmer des Restaurants. Ich hatte noch nicht Platz genommen, da öffnete Quinn mit großer Geste einen Aktenkoffer, den er die ganze Zeit über bei sich getragen hatte. Der legendäre Koffer! Oft hatte ich schon von ihm gehört, über ihn gelesen. »Mein Fluchtgepäck!«, wie er gerne sagt. »Da habe ich alles drinnen. Ich kann jederzeit verschwinden.« Der Sänger hatte ihn immer dabei, wenn er zu den Journalisten ging, vollgestopft mit amtlichen Papieren und wichtigen Briefen, die beweisen sollten, dass er ist, wer er ist. »Hier ... und ... hier ... und ... hier!«, sagte er jetzt laut zu mir und holte ein Blatt nach dem anderen aus dem Koffer, lauter Kopien offizieller Dokumente, wie ich bei genauerem Hinsehen feststellte, der »Staatsbürgerschaftsnachweis« der Republik Österreich, sein Reisepass, sein Waffenschein. Alle ausgestellt auf den Namen Manfred Freddy Quinn. Geboren in Wien. Am 27. September 1931. »Damit Sie mir glauben, dass ich Quinn heiße, Quinn und nichts anderes, nicht Nidl und nicht Petz oder was sonst noch für Namen kursieren.« Und dann begannen wir mit unserer Arbeit. Er erzählte mir sein Leben, routiniert und mit den richtigen Pausen an den richtigen Stellen. Ein Profi eben, der so oft schon sein Leben erzählt hat, oder das, was er dafür hält.
Manchmal unterbrach er abrupt seinen Redefluss, sah mich mit großen Augen an und polterte los: »Was stellen Sie mir eigentlich für Fragen? Warum erzähle ich Ihnen das alles? Verschwinden Sie!« Erschrocken stand ich auf, packte ganz schnell Notizblock und Aufnahmegerät ein und verließ den Raum. Ich hatte noch nicht das Lokal verlassen, da stand Quinn schon hinter mir und bat mich wieder herein. Ich setzte mich, packte meine Sachen wieder aus, und er erzählte weiter, so als sei nichts gewesen. Das wiederholte sich noch zweimal im Laufe dieses Nachmittags, jetzt blieb ich aber gleich sitzen und wartete ab, bis sich sein Ton wieder normalisiert hatte. »Alles in allem ein nettes Gespräch«, sagte ich zum Schluss, Heucheln gehört zum Handwerk. »Finde ich auch«, sagte er, und: »Heben Sie Ihre Notizen und die Bänder gut auf, vielleicht können wir mal ein Buch daraus machen.« Um Gottes willen, dachte ich bei mir, nur das nicht – und habe doch alle Kassetten und Aufzeichnungen aufgehoben.
Für die Arbeit an diesem Buch habe ich seitdem immer wieder meine Notizen durchgeblättert und die Bänder abgehört, wieder und wieder, dazu unzählige Porträts, Interviews, Berichte und Nachrichten mit und über Freddy Quinn aus Archiven zusammengesucht und gelesen, abgehört, angeschaut. Einmal, zweimal und noch mal und noch mal. Die Geschichte hatte mich gepackt. So viele Widersprüche waren in den verschiedenen Darstellungen aufgetaucht, so viele Zeitläufte, die nicht zueinander passten, so viele Namen und Daten, die immer wieder neu gemischt und neu verteilt wurden. Wie war das nur möglich? Da gehört einer zu den Topstars in diesem Land seit Jahrzehnten, bekannt wie kaum ein Zweiter, mit Liedern, die längst Kulturgut geworden sind und ins kollektive Gedächtnis dieser Nation gehören, niemand hat so viele Tonträger verkauft wie er, auf der Liste der Künstler mit den meisten Nummer-eins-Hits in Deutschland liegt er immer noch auf Platz zwei, knapp hinter den Beatles und noch vor ABBA, und seine alten Filme werden ständig im Fernsehen wiederholt. Im Sommer 2010 wählten die Zuschauer des NDR ihn auf Platz zwei der »bedeutendsten Norddeutschen«, knapp hinter Altkanzler Helmut Schmidt, im Jahr 2003 wurde seine »La Paloma«-Interpretation in einer ARD-Abstimmung zum »Jahrhundert-Hit« der Deutschen gekürt, und im oberfränkischen Coburg ist bereits zu seinen Lebzeiten ein Platz nach Freddy Quinn benannt worden. Selbst nachkommende Generationen entdecken ihn immer wieder neu, als Kultfigur, als Zeitzeugen, als Idol der Eltern und Großeltern. Stefan Remmler, einer der Protagonisten der sogenannten Neuen Deutschen Welle, hat ein ganzes Album nur mit Quinn-Liedern aufgenommen: Projekt F – Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle; Quinns »Heimweh«, gecovert von Element of Crime, gehört zum Soundtrack des Kultfilms Die fetten Jahre sind vorbei; und Götz Alsmann begrüßt in seiner TV-Show Zimmer frei Freddy Quinn enthusiastisch mit »Mein Held!«.
Trotzdem ist der Superstar ein Fremder geblieben, umflort von der Legende des Einsamen, Weitgereisten, Heimatlosen. Ganz so, wie es seinem Image entspricht, dem Bild des Seemanns, der jederzeit bereit ist, seinen Seesack zu schultern und wieder auf große Fahrt zu gehen, des Naturburschen, der sich um keine Konventionen schert und noch nie eine Krawatte um den Hals trug. Aber wer ist Freddy Quinn eigentlich? Woher kommt er? Wohin gehört er? Wo ist er geboren? Wer sind seine Eltern? Wie ist er aufgewachsen? Wer hat ihm nur die vielen Fremdsprachen beigebracht und wer das Gitarrenspiel? Gibt es eine Frau in seinem Leben? Oder einen Mann? Fragen über Fragen, so viele haben sich über die Jahre daran versucht, auch Freddy Quinn hat sie immer wieder brav beantwortet. Aber Zweifel bleiben, weil die eine Antwort nicht zur anderen passt, weil die Antworten so stereotyp daherkommen, als gäbe es kein Leben in ihnen, weil ständig neue Antworten auftauchen. Erinnerungen klaffen auseinander, so als steckten Mogeleien dahinter und Lügen, aufgebauschte Details oder große Dramen, die gekonnt heruntergespielt werden. »Die Lügen und die Halbwahrheiten kommen von den Journalisten und den Produzenten«, behauptet Freddy Quinn gerne in Interviews, so als sei er das Opfer von Verleumdungen – und damit ist für ihn der Fall erledigt.
Nein, eine Biografie schaut anders aus. Darin kann man nachlesen, wer wann wo geboren ist, wie die Vorfahren heißen und vielleicht sogar, wer die erste Liebe war. Nicht einmal diese Standards lassen sich so einfach beantworten für Freddy Quinn. Deshalb folgt hier keine Biografie, keine im klassischen Sinne, eine Spurensuche eher oder die Beschreibung der vielfältigen Versuche, sich einem Leben zu nähern und einem Phänomen, das von vielen Geschichten umstellt ist, Potemkinschen Dörfern gleich, deren Fassaden zusammenbrechen, kaum stößt man daran, um Platz zu machen für neue Geschichten und kleine und große Geheimnisse.
1. Die Sonne schafft es kaum durch die Wolken, aber es ist warm in Niederösterreich. Ein Freitag im August, die Straßen sind fast leer in Niederfladnitz, einer kleinen Ortschaft hoch oben im Norden der Republik. Die Grenze zu Tschechien ist ganz nah, und der Wein soll besonders gut sein in der Region. Die Stadt Retz, eines der Zentren des sogenannten Weinviertels, ist nur ein paar Kilometer entfernt, und an den Sommerwochenenden startet von dort der »Reblaus-Express« – mit Halt in Niederfladnitz.
Mit einer Fotografie in der Hand suche ich die Dorfstraße ab, auf dem Bild das Haus, in dem Freddy Quinn geboren worden sein soll. Vor mehr als zwanzig Jahren hatte der Wiener Fanklub des Sängers eine Busreise nach Niederfladnitz unternommen und dabei diese Aufnahme gemacht. In sicherer Entfernung waren die Anhänger damals geblieben, hatten sich nicht getraut, an der Haustür zu klingeln, denn Quinns Halbschwester lebte in dem Haus, so gingen die Gerüchte, und die sollte nicht gestört werden.
Niemand begegnet mir, den ich jetzt fragen könnte, ein Lkw biegt um die Ecke mit Waren für den kleinen Lebensmittelladen in der Mitte der Ortschaft. Ich suche weiter in den Nebenstraßen, die ungepflastert sind und nicht geteert, und stehe mit einem Mal vor dem Haus. Tannen schützen das Gebäude vor allzu neugierigen Blicken, der Bau ist schmucklos und flach, mit heruntergezogenem Dach, wie so viele in der Region. Die Fenster sind gesichert mit gusseisernen Gittern, das fällt ebenso auf wie ein turmartiger Anbau über zwei Stockwerke. Nein, hier möchte niemand gestört werden, das ganze Anwesen demonstriert Abwehrhaltung, im Kontrast zu den Häusern in der Nachbarschaft. Ein Videospion ist neben der Türklingel angebracht, und natürlich macht mir keiner auf.
Ich gehe zurück an die große Kreuzung in der Ortsmitte, hier muss es doch ein Gemeindeamt geben oder einen Bürgermeister, irgendeine offizielle Stelle, die mir bestätigen kann, dass Freddy Quinn einst hier auf die Welt kam, hier gelebt hat oder aufgewachsen ist. Die Verkäuferin trägt einen weißen Kittel und räumt gerade das Kühlregal in dem Lebensmittelgeschäft ein, sie ist freundlich und hilfsbereit: »Ja, der Bürgermeister, der könnte Ihnen vielleicht weiterhelfen. Wenn Sie sich beeilen, dann erwischen Sie ihn noch. Er hat in Pleissing seine Sprechstunde bis 12 Uhr.« Ich bin noch rechtzeitig im Nachbardorf, aber der Bürgermeister ist unterwegs. Ein Angestellter erreicht ihn auf dem Handy, und der Bürgermeister rät mir, mich an den alten Rockenbauer zu wenden, der kenne sich aus, der wisse Bescheid.
Zurück in Niederfladnitz mache ich mich erneut auf die Suche. Als ich klingele, öffnet mir Otto Rockenbauer sofort, so als habe er hinter dem hohen Hoftor auf Besuch gewartet. »Da war schon mal einer da, vor zehn Jahren, der wollte auch was über den Fredy wissen«, sagt er und bittet mich auf die gemütliche Bank im Innenhof. »Fredy« nennt er ihn, nicht Freddy, und erzählt weiter: »Ja natürlich weiß ich, dass der Fredy hier geboren wurde, hundertprozentig!« Rockenbauer schaut mich von der Seite an, ein bisschen misstrauisch, so als müsse er auf der Hut sein. »Wissen Sie, ich bin Jahrgang 1928, nur drei Jahre älter als der Fredy. Als kleine Buben haben wir zusammen auf der Straße gespielt. Der wurde hier geboren, ganz sicher.« Und dann erzählt er mir noch ein bisschen aus der Familiengeschichte des Fredy, so wie man sie sich hier im Dorf erzählt: dass seine Großmutter – »sie war eine Baronin, wissen Sie!« – einen Herrn aus Niederfladnitz kennengelernt habe und wegen ihm aus Wien gekommen sei, dass ihre Tochter – »die Mutter vom Fredy« – auch öfter hier gewesen sei, aber nach der Geburt wieder zurück sei in die Stadt, der Fredy aber die Ferien immer bei der Großmutter verbracht habe, und dass schließlich die Frau Baronin das Haus an ihre Enkelin, die Halbschwester vom Fredy, vererbt habe: »Sie wohnt heute noch hier, mit ihrem Mann. Aber sonst wissen wir nicht viel, denn eigentlich, eigentlich, sind die ja nicht von hier.«
Es scheint, als sei die Familie des Freddy Quinn nicht sehr beliebt in Niederfladnitz, ich frage hier noch nach und dort, und es gibt nicht viel zu erzählen: »Sie kaufen ja nicht einmal ein hier im Ort!«, sagt eine, und man sehe sie nur selten, sagt ein anderer. »Es ist schon mehr als zehn Jahre her«, erzählt die Wirtin vom Gasthof Angerer, »da sollte der Freddy mal hier singen. Aber das hat er natürlich nie gemacht.« Er käme schon hin und wieder ins Dorf, um die Schwester zu besuchen: »Aber davon erfährt man erst, wenn er schon wieder weg ist.« Es ist ruhig in Niederfladnitz, ein bisschen verschlafen fast, zwei Radtouristen kommen vorbei, mit Isomatte und Rucksack hintendrauf. »Wissen Sie«, fügt die Wirtin hinzu, »ich glaub, der schämt sich für seinen Geburtsort, Niederfladnitz kennt ja auch keiner.« Im Tanzsaal des Gasthofs ist ein Flohmarkt aufgebaut, ohne eine Schallplatte von Freddy Quinn weit und breit. Und bald ist Kürbisernte hier, das wird gefeiert.
2. Pula ist weit. Auch hier soll Freddy Quinn geboren worden sein, so steht es jedenfalls in den Presseberichten der ersten Jahre seiner Karriere. Die größte Stadt auf der Adria-Halbinsel Istrien gehörte einst zu Österreich und wurde ab 1867 Hauptstützpunkt der k.u.k. Kriegsmarine. 1918 kamen die Italiener nach Istrien, im Londoner Vertrag von 1915 war die Region Rom versprochen worden, um es zum Kriegseintritt an der Seite der Alliierten zu bewegen. Italiener wurden angesiedelt, die kroatische Sprache im öffentlichen Leben verboten, Italienisch offizielle Landessprache. Heute gehört Pula wieder zu Kroatien, und die früheren Besatzer bilden nur noch eine kleine Minderheit.
In den Artikeln über Freddys Geburtsort Pula wird immer wieder ein Bild gezeigt mit dem angeblichen Geburtshaus darauf, eine kleine, windschiefe Kate mit einem Zaun davor und einem Huhn. Und wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man ein kleines Kind vor dem Toreingang des Hauses, es könnte ein Junge sein, aber genauso gut auch ein Mädchen, mit weißen Strümpfen bis zu den Knien. Der Vater sei Italiener gewesen, ein italienischer Kaufmann, heißt es weiter in den Berichten, und die Mutter kam aus Wien.
3. Von Pula ist nicht mehr die Rede, als 1960 Freddy Quinns erste »Autobiografie« erscheint – Lieder, die das Leben schrieb. Das reich bebilderte Fan-Buch, aufgeschrieben von Quinns damaligem Komponisten und Produzenten, Lotar Olias, bildet die Grundlage für alle weiteren Medienberichte über ihn. Wo er nun tatsächlich geboren wurde, steht nicht in diesem Buch, aber später einigen sich alle Journalisten und der Sänger selbst auf Wien: Geboren am 27. September 1931 in der Laudongasse 10 im achten Wiener Gemeindebezirk, der Josefstadt. Der Bezirk heißt so seit 1700, als Wien das gerade erworbene Gelände zu Ehren des damaligen Kronprinzen und späteren Kaisers Joseph I. umbenannte. Der Adel siedelte sich anschließend hier an, das Viertel wurde Gartenstadt und Sommeraufenthalt in einem.
Heute ist der achte Bezirk ein typisches Wohnviertel mit vielen Bürgerhäusern, die noch vor 1919 erbaut wurden. So eines ist auch das Haus Nummer 10 in der Laudongasse. Rosa Philomena Nidl, geborene Schich, lebte hier, die Großmutter von Freddy Quinn. Ihre Tochter, Edith Henriette Aloysia, geboren am 14. Mai 1910, war schwanger geworden während eines Aufenthalts in Hamburg. Sie war in die Hansestadt gekommen, um sich bei einer Tageszeitung, dem Hamburger Fremdenblatt, zur Journalistin ausbilden zu lassen. Gerade mal einundzwanzig Jahre alt und unverheiratet, kam sie im Sommer 1931 hochschwanger zurück nach Wien und suchte Schutz und Hilfe bei ihrer Mutter. Nur wenige Tage nach der Niederkunft wurde der Neugeborene am 8. Oktober von Pater Guido Wirth in der Heiligen Dreifaltigkeitskirche in der Alser Vorstadt getauft: Manfred Franz Eugen Helmuth Nidl. Fünfundvierzig Jahre später kommt Freddy Quinn einmal mit einem Kamerateam zurück in die Laudongasse 10. Als er die Treppen hinaufsteigt, fällt es ihm schwer zu reden: »Man sollte nicht länger in der Vergangenheit wühlen«, sagt er. »Denn da kommen Emotionen auf, mit denen man gar nicht fertigwerden könnte.«
Drei Geburtsorte stehen also zur Auswahl, für den einen bürgen die Nachbarn, der andere soll auf einem Foto zu sehen sein, und den dritten schließlich nennt – nach langem Schweigen – Freddy Quinn selbst. Um endlich Klarheit zu gewinnen, müssten doch offizielle Stellen weiterhelfen können. Doch da ist der Datenschutz vor. Im Wiener Rathaus komme ich nicht weiter: »Nein, Sie haben keinen Anspruch darauf, Einblick in den Taufschein zu nehmen, sofern er denn bei uns lagert. Dazu muss der Gesuchte seine Einwilligung geben.« In der Pfarrkanzlei der Heiligen Dreifaltigkeitskirche ist man nicht ganz so streng. Ein Blick in den Computer bestätigt, Freddy Quinn hat 1931 in der Laudongasse 10 gewohnt und wurde an dem bekannten Datum hier getauft. Aber geboren? »Darüber geben uns unsere Unterlagen leider keine Auskunft.« Vielleicht kann mir das Archiv der Diözese St. Pölten weiterhelfen, denn hier könnte auch der Geburts- oder Taufschein aufbewahrt sein, falls Freddy Quinn in Niederfladnitz geboren wurde. Die Pfarrei des Ortes ist schon seit Langem aufgelöst, und die Personenstandsregister der Kirchengemeinde wurden nach St. Pölten geschafft. »Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Ihnen keine Auskunft geben«, so die freundliche, aber bestimmte Abfuhr auch hier. Ganz sicher sind sich jedoch die Autoren der Internetseiten der Stadtgemeinde Hardegg. Niederfladnitz ist eine von zehn Katastralgemeinden, die zusammen Hardegg bilden, laut Eigenwerbung »vielfach als kleinste Stadt Österreichs genannt«. Sehenswürdigkeiten – heißt es weiter auf der Homepage – gibt es einige in Hardegg, die gleichnamige Burg, das Barockschloss Riegersburg und die Ruine der Burg Kaja. Und unter der Überschrift »Söhne und Töchter der Stadt« ist nur einer aufgeführt: »Freddy Quinn (* 1931 in Niederfladnitz), Schlagersänger und Musiker«. Um alle Zweifler seinerseits zu überzeugen, hat Freddy Quinn einmal in einem Zeitungsinterview seine Mutter als Kronzeugin aufgerufen: »Am Totenbett hat sie mir geschworen: ›Du bist in Wien geboren, du brauchst dir keine Sorgen zu machen.‹«
Die Identität der Mutter ist einigermaßen geklärt. Einigermaßen deshalb, weil nur wenig bekannt geworden ist über sie. Edith Nidl, spätere Edith Henriette Baronin Petz, hat nie den Prominentenstatus ihres Sohnes genutzt, um selbst an die Öffentlichkeit zu gehen. Interviews mit ihr sind nicht bekannt, nur selten sieht man sie auf Fotos in den Zeitschriften und Journalen. Als einmal – im Jahr 1965 – ein Journalist es wagt, an ihrer Wohnungstür zu klingeln, wird er kühl abgefertigt: »Frau Baronin ist nicht da, sie ist verreist«, verleugnet sich Frau Baronin: »Ich bin nur die Untermieterin.« Das wenige, was man über sie weiß, hat Freddy Quinn erzählt: Journalistenausbildung in Hamburg, später Autorin und Herausgeberin der Wiener Tierpost. Andere, die sie kennengelernt haben, beschreiben sie als eine selbstbewusste, gut aussehende Frau, dunkler Typ, tatkräftig und voller Lebensfreude.
Aber wer ist der Vater? Nach der Mutter scheint ihn niemand je zu Gesicht bekommen zu haben, außer Freddy Quinn selbst. Die einzigen Schilderungen, die es über den Vater des Sängers gibt, stammen ausschließlich von ihm. Wie ein weißer Fleck auf der Landkarte die wildesten Fantasien provoziert, so gibt es auch unzählige Geschichten, Spekulationen und Vermutungen über den Vater – von Freddy Quinn erzählt, von Plattenproduzenten erfunden, von Journalisten zusammengereimt. Dass Freddy Quinn seinen Vater nie kennengelernt hat, wird vermutet, oder dass er ein Offizier gewesen sei beim Österreichischen Bundesheer, auch ein orthopädischer Schuhmacher aus Wien machte die Runde. Quinn selbst, dessen Image und Karriere ganz eng verknüpft ist mit der Hansestadt Hamburg, will, wenn schon nicht an der Waterkant geboren, so doch zumindest dort gezeugt worden sein. Das erzählt er immer wieder gerne und lächelt verschmitzt dabei.
In den ersten Jahren der Karriere – die Version vom Geburtsort Pula ist noch im Umlauf – ist in der Presse von einem italienischen Vater die Rede. Eine Quinn’sche Standard-Antwort taucht gleichlautend in fast allen Berichten der frühen Jahre auf: »Was für ein Landsmann ich bin? Da fängt’s schon an, kompliziert zu werden. Sagen wir ein in Jugoslawien geborener Austro-Italiener, denn meine Mutter ist aus Wien, mein Vater aus Italien.« Im März 1962 erzählt Freddy Quinn »Sybille«, der Reporterin der Film-Revue, die Version vom »italienischen Exportkaufmann«, weigert sich aber, dessen Namen preiszugeben. Und wo es offenbar kein wirkliches Leben zu erzählen gibt, setzt die Kolportage ein: Als einzige Erinnerung an seinen Vater schildert Quinn der Reporterin eine Szene wie aus einem Film: »Ich stand auf dem Bahnsteig und winkte dem Zug nach, in dem er fortfuhr, ich muss damals etwa vier Jahre alt gewesen sein – es war bis heute das letzte Mal, dass ich ihn sah ...« Dass dieselbe Begebenheit – der endgültige Abschied vom Vater – auch ganz anders ausgesehen haben könnte, beschreibt ein namenloser Autor vier Jahre zuvor im Teenager-Magazin Bravo: »An Bord eines hohen Truppentransporters steht verloren ein schmächtiger Junge von fünfzehn Jahren. Er sucht sich einen freien Platz an der dicht umlagerten Reling. Da unten! Der Mann in dem hellen Regenmantel und dem hochgestellten Kragen, das ist sein Vater. Doch sein Vater entdeckt ihn nicht in der Menge, er winkt ziellos in die falsche Richtung. Der Nebel verschluckt den Mann im Regenmantel, verschluckt die verschwommene Silhouette New Yorks. Amerika? Nur noch eine Nebelwand, hinter der die Erinnerung liegt.« Und der fünfzehnjährige Freddy muss – so die Bravo-Version – nach neun Jahren Aufenthalt beim Vater in New York wieder zurück nach Wien.
Freddy Quinn spricht im Laufe der Jahre nicht mehr so oft vom »italienischen Vater«, stattdessen wird künftig die Betonung auf die »irische Herkunft« gelegt – schließlich muss der Nachname des Künstlers erklärt werden: »Ich heiße Quinn wie mein Vater, dessen Vorfahren aus Irland stammen.« Schon 1963, in der zweiten Auflage der »Autobiografie« Lieder, die das Leben schrieb, wird die Nationalität des Vaters offengelassen, zum Zeitpunkt von Freddys Geburt aber sei dieser in Italien auf Reisen gewesen. Wenigstens das. Die Herkunft des Vaters wird immer wieder variiert, in der Talkshow Heut‘ abend von Joachim Fuchsberger stellt sich 1985 der Gast Quinn als Kosmopolit vor: »Mein Großvater war Ire, meine Großmutter Tschechin, mein Vater Triestiner Amerikaner und meine Mutter Wienerin.« In einer anderen Talkshow, zehn Jahre später, spricht er wieder vom italienischen Vater, der in die USA ausgewandert sei. Einmal, 1973 in einem Interview mit der Bild-Zeitung, wird er gefragt: »Erinnern Sie sich an Ihren leiblichen Vater?«, und er antwortet kurz und knapp: »Flüchtig. Ich glaube, er hieß Willy. Oder?«
Trotzdem geht die Geschichte mit dem vermeintlichen Vater weiter: Die Eltern sollen geheiratet haben, 1934, da war der kleine Manfred gerade drei. Sechs Monate später folgt schon die Scheidung, und der Vater nimmt – so erzählt es Freddy Quinn bis heute – seinen Sohn mit auf Urlaubsreise, mit dem Schiff nach Amerika. Aus dem Urlaub wird ein USA-Aufenthalt von drei Jahren, die Freddy mit seinem Vater in Morgantown in West Virginia verbringt. Hier soll der kleine Österreicher sogar zur Schule gegangen sein, ein Jahr Grundschule, auf der er Englisch lernt mit breitem amerikanischem Akzent, außerdem Gitarre und bugle, eine Art Trompete ohne Ventile. Sonst gibt es nichts zu berichten aus West Virginia, nie hat Morgantown ein Gesicht in den Erzählungen von Freddy Quinn, keinen Geruch, keine Farbe. Wie haben sie dort gelebt, sein Vater und er? Zu zweit? Bei Verwandten? In Begleitung eines Journalisten fährt Freddy Quinn 1983 noch einmal nach Morgantown für ein Filmporträt. Die Schule steht nicht mehr, erzählt ein Taxifahrer, und Freddy steht dann vor einer anderen Schule, vor einem Gebäude aus den 1970er-Jahren. Da könnte die Schule gestanden haben, die er einmal besucht haben will, oder auch nicht. »Hier bin ich vor fast fünfzig Jahren zur Schule gegangen«, erzählt der Besucher zwei Jungs, die gerade auf dem Hof der Schule Basketball spielen. Aber sie wenden sich ab und kümmern sich nicht um den Fremden.
1938 muss der kleine Manfred wieder zurück nach Europa, nach Wien. Der Mutter wird das Sorgerecht zugesprochen. Hatte vorher der Vater das Sorgerecht? Wenn ja, warum? Oder hat er seinen Sohn in die USA entführt? Warum hat die Mutter darauf nicht reagiert und nach ihrem Sohn – beispielsweise – fahnden lassen? Auch diese Fragen lassen sich nicht klären. Aber vielleicht hat diese USA-Reise gar nicht stattgefunden, vielleicht hat der kleine Manfred Quinn nie Morgantown in West Virginia gesehen, vielleicht hat er dort nie eine Schule besucht. Von denen, die sich noch an seine Kinder- und Jugendjahre erinnern können, hat keiner ihn je davon erzählen hören, weder von dem Vater noch von der Schule. Höchst ungewöhnlich, dass ein Kind seinen Spielkameraden nie davon erzählt haben soll, dass es in einem anderen Land bereits zur Schule ging. Heute gibt es elf Grundschulen, Elementary Schools, in Morgantown, ich habe sie alle angeschrieben und nach einem Manfred (Freddy) Quinn oder Manfred Nidl gefragt. Eine einzige Antwort habe ich bekommen, von der übergeordneten Schulbehörde des Bezirks Monongalia County: »Wir haben alle Mikrofilme aus besagtem Zeitraum überprüft, aber wir haben leider keinen Eintrag über einen Schüler mit diesem Namen gefunden.« Das trägt auch nicht zur Klärung des Sachverhaltes bei. Noch ein anderes Detail der Geschichte muss angezweifelt werden: Edith Nidl ist nach österreichischem Recht nie mit einem Herrn Quinn verheiratet gewesen, laut Archivauskunft des Standesamtes Innere Stadt in Wien wird sie zum ersten Mal am 27. Juli 1939 getraut.
Dass die Kindheit ganz anders ausgesehen haben könnte, davon ist in »Heimweh-Freddy« die Rede, einer Artikelserie über den »Rattenfänger aus der Josefstadt«, die 1958 im Wiener Kurier erscheint. Da werden Begebenheiten geschildert, die zu alltäglich erscheinen, als dass man sie erfunden hätte – wie der dreijährige Freddy bei einer Kindervorstellung im Wiener Stadttheater unbedingt dem Zauberer assistieren will, wie der fünfjährige Freddy bei einem Heurigennachmittag am Fuß des Kahlenberges auf einen Tisch steigt und »I kumm aus Grinzing« singt, wie der sechsjährige Freddy bei einem Ausflug im Türkenschanzpark sich von seiner Mutter losreißt und einen Spaziergänger mit Fotoapparat bittet, ihn doch zu fotografieren. Die Anekdote aus dem Stadttheater erzählt Freddy Quinn heute noch gerne, schließlich hatte er damals seinen ersten Auftritt vor einem Publikum: »Ich war also mit meiner Mutter in einer Märchenvorstellung im Stadttheater. Ein Zauberer agierte gerade auf der Bühne und bat, ein Kind aus dem Saal möge doch zu ihm nach oben kommen und ihm assistieren. Kaum hatte er das ausgesprochen, raste ich auch schon nach vorne, ging auf die Bühne und verbeugte mich als Erstes. Der Zauberer machte seine Tricks, holte Wasser aus meinem Bauch, und jedes Mal verbeugte ich mich. Das muss so lustig ausgesehen haben, dass sich die Zuschauer köstlich amüsierten und mir Beifall klatschten.«

Der kleine Manfred zu Hause in Wien
Freddys Jugendfreund Erhard Hassek hat den ganz kleinen Manfred noch nicht gekannt, und doch erinnert er sich an die frühen Kinderjahre des Nidl-Buben, so wie man sich die Geschichte im Viertel erzählt hat. »Die Mutter hat den Kleinen in Niederfladnitz unehelich zur Welt gebracht, der Vater war unbekannt. Kurz darauf ist sie zurück nach Hamburg, um ihre Ausbildung zur Journalistin fortzusetzen. Den Jungen hat sie in Wien in einem Heim abgegeben. Manfreds Großmutter hat das einige Zeit mitgemacht, bis sie den Jungen aus dem Heim zurückgeholt und bei sich aufgenommen hat. Jetzt war er bei der Oma, und die Oma war ihm alles! Er war ein sehr hübsches Kind mit seinen großen Kugelaugen und wurde von allen verwöhnt.«
1938 – das ist gesichert – ist Manfred Nidl auf jeden Fall in Wien. Er besucht die Volksschule in der Josefstädter Lerchengasse. Ein Jahr später, am 27. Juli 1939, heiratet seine Mutter einen Mann, der dreiundzwanzig Jahre älter ist als sie: Baron Rudolf Anatol Freiherr von Petz. »Mein Vater war ja genauso alt wie meine Mutter, und weil sie so schlechte Erfahrungen mit einem Gleichaltrigen gemacht hat, dachte sie, jetzt, beim nächsten Mann müsse es ein älterer sein, einer, der viel älter ist.« Der Dichter und Schriftsteller von Petz wird am 28. Januar 1887 – den Ort kennen wir bereits – in Pula auf Istrien geboren, er entstammt einer alten und angesehenen Familie von Marineangehörigen. Sein Großvater, Anton Freiherr von Petz, war ein k. u. k. österreichisch-ungarischer Vizeadmiral, der als Kapitän zur See am 20. Juli 1866 die Zweite Division der österreichischen Flottille in der Seeschlacht von Lissa anführte. Bei diesem ersten Seegefecht der europäischen Geschichte, in dem Panzerschiffe eingesetzt wurden, besiegte die österreichische Flotte die italienischen Angreifer. Im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Österreich kämpfte Italien an der Seite Preußens und wollte hier vor der kroatischen Küste die österreichischen Gebiete an der Adria einnehmen. Für seine Verdienste bei dieser Seeschlacht wurde von Petz vier Wochen später der Maria-Theresia-Orden verliehen. 1868 stand Anton von Petz an der Spitze einer Delegation, die per Schiff nach Japan aufgebrochen war, um in Tokio einen Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Japan und der österreichisch-ungarischen Krone zu unterzeichnen, der Beginn der offiziellen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Der Enkel Rudolf Anatol verbringt seine Jugend teils in Italien, teils in Wien. Zunächst soll er Diplomat werden, später Medizin studieren. Doch ihn zieht es zum Schreiben, und als er das Angebot erhält, für die Münchner Neuesten Nachrichten zu arbeiten, gibt er alle anderen Berufspläne auf. Gerade mal zwanzig Jahre alt, lebt Rudolf Anatol nur noch für seine schriftstellerische Tätigkeit. Von 1910 bis 1914 leitet er als Präsident die Wiener Literarische Gesellschaft, bis er im Ersten Weltkrieg eingezogen wird. Schwer erkrankt kehrt er Jahre später zurück und fängt wieder an zu schreiben. Unzählige Gedichte entstehen, Theaterstücke wie Frau Barbara und Pest in Wien, ebenso wie Lieder, die von namhaften Komponisten vertont werden, und Balladen wie »Der Blinde«, »Die arme Kathrin« oder »Maria, das Mädchen der Gasse«. Bis der junge Baron den Tierschutz für sich entdeckt und in Aufsätzen, Gedichten und Geschichten sich nur noch diesem Thema widmet.
Der kleine Manfred kann seinen Stiefvater nicht leiden, nie nennt er ihn »Papa«, immer nur »Vater«. »Da komm ich zurück aus Amerika«, hat er einmal erzählt, »und da liegt ein fremder Mann in meinem Bett ... äh, Entschuldigung, ich mein natürlich, im Bett meiner Mutter.« Dieser Fremde adoptiert ihn auch noch und zwingt ihm einen neuen Namen auf. Ein Nichtsnutz sei er gewesen, verarmter Adel, der seine Mutter nur wegen ihres Geldes geheiratet habe. »Wissen Sie, er war ein Mann, der von den Frauen gelebt hat.« Die Familie zieht um, von der Laudongasse gleich um die Ecke in die Kochgasse 8. Eine große, repräsentative Wohnung im zweiten Stock eines Patrizierhauses. Heute ist hier eine Gedenktafel angebracht, rechts neben dem Eingang: »Dieses Haus war von 1907 bis 1919 Heim und Wirkungsstätte des Dichters Stefan Zweig (1887–1942)«. Doch nicht nur der berühmte Schriftsteller lebte einst in diesem Haus. In Zweigs Erinnerungen ist von einer Klavierlehrerin die Rede, die eine Etage über ihm wohnt. Eines Tages, im Jahre 1910, erzählt ihm das »grauhaarige, ältliche Fräulein« von ihrer Mutter, mit der sie die Wohnung teilt. Zweig kann es nicht fassen: »Diese achtzigjährige Frau war niemand geringerer als die Tochter von Goethes Leibarzt Dr. Vogel und 1830 von Ottilie von Goethe in persönlicher Gegenwart Goethes aus der Taufe gehoben.« Weiter schreibt Zweig: »Mir wurde ein wenig schwindelig – es gab 1910 noch einen Menschen auf Erden, auf dem Goethes heiliger Blick geruht! – Ein letzter dünner Faden, der jeden Augenblick abreißen konnte, verband durch dies gebrechliche irdische Gebilde die olympische Welt Weimars mit diesem zufälligen Vorstadthaus Kochgasse 8.« Eines Tages wird Zweig bei der alten Dame – es ist die Pianistin Margarethe Demelius – eingeladen, und andächtig bestaunt er in ihren Räumen »mancherlei vom Hausrat des Unsterblichen«. Zweigs Erinnerungen an die Kochgasse 8 sind untrennbar verbunden mit seiner Verehrung für Johann Wolfgang von Goethe. »Und vielleicht bin ich selbst wiederum schon der letzte, der heute sagen darf: ich habe einen Menschen gekannt, auf dessen Haupt noch Goethes Hand einen Augenblick zärtlich geruht.«
Mit zum neu gegründeten Haushalt der Familie Petz gehört ein Dienstmädchen, Änne Dietrichstein, eine kluge, gebildete Frau. Sie ist – wie sich viel später herausstellt – eine Cousine von Stefan Zweig und hat bei der Familie Petz Zuflucht gefunden, als Jüdin wird sie von den Nazis verfolgt. Denn Österreich ist inzwischen von den Deutschen besetzt. Am 12. März 1938 lässt Adolf Hitler die Wehrmacht in Österreich einmarschieren. Zwei Tage später ruft er weit über hunderttausend jubelnden Menschen auf dem Wiener Heldenplatz zu: »Deutsche! Männer und Frauen! Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches sein.« Und: »Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!« Aus Österreich wird die »Ostmark«, ein Begriff, der später durch den der »Donau- und Alpenreichsgaue« ersetzt wird. Hitler lässt sich den sogenannten Anschluss am 10. April 1938 durch eine Volksabstimmung bestätigen, laut offiziellem Ergebnis votieren 99,73 Prozent der Stimmberechtigten dafür, Juden, »Mischlinge« und Gegner der Nationalsozialisten sind von der Wahl ausgeschlossen. Die veränderte politische Situation hat ihre Auswirkungen offenbar auch auf das Leben des Schülers Manfred Petz. Im Unterricht ist er darauf bedacht, so stellt er es dar, so wenig wie möglich zu sprechen, zu sehr ließe sich noch der Akzent aus West Virginia heraushören, und die Amerikaner seien ja im großdeutschen Reich nicht beliebt gewesen. Statt zu reden, habe er sich lieber dem Fanfarenzug des Jungvolks angeschlossen und musiziert.
Wer weiß, wäre nicht der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, hätte die Karriere des Freddy Quinn vielleicht schon sehr viel früher begonnen – als Kinderstar im Kino. Der Regisseur Ernst Marischka will das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart verfilmen, und für die Rolle des kleinen Wolferl scheint ihm der Junge aus der Kochgasse mit den großen schwarzen Augen und dem dunklen Lockenkopf die ideale Besetzung. Doch der Film wird abgesagt, der Kriegsbeginn verhindert die Dreharbeiten.
Am 24. September 1940, drei Tage vor Manfreds neuntem Geburtstag, gibt es Zuwachs in der Kochgasse, seine Halbschwester Dagmar kommt zur Welt. Manfred lernt inzwischen Klavierspielen, sein Stiefvater hat ein altes Instrument mit in die Familie gebracht. Hinzu kommt der Geigenunterricht, den der umtriebige Junge aber schon nach wenigen Stunden schmeißt, ständig die gleichen Töne üben, dafür fehlt ihm jede Disziplin. Die Geige, ein Weihnachtsgeschenk, tauscht er gegen ein Knopfakkordeon ein. Am liebsten aber ist er im Prater unterwegs, zusammen mit seinem Spielkameraden Erwin Schweizer. Der wohnt mit seinen Eltern und acht Geschwistern im dritten Stock, eine Etage über der Familie Petz. »Mit zehn, elf Jahren – wir waren noch Knirpse –, da sind wir hauptsächlich in den Prater gefahren«, erzählt Erwin Schweizer Jahrzehnte später: »Wir sind so gerne Ringelspiel gefahren, das war unsere Leidenschaft. Weil wir kaum Geld hatten, sind wir immer auf der hinteren Seite der Straßenbahn gefahren, ohne zu zahlen. Manchmal mussten wir auch abspringen, damit wir ohne Fahrschein nicht erwischt werden, und sind dann zu spät nach Hause gekommen, weil wir zu Fuß laufen mussten. Da hat es dann immer Strafen gegeben, nicht für mich, aber der Freddy, der wurde von seinem Stiefvater mit einer Hundepeitsche gezüchtigt. Ich habe ihn schreien gehört, bis in den dritten Stock.« Ganz anders ist das Bild von Rudolf Anatol Petz, an das sich Freddys Jugendfreund Erhard Hassek erinnert. Bei seinen Besuchen in der Kochgasse ist er oft genug mit dem Stiefvater zusammengetroffen. »Immer wenn man zu ihm gekommen ist, hat er gesagt: ›Setzen Sie sich hin! Erzählen Sie mir was!‹ Der Herr Petz war ein Aristokrat vom alten Schlag, ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch, musisch und lyrisch begabt. Dass der Petz den Freddy geschlagen haben soll, ist eine pure Erfindung, eine Frechheit, so etwas zu behaupten. Der Freddy war doch dem alten Aristokraten haushoch überlegen, schon als Bub.«
Heirat, die Geburt einer Tochter, ein ungezogener Stiefsohn, Klavierunterricht und erste Schuljahre – so soll sie ausgesehen haben, die nicht ganz heile, aber doch leidlich intakte Welt der Familie Niedl-Petz in Wien während des Zweiten Weltkriegs. So mag es gewesen sein, manchmal, so mag es sich Freddys Mutter gewünscht haben: familiäre Sicherheit für sich selbst und einen Vater für ihren unehelich geborenen Sohn. Dass es doch ganz anders aussah, entdeckt im Jahr 2009 die Journalistin Petra Cichos. Bei Recherchen stößt sie durch Zufall auf eine mögliche Nähe von Freddys Mutter zu den Nationalsozialisten. Und tatsächlich, die Akten über einen Prozess gegen Edith Petz vor dem Wiener Landgericht im Jahr 1947 bringen es an den Tag: Edith Petz, geborene Niedl, wird angeklagt, 1938 den jüdischen Fabrikanten Julius Traub denunziert zu haben. Genauer heißt es in der Anklageschrift: »Edith Petz habe in Wien am 4. Juni 1938, zur Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Ausnützung der durch sie geschaffenen Lage aus politischer Gehässigkeit den Julius Traub durch Denunziation bewusst geschädigt; die Angabe sei eine wissentlich falsche gewesen und habe offenbar auf eigennützigen Beweggründen beruht.«
Die Vorgeschichte zu der Anklage führt zurück in das Jahr 1927. Traub, Besitzer einer chemischen Fabrik in Wien, sucht per Anzeige eine Bürokraft für sein Unternehmen. Unter anderen bewirbt sich auch die 17-jährige Edith Niedl, sie erhält die Stelle und arbeitet für einige Zeit in dem Betrieb. Gut zehn Jahre später, 1938 nach dem »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich, erinnert sich Edith Niedl an ihre Zeit bei dem jüdischen Fabrikanten und zeigt ihn bei der NSDAP-Ortsgruppe »Schumann« an. Traub habe sie, so ihre späte Beschuldigung, um 3 000 Schilling betrogen. Er habe ihr damals, 1927, die Leitung der Firma anvertrauen wollen unter der Bedingung, dass sie eine Kaution in genannter Höhe hinterlege. Sie habe sich das Geld von einem Verwandten ausgeliehen, Traub habe ihr den Empfang des Betrages sogar bestätigt, sie aber dennoch weiterhin nur als Stenotypistin beschäftigt. Als er, Traub, im Laufe der Zeit auch noch zudringlich geworden sei »und ihr einmal einen Kuss rauben wollte«, sei sie nicht mehr zur Arbeit gegangen.
Diese Anzeige vor der Ortsgruppe hat Folgen für Edith Petz, aber nicht, wie sie sich erhofft hat. Zwar ermittelt das Landgericht Wien zunächst gegen Julius Traub. Edith Petz wird dazu als Zeugin vernommen und bekräftigt ihre Beschuldigungen. In der Hauptverhandlung gegen Traub muss sie aber ihre Aussage, die geforderten 3 000 Schilling von einem Verwandten geliehen zu haben, korrigieren, da dieser bei seiner Zeugenvernehmung behauptet, Edith Niedl nie Geld geborgt zu haben. Daraufhin wird Traub freigesprochen und ein Verfahren gegen Edith Niedl-Petz eröffnet, wegen Verbrechens der Verleumdung und der falschen Zeugenaussage. Im März 1941 kommt es schließlich zum Prozess, die Angeklagte wird zu zweieinhalb Jahren schwerer Kerkerhaft verurteilt. Für diese Zeit muss sie jetzt ihren Ehemann verlassen, den sie ja erst vor zwei Jahren geheiratet hat, ebenso wie ihre kleine Tochter, geboren sechs Monate zuvor. Ihr Sohn Manfred, auch das ergibt sich aus den Gerichtsakten, ist bereits seit 1939 in einem Kinderheim im Wiener Stadtteil Ottakring, wo er laut Unterlagen des Magistrats der Stadt Wien bis 1943 untergebracht ist.
Als es schließlich 1947 in gleicher Angelegenheit zu einer neuerlichen Anklage gegen Edith Petz kommt, steht eine reuige Sünderin vor Gericht. Vertreten durch ihren Anwalt, Maximilian Heinelt, ist sie bemüht, eine – wie es in der Juristensprache heißt – »gnadenweise Niederschlagung« des Verfahrens zu erreichen. Zur Begründung gibt sie an, sie habe ihren früheren Chef Julius Traub bei ihrer Ortsgruppe nicht anzeigen wollen, sondern lediglich eine »gesprächsweise Mitteilung« gemacht. Weiter gibt sie zu Protokoll: »Dass ich diese Mitteilung machte, kann ich mir heute psychologisch nur durch den Umstand erklären, dass eben damals eine allgemeine Psychose bestand, jedem Juden eine Schlechtigkeit anzudichten und es gewissermaßen zum guten Ton gehörte, zu behaupten, dass man durch einen Juden geschädigt worden ist. Dabei wurde oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht und eine lächerliche Kleinigkeit so aufgebauscht, dass mit einem Male aus an sich harmlosen Ereignissen ein von einem Juden begangenes Kapitalverbrechen wurde. Dass dabei die dem weiblichen Geschlecht eigene Fantasie und Hemmungslosigkeit mit das Ihrige dazu beitrug, wird jeder Kenner der weiblichen Psyche verstehen.« Sie habe sich damals bei der Ortsgruppe nur interessant machen wollen und ein »aus Dichtung und Wahrheit zusammengebrautes Märchen« aufgetischt. »Ich wollte als gute Nationalsozialistin, die den Rassegedanken voll und ganz begriffen hat, dastehen.«
NSDAP NSDAP
Über die Nähe von Edith Petz zur Nationalsozialistischen Partei Deutschlands gibt die sogenannte Registrierungsakte Auskunft. Im Rahmen der Entnazifizierung erstellten die österreichischen Behörden direkt nach Kriegsende Listen, in denen alle NSDAP-Parteimitglieder und -Parteianwärter und ihr »Belastungsgrad« erfasst wurden. In diesen Akten findet sich auch ein Hinweis auf Edith Niedl-Petz. Danach soll sie bereits 1932 in die NSDAP eingetreten sein, habe aber keine Mitgliedsbeiträge bezahlt, es existiert auch keine Mitgliedsnummer. 1938 habe sie dann in Wien erneut einen Antrag auf Aufnahme in die Partei gestellt, der aber im Mai 1942 schließlich abgelehnt wird mit Hinweis auf ihre Verurteilung und Inhaftierung ein Jahr zuvor. Gleichzeitig gibt der Eintrag in der Akte Auskunft darüber, dass Edith Niedl von 1931 bis 1934 teilweise in Deutschland als »Berichterstatterin« gearbeitet habe, unter anderem für den Kampfruf. Von 1939 bis 1940 sei sie dann Sekretärin gewesen im Büro des Wiener Gauleiters Bürckel. In der Registrierungsakte wird Edith Niedl-Petz schließlich als »minder belastet« eingestuft. Nach dem Krieg bemüht sie sich, dass ihre Daten und ihr Name aus dieser Akte gelöscht werden, ihre Begründung: Die NSDAP habe sie ja aus politischen Gründen abgelehnt. Die Behörden widersprechen, und so ist ihr Name bis heute in diesen Akten aufgeführt.
Einerseits will die Mutter von Freddy Quinn Antifaschistin gewesen sein und gemeinsam mit ihrem Mann untergetauchte Juden versteckt und versorgt haben. Andererseits ist sie nach Aktenlage als eine Art Deutschland-Korrespondentin für die Wiener NS-Wochenzeitung Kampfruf tätig. Der Kampfruf war 1930 von Alfred Frauenfeld, dem von Adolf Hitler bestätigten Gauleiter in der österreichischen Hauptstadt, gegründet worden. Frauenfeld baute den österreichischen Flügel der NSDAP aus und organisierte die Partei weiter im Untergrund, nachdem sie im Juni 1933 in Österreich verboten wurde. Weiterhin bezeugen die Bemühungen von Freddys Mutter um eine Mitgliedschaft in der Partei ihr Engagement für die Nationalsozialisten. Schließlich arbeitete sie als Sekretärin im Büro von Josef Bürckel. Bürckel war 1938 nach Wien gekommen, um die verbotene NSDAP neu zu organisieren – sein Vorgänger Frauenfeld war zunächst verhaftet worden und dann, 1934, nach Deutschland geflohen – und war mitbeteiligt an den Vorbereitungen zu der Volksabstimmung zum »Anschluss an das Deutsche Reich«. Nach dieser Abstimmung im April 1938 wird Bürckel »Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich«. Zwischen 1939 und 1940, also genau in dem Zeitraum, als Edith Petz als Sekretärin für ihn tätig wird, ist er Gauleiter in Wien, gleichzeitig »Reichsstatthalter der Ostmark« und »Reichsverteidigungskommissar« und damit verantwortlich für die Massendeportationen der jüdischen Bevölkerung Wiens.
All diese Widersprüche sind bekannt und kommen zur Sprache während des Prozesses 1947. Und doch haben Edith Niedl-Petz und ihr Anwalt Glück, ihr Gnadengesuch »An den Herrn Bundespräsidenten der Republik Oesterreich« hat Erfolg, das Verfahren wird eingestellt. Ihre »denkbar glücklichste Ehe« – wie sie im Prozess zur Sprache kam – mit Rudolf Petz wird am 12. Mai 1952 geschieden, Petz stirbt am 16. April 1961 in Wien im Alter von 74 Jahren. Edith Petz stirbt 17 Jahre später und wird am 21. Dezember 1978 auf dem Friedhof im Wiener Stadtteil Döbling beigesetzt.