

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel »Shotgun Lovesongs« im Verlag Thomas Dunne Books/St. Martin’s Press, New York
Copyright © 2013 by Nickolas Butler
Für die deutsche Ausgabe
© 2013 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Redaktion: Ulf Müller, Köln
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung eines Fotos von © Rob Howard/Corbis
Der Verlag dankt Frédéric Rich für die Erlaubnis der Verwendung seiner Schrift »Frenchy«.
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98008-0
E-Book: ISBN 978-3-608-10506-3
Dieses E-Book entspricht der 1. Auflage 2013 der Printausgabe
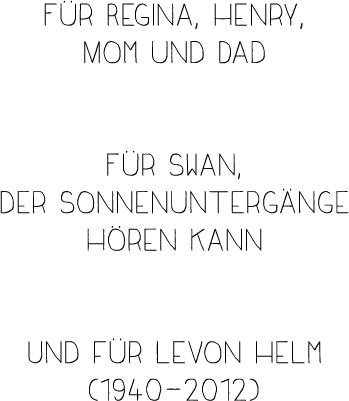
Well I hope that someday buddy
We have peace in our lives
Together or apart
Alone or with our wives
And we can stop our whoring
And pull the smiles inside
And light it up forever
And never go to sleep
My best unbeaten brother
This isn’t all I see
»I See A Darkness«
Bonnie ›Prince‹ Billy
(Will Oldham)
Aber segel mal zu, alter Junge, ich würd mich lieber von dir umbringen als von irgendeinem andern Manne am Leben halten lassen.
Moby Dick, Herman Melville
Wir alle luden ihn zu unseren Hochzeiten ein. Er war berühmt. Die Einladungen schickten wir an das Hochhaus seiner Plattenfirma in New York, damit man dort die festlichen, mit Goldrand versehenen Umschläge an ihn weiterleiten konnte, während er irgendwo auf Tour war – in Beirut, Helsinki, Tokio. Orte, die über unseren Horizont oder unsere begrenzten finanziellen Mittel weit hinausgingen. Er schickte Geschenke in verbeulten Pappkartons, die mit ausländischen Briefmarken übersät waren; feine Schals oder Parfüm als Geburtstagspräsente für unsere Frauen, kleine zierliche Spielsachen oder Schmuckanhänger zur Geburt unserer Kinder: Rasseln aus Johannesburg, hölzerne Matrjoschkas aus Moskau, winzige Seidenpantoffeln aus Taipeh. Manchmal rief er uns an. Dann rauschte es in der Leitung oder es gab ein Echo, und im Hintergrund konnte man das Kichern junger Frauen hören. Seine Stimme klang nie so glücklich, wie wir erwartet hatten.
Monate vergingen, bevor wir ihn wieder zu Gesicht bekamen. Dann kam er heim, bärtig, abgehärmt und mit müden Augen, aber irgendwie auch glücklich und erleichtert. Wir konnten erkennen, dass er froh war, uns zu sehen und wieder zurück in unserer Mitte zu sein. Wir gaben ihm immer Zeit, sich ein wenig zu erholen, bevor wir unser gemeinsames Leben wieder aufnahmen. Wir wussten, dass er erst einmal runterkommen und seine Balance wiederfinden musste. Wir ließen ihn schlafen und schlafen. Unsere Frauen brachten ihm Auflauf oder Lasagne, Schüsseln mit Salat oder frisch gebackene Pasteten.
Er liebte es, mit dem Traktor auf seinem weitläufigen Anwesen herumzufahren. Er genoss es wohl, das heiße Tageslicht, die Sonne und die frische Luft auf seinem bleichen Gesicht zu spüren. Das schleppend langsame Tempo des alten John-Deere-Traktors, der so zuverlässig und geduldig war. Die Erde, wie sie sich unter ihm abspulte. Es wurde natürlich nichts angebaut auf seinem Land. Aber er fuhr mit dem Traktor durch die brachliegenden Felder voller Präriegras und wilder Blumen, mit einer Zigarette oder einem Joint zwischen den Lippen. Er lächelte immer, wenn er auf diesem Traktor saß, mit seinen fliegenden hellblonden Haaren, die im Sonnenlicht so aussahen wie der Flaum einer Pusteblume.
Für seine Bühnenauftritte hatte er sich einen Künstlernamen zugelegt, aber den benutzten wir nie. Wir nannten ihn Leland, oder einfach nur Lee, denn so hieß er eigentlich. Er wohnte in einem alten Schulhaus, abseits von allem, abseits unseres kleinen Ortes Little Wing, ungefähr fünf Meilen weit draußen auf dem Land. Auf seinem Briefkasten stand L. SUTTON. In der kleinen uralten Turnhalle hatte er sich ein Aufnahmestudio eingerichtet. Er hatte die Wände mit Schaumstoff verkleidet und den Boden mit dicken Teppichen ausgelegt. An den Wänden hingen Platinschallplatten und Fotos, die ihn mit berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern, Politikern, Chefköchen und Schriftstellern zeigten. Die Kiesauffahrt zu seinem Haus war lang und voller Schlaglöcher, aber auch das schreckte einige der jungen Frauen nicht ab, die ihn dort ausfindig machten. Sie kamen von überall auf der Welt. Und sie waren immer wunderschön.
Lees Erfolg hatte uns nicht überrascht. Er war seiner Musik immer treu geblieben. Während wir anderen auf der Universität oder in der Army waren oder auf unseren Familienfarmen hängenblieben, hatte er sich in einem verfallenen Hühnerstall verschanzt und in der allumfassenden Stille des tiefsten Winters auf seiner ramponierten Gitarre gespielt. Er sang mit einer gespenstischen Falsettstimme, die einen manchmal, am Lagerfeuer, im unsicheren Schatten der rötlich gelben Flammen und des weiß-schwarzen Rauchs zum Weinen brachte. Er war der Beste von uns allen.
Er schrieb Lieder über unseren Flecken Erde: die allgegenwärtigen Maisfelder, die bewirtschafteten Wälder, die buckeligen Hügel und die eingekerbten Täler. Die schneidende Kälte, die viel zu kurzen Tage, den Schnee, den Schnee, den Schnee. Seine Lieder waren unsere Hymnen – sie waren unsere Sprachrohre, unsere Mikrofone, unsere Jukebox-Gedichte. Wir vergötterten ihn; unsere Frauen vergötterten ihn. Wir kannten jedes Wort von jedem seiner Lieder und manchmal kamen wir sogar selbst darin vor.
...
Kip würde im Oktober heiraten, in einer Scheune, die er extra zu diesem Zweck renoviert hatte. Die Scheune gehörte zu einer Pferdefarm; die Konturen des Landes waren von Stacheldrahtzäunen bestimmt. Direkt neben der Scheune lag ein kleiner ländlicher Friedhof, auf dem man mühelos die flechtenverkrusteten Grabsteine zählen konnte, um in Erfahrung zu bringen, wie viele Verstorbene unter dem schweren grünen Rasen ruhten. Wie bei einer Art Volkszählung. Alle waren zu der Hochzeit eingeladen. Lee hatte sogar eine Etappe seiner Australientournee verkürzt, um da sein zu können, und das obwohl sich Kip und Lee – wie wir alle fanden – unter unseren Freunden am wenigsten nahestanden. Soweit ich wusste, hatte Kip sich nicht ein einziges von Lees Alben gekauft. Man sah ihn nie durch den Ort fahren, ohne dass er nicht ein Bluetooth-Gerät in seinem Ohr klemmen hatte und seinen Mund hektisch bewegte – so als befände er sich immer noch auf dem Handelsparkett der Börse.
Kip war gerade erst nach Wisconsin zurückgekehrt, nachdem er in Chicago neun Jahre mit Rohstoffen gehandelt hatte. Jahrelang, jahrzehntelang – im Grunde genommen unser ganzes Leben – hatten wir in den Mittelwellenradios unserer Pick-up-Trucks den Landwirtschaftsberichten gelauscht. Manchmal konnte man während dieser Sendungen sogar Kip selbst hören, wie er aus seinem Büro unten in Chicago mit wohlvertrauter, selbstsicherer Stimme die Schwankungen in den Zahlenreihen herunterbetete, von denen abhing, ob wir uns Zahnspangen für unsere Kinder, Reisen in den Winterferien oder neue Stiefel leisten konnten. Er teilte uns Dinge mit, die wir nicht genau verstanden, aber dennoch bereits wussten. Unser Leben war in diese Meldungen von Milch-, Mais-, Weizen- und Sojapreisen hineingewoben. Schweinebäuche und Vieh. Weit entfernt von unseren Farmen und Mühlen hatte Kip es zu etwas gebracht, indem er mit den Früchten unserer Arbeit den Markt manipulierte. Wir respektierten ihn trotzdem. Nicht zuletzt deshalb, weil er eine äußerst scharfe Intelligenz besaß. Seine Augen brannten in ihren Höhlen, während er zuhörte, wie wir uns über Saatguthändler, Pestizide, die Düngerpreise, unsere Maschinen und das launische Wetter beschwerten. Er hatte immer einen Farmer-Almanach in der Hosentasche und konnte verstehen, dass wir vom Wetter besessen waren. Wäre er nicht fortgegangen, wäre er vielleicht selbst ein erfolgreicher Farmer geworden. Der Almanach war, wie er mir einmal erzählte, im Prinzip völlig überholt, aber er trug ihn dennoch gerne mit sich herum. »Nostalgie«, erklärte er mir.
Nach seiner Rückkehr kaufte Kip die stillgelegte Futtermühle im Zentrum der Stadt. Sie war das höchste Gebäude im Ort. Ihre sechsstöckigen Getreidesilos hatten sich schon immer über uns aufgetürmt, hatten ihre langen Schatten auf unser Leben geworfen, gleich einer Sonnenuhr, nach der sich unsere Tage richteten. Früher, als wir noch klein waren, hatte in der Anlage viel Betrieb geherrscht. Die Farmer lieferten Mais, um ihn dort zu lagern, bis die durchfahrenden Züge ihn mitnehmen konnten, oder sie kamen, um in großen Mengen Brennstoff, Saatgut oder andere Vorräte zu kaufen. Aber gegen Ende der achtziger Jahre begann es mit der Mühle bergab zu gehen. Der Besitzer hatte versucht, sie zu verkaufen, in einer Zeit, in der niemand kaufen wollte. Nur wenige Monate später fingen die Highschoolschüler an, Steine in die Fenster zu werfen und Graffiti an die Wände der Getreidesilos zu sprühen. Für den Großteil unseres Lebens war die Anlage einfach nur eine düstere Festung neben ein paar rostigen Schienensträngen gewesen, die von Unkraut überwuchert waren: Schwalbenwurz, Geiskraut und Weidenröschen. Der Boden war überall dick verkrustet mit Taubenkot und Fledermausguano und in dem alten Steinfundament stand ein See mit trübem Wasser. In den Silos wimmelte es von Ratten und Mäusen, die das übriggebliebene Korn fraßen. Manchmal brachen wir dort ein und schossen auf sie, mit Kaliber-.22-Gewehren, wobei die kleinen Kugeln nicht selten zu Querschlägern wurden, wenn sie von den mächtigen Wänden abprallten. Wir benutzten Taschenlampen, um die winzigen Knopfaugen der Tiere aufzuspüren. Einmal stahl Ronny eine Leuchtfackel aus dem Kofferraum des Wagens seiner Mutter und ließ sie in die Tiefe des Silos fallen, wo sie in scharf glühendem Rosa die schwefelige Dunkelheit durchschnitt, während wir wild drauflosknallten.
Nach nur zehn Monaten hatte Kip den Großteil der Anlage wiederhergestellt. Er beschäftigte Handwerker aus dem Ort und beaufsichtigte jedes kleinste Detail; er war jeden Morgen der Erste auf der Baustelle und war sich auch nicht zu schade, hier und da selbst einen Hammer zu schwingen oder sich niederzuknien, um den Mörtel glattzustreichen oder was sonst auch immer anfiel. Wir gaben Schätzungen ab, wie viel Geld er in das Gebäude gesteckt hatte: Hunderttausende, zweifellos; vielleicht sogar Millionen.
Im Postamt oder im IGA-Supermarkt redete er ganz aufgeregt über seine Pläne. »So viel Platz«, sagte er dann. »Überlegt euch nur mal, wie viel Platz es da gibt. Wir könnten alles Mögliche damit anfangen. Büros. Leichtindustrie. Restaurants, Pubs, Cafés. Ich möchte auf jeden Fall ein Kaffeehaus. So viel weiß ich schon mal.« Wir bemühten uns, so gut es ging mit ihm mitzuträumen. In unserer Kindheit war die Mühle eine kurze Zeit ein Ort für uns gewesen, an dem unsere Mütter Overalls, dicke Socken und Gummischuhe für uns kauften. Ein Ort, an dem es nach Hundefutter und Maisstaub und neuem Leder und schlechtem Atem und dem billigen Aftershave alter Männer roch. Aber diese Erinnerungen lagen weit zurück.
»Meinst du, die Leute werden in der alten Mühle essen wollen?«, fragten wir ihn.
»Brecht mal aus euren Konventionen aus, Leute«, säuselte er. »Das ist genau die Haltung, die diese Stadt vor die Hunde gebracht hat. Denkt mal in anderen Dimensionen!«
Neben der neuen elektronischen Kasse stand noch die alte Ladenkasse. Auch die hatte Kip gerettet. Er stand mit Vorliebe dort, gegen das alte Gerät gelehnt, und stützte sich mit den Ellbogen auf dessen glänzender Oberfläche ab, während einer seiner Angestellten die neue Kasse bediente. In der Nähe der Kassen hatte er vier Flachbildschirme an die Wand montiert. So konnte er die fernen Börsengeschäfte, die Wetterberichte und politischen Vorgänge in Echtzeit verfolgen, während er sich aus den Mundwinkeln mit seinen Kunden unterhielt, die Augen dabei immer fest auf die Nachrichten gerichtet. Manchmal schaute er nicht einmal in ihre Gesichter. Aber er hatte dafür gesorgt, dass die Mühle wiederauferstand. Alte Männer kamen, parkten ihre rostigen Pick-ups auf der Kiesfläche des Parkplatzes und tranken dünnen Kaffee. Sie lehnten sich gegen ihre Fahrzeuge, deren Motoren immer noch warm waren und mit leisem Knacken abkühlten, unterhielten sich und spuckten braunen Tabaksaft in den Staub und auf die Schottersteine. Sie mochten die neue Geschäftigkeit, die um die Mühle herum entstanden war. Die Lieferwagen, Handelsvertreter, Bauarbeiterteams. Sie mochten es, sich mit uns jungen Farmern zu unterhalten; mit mir und den Giroux-Zwillingen. Wir kamen oft, um uns über Kip lustig zu machen, wie er auf diese brandneuen Plasmabildschirme starrte und sein Bestes gab, um uns zu ignorieren.
Lee hatte sogar einen Song über die alte Mühle geschrieben – vor ihrer Wiederbelebung. Es war diese Version der Mühle, die uns in Erinnerung blieb, diese Version, die uns real erschien.
...
Unser Freund Ronny Taylor war Alkoholiker gewesen. Das Trinken hatte einen üblen Umweg aus seinem Leben gemacht. Einmal war er betrunken auf den Bürgersteig gestürzt, auf der Hauptstraße, draußen vor dem VFW-Posten 66. Er war heftig auf den Kopf gefallen und hatte sich ein paar Zähne ausgeschlagen. In dieser Nacht war er sehr laut und streitlustig gewesen, hatte sich an die Freundinnen und Ehefrauen anderer Männer herangemacht, seine Drinks verschüttet und war zweimal dabei beobachtet worden, wie er in die Gasse hinter der Bar pinkelte, seinen Schwanz fröhlich im Wind baumeln ließ und »Raindrops Keep Fallin’ On My Head« vor sich hin pfiff. Sheriff Bartman hatte keine andere Wahl gehabt, als ihn wegen öffentlicher Trunkenheit festzunehmen, auch wenn er eigentlich gar nichts gegen Ronny hatte und nur erreichen wollte, dass sich der junge Mann an einem sicheren Ort ausnüchterte, statt sich hinters Steuer seines Pick-up-Trucks zu klemmen, um dann später am Abend mit siebzig Meilen pro Stunde gegen irgendeine Eiche zu donnern. Aber der Schaden war natürlich schon angerichtet. Während der Zeit, die Ronny wegen öffentlicher Trunkenheit im Gefängnis lag – die ganze Nacht und auch noch den nächsten Morgen –, blutete es in seinem Gehirn. Als der Sheriff ihn endlich in das Krankenhaus von Eau Claire brachte, wo man ihn einer Notoperation unterzog, war es schon zu spät. Niemand sprach es je laut aus, aber wir fragten uns, ob nicht der ganze Alkohol sein Blut verdünnt und die Blutung dadurch verschlimmert hatte. Danach war Ronny nicht mehr derselbe, nur noch eine verlangsamte Version seiner selbst. Er war vielleicht glücklicher als vorher, aber auch weniger bewusst. Ein Fremder, der ihm das erste Mal begegnete, würde vielleicht denken, Ronny wäre einfach nur ein wenig begriffsstutzig, möglicherweise würde er ihn auch für ganz normal halten. Aber was auch immer er dachte, er würde nie im Leben darauf kommen, wer der junge Mann gewesen war, der vorher diesen Körper bewohnt hatte. Er konnte seine Sätze nicht mehr so schnell formulieren und oft wiederholte er sich auch. Aber das hieß nicht, dass er dumm gewesen wäre, oder behindert, obwohl ich mich manchmal frage, ob wir ihn nicht genau so behandelten.
Während seines Entzugs verbrachte Ronny mehrere Monate im Krankenhaus und oft musste er im Bett fixiert werden. Wir kamen ihn besuchen, um seine Hand zu halten. Sein Händedruck war wild und heftig und seine Adern schienen am ganzen Körper aus dem verschwitzten Fleisch hervorplatzen zu wollen. Seine Augen waren voller Furcht, eine Furcht, wie ich sie vorher nur bei Pferden gesehen hatte. Wir wischten ihm die Stirn ab und taten unser Möglichstes, um ihn am Boden zu verankern.
Auch unsere Frauen und Kinder kamen ihn besuchen. Das tat ihm gut. Es zwang ihn, ein wenig sanfter zu werden. Unsere Kinder brachten Buntstifte und Papier mit ins Krankenhaus und malten unbeholfene Porträts von ihm. Dazu nahmen sie immer fröhliche Farben und pinselten eine leuchtende Sonne oder einen grünbeblätterten Baum neben seinen Kopf. Wenn die Kinder wieder gegangen waren, fanden wir ihn manchmal, wie er ihre Gemälde umklammerte und heftig weinte. Oder er hielt sie zärtlich in der Hand und betrachtete sie ehrfürchtig, als seien es geheiligte Artefakte. Er hob die Bilder alle auf und hängte sie später in seiner Wohnung an die Wand.
Nach einiger Zeit entkam er dem Tunnel, und wir kümmerten uns so gut es ging um ihn, denn er gehörte zu uns und hatte keine andere Familie. Seine Eltern waren beide gestorben, als wir Mitte zwanzig waren – an einer Kohlenmonoxidvergiftung in ihrer Hütte oben am Spider Lake, in der Nähe von Birchwood. Ronny war das Waisenkind von Little Wing.
Er war professioneller Rodeoreiter gewesen, sanft zu Pferden, brutal zu den Rindern. Er kannte sich mit Lassos aus und hatte seinem Körper auch schon vor dem Unfall etliche böse Verletzungen zugemutet. Manchmal, wenn er abends zu uns zum Essen kam, baten meine Kinder ihn, alle seine gebrochenen Knochen aufzuzählen. Die Bestandsaufnahme dauerte eine Weile.
»Lasst mich mal nachdenken«, sagte er dann, während er sich die müden Cowboystiefel von den Füßen streifte. »Nun. Ich habe mir alle zehn Zehen gebrochen, so viel weiß ich schon mal.« Als Nächstes zog er die löchrigen Socken aus. Die wenigen Zehennägel, die er noch hatte, waren gelb angelaufen und hatten die dreckig-milchige Farbe von Quarz; es schien, als wüchsen sie seinem versehrten Fleisch zum Trotz. »Ein paar von diesen Zehen habe ich mir auch zweimal gebrochen, glaube ich. Ein wütender Stier kommt halt da auf den Boden runter, wo er gerade will, wisst ihr, und manchmal ist das dann genau die Stelle, wo du selbst stehst.« Dann nahm er sich unseren Sohn Alex, setzte ihn auf den Boden im Wohnzimmer und tat so, als sei er der Stier, der sanft auf den Körper des kleinen Jungen niederstürzte, während er ihn zugleich an Rippen, Achselhöhlen und Zehen kitzelte. »In Kalispell wollten sie mir beide kleinen Zehen abnehmen, aber ich bin aus dem Krankenhaus geflüchtet, bevor sie mich betäuben konnten. Ich kannte ein Mädel da im Ort und sie wartete draußen vor der Tür mit laufendem Motor …«
»Diese Narbe hier«, sagte er und zeigte auf seinen bleichen rechten Knöchel, »da ist ein Stier namens Ticonderoga draufgedonnert und hat mein Bein in zwei Stücke gebrochen.«
Für meine Kinder war es das beste Spiel der Welt – herauszufinden, wie viele Kleidungsstücke Ronny Taylor durch ihre Überredungskünste ausziehen würde, an wie viele gebrochene Knochen er sich wohl erinnerte und wie viele hässliche Narben sie mit ihren kleinen Fingern würden nachzeichnen können.
Aber der besoffene Sturz hatte sein Rodeoleben beendet und das machte uns traurig. Ronny hatte die Schule abgebrochen, um Rodeo zu reiten, er verfügte über keine Ausbildung und keine anderen Fähigkeiten.
Lee bezahlte seine Behandlungskosten, seine Wohnung, sein Essen und seine Kleider. Wir hatten das eigentlich gar nicht erfahren sollen, aber Rhonda Blake, die mit uns zusammen aufgewachsen war und nun im Krankenhaus von Eau Claire in der Verwaltung arbeitete, erzählte es Eddy Moffitt eines Abends im VFW. Sie hatte ihren Kopf geschüttelt und auf eine irgendwie nette Art vor sich hingelächelt und Eddy war zu ihr hinübergegangen, hatte ihr einen Drink spendiert und sie gefragt, warum sie sich so freue.
»Weißt du, die könnten mich feuern, weil ich geplaudert habe«, sagte Rhonda, »aber so ’ne Sache wie die, das sollten die Leute einfach wissen. Ich hab vorher noch nie von so einer guten Tat gehört. Verdammt, ich könnte meinen Job verlieren, aber ehrlich gesagt wäre es mir das wert.«
Und dann erzählte sie Eddy, dass Ronny nicht versichert gewesen war. Dass die Rechnungen sich auf eine Summe von weit über hunderttausend Dollar belaufen hatten.
»Und eines Tages dann«, erzählte sie, »kriegen wir Post aus New York City. Einen Umschlag von irgendeiner Plattenfirma, der an Ronny adressiert ist. Und da ist dann doch tatsächlich ein verdammter Scheck über hundertdreiundzwanzigtausend Dollar drin.«
Sie trank ihr Bier in schnellen Zügen, ihre Augen waren feucht.
»Das war einfach wahnsinnig süß«, sagte sie. »Ich kann das unmöglich für mich behalten.«
Eddy erzählte uns die Geschichte eines Abends während eines Highschool-Footballspiels (wir gegen Osseo). Keiner von uns hatte Kinder, die schon alt genug gewesen wären, um auf die Highschool zu gehen, aber wenn man in einer so kleinen Stadt wie Little Wing, Wisconsin, wohnt, dann geht man auch so zu den Football- und Basketballspielen der Highschool. Schließlich kann man auf diese Weise etwas unternehmen – preisgünstige Unterhaltung für die ganze Familie. Wir standen alle unter dem Tribünenaufbau. Einige von uns teilten sich einen Beutel Red-Man-Kautabak, andere reichten eine Tüte mit Sonnenblumenkernen herum, und wir hörten Eddy zu, während die Menge über unseren Köpfen ihr jeweiliges Team anfeuerte. Von den hölzernen Sitzreihen regnete es Aluminiumdosen und zusammengeknüllte Hotdogverpackungen auf uns herab und hier und da auch etwas Rost, den die trampelnden Füße in ihren schweren Schuhen aus dem klapprigen Metallgerüst lösten. Wir verschränkten unsere Arme, spuckten auf den Boden und versuchten uns vorzustellen, wie ein Scheck über hunderttausend Dollar überhaupt aussehen mochte.
Lee war ohnehin schon unser Held gewesen, aber diese Geschichte vertiefte unsere Liebe zu ihm noch, ließ die Legende um seine Person noch größer werden. Wir gingen am nächsten Tag alle hin und kauften zehn weitere Exemplare seiner Plattenalben, jeder einzelne von uns, obwohl wir sie zu Hause längst doppelt hatten. Und es war kostbares Geld, das wir da ausgaben, denn viele von uns hielten sich nur so gerade eben über Wasser. Wir hätten diese Summe sparen oder Lebensmittel davon kaufen können. Dennoch. Wir schickten die Alben an Verwandte oder entfernte Freunde, schenkten sie Bibliotheken oder Pflegeheimen.
Ronny bekam nie eine Rechnung zu Gesicht; Lees Anwälte kümmerten sich um den ganzen organisatorischen Kram. Für Ronny würde auf immer und ewig gesorgt sein. Er selbst schien nicht zu wissen, dass er einen Gönner hatte, oder vielleicht wusste er es ja doch, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Lee nie darüber sprach und Ronny auch nicht. Aber eigentlich war das ja auch nur richtig und gut so. Ronny hatte in seiner Wohnung zahllose Poster von Lee hängen, und das schon lange vor dem Unfall und der Operation. Die meisten waren vom Sonnenlicht bereits ein wenig ausgeblichen und von den Küchendämpfen ganz fettig geworden. Sie hatten diese schäbigen Wände geschmückt, lange bevor Lee berühmt geworden war. Ronny hatte ihn von uns immer schon am meisten geliebt.
...
Die Einladungskarten zu Kips Hochzeit wogen ganz schwer vor lauter Papier und Schleifen und Glitzerzeug. Wir trugen sie sehr vorsichtig, fast andächtig von unseren Briefkästen und Autos in unsere Häuser, als enthielten sie unbezahlbare, erlesene Neuigkeiten. Die Frau, die er heiraten würde, kannten wir nur flüchtig. Felicia war aus Chicago und arbeitete jetzt als Beraterin von zu Hause aus, in dem Anwesen, das sie gemeinsam ein wenig außerhalb der Stadt bewohnten. Wen genau oder worüber sie beriet, war uns nicht ganz klar, aber Eddy behauptete, es habe irgendetwas mit Arzneimitteln zu tun. Sie hatte Kip ein paar Mal ins VFW begleitet. Bei solchen Gelegenheiten sah sie immer wunderschön aus, und ihre Frisur, ihr Make-up und ihre Maniküre waren jedes Mal perfekt. Am eindringlichsten blieben uns ihre Stöckelschuhe in Erinnerung, die sie auch den ganzen Winter hindurch trug, immer mit leuchtend rot lackierten Fußnägeln. Sie war sehr nett, keine Frage, aber sie hatte irgendetwas an sich, das uns sagen zu wollen schien, dass unsere Stadt für sie nur ein vorübergehender Aufenthaltsort war, eine Art Zwischenlandung, und dass auch wir lediglich Zwischenlandungen waren. Zwischenlandungen, über die man später nur noch hinwegfliegen und denen man dabei kurz zuwinken würde. Überflugsfreunde.
Wir warfen einen Blick auf die Einladungskarten und stellten überrascht fest, dass Lee während der Zeremonie einen Song spielen würde. Er hatte auf keiner der Hochzeiten von uns anderen gespielt, und obwohl wir uns das alle gewünscht hätten, hätte niemand von uns gewagt, ihn um einen solchen Gefallen zu bitten. Es war uns gar nicht in den Sinn gekommen, er könne in seiner Eigenschaft als Künstler anwesend sein. Wir wollten ihn einfach nur als Freund dabeihaben.
Nicht lange nachdem die Einladungen bei uns eingetroffen waren, kam Lee aus Australien zurück, abgekämpfter und ausgelaugter als jemals zuvor. Wir ließen ihn ein paar Tage in Ruhe, wie wir es immer taten, und dann lud ihn Beth, meine Frau, zu uns auf die Farm zum Essen und zu einem Lagerfeuer ein. Er schien es immer zu genießen, mit unseren Kindern zu spielen, genauso wie den Umstand, dass wir kein Kabelfernsehen hatten. Genauer gesagt war der einzige Fernseher, den wir besaßen, ein uralter Kasten, den wir von meinen Eltern geerbt hatten und der eher einem riesigen Möbelstück glich als einem Gerät, das tatsächlich eine Verbindung zur Außenwelt schuf. Wir hatten jedoch einen relativ neuen Plattenspieler – ich sammele alte Vinyl-Schallplatten – und Lee wurde immer ein bisschen rot, wenn er daran vorbeiging und eine seiner eigenen LPs unter der Nadel liegen sah. Auch unsere Kinder konnten die Texte aller seiner Songs auswendig.
Als sie an diesem Abend die Scheinwerfer von Lees altem Pick-up die Auffahrt zum Haus hinaufkommen sahen, kreischten sie begeistert. Sie rannten im Kreis, galoppierten durch die Gegend und sangen voller Begeisterung all seine berühmtesten Refrains.
»Okay okay okay!«, rief Beth lachend. »Es reicht. Jetzt rückt Onkel Lee mal nicht zu dicht auf die Pelle. Er ist müde, okay? Er ist gerade erst aus Australien zurückgekommen. Also nervt ihn nicht zu sehr.« Während sie die Kinder von der Eingangstür wegscheuchte, prüfte sie im Spiegel ihr Aussehen, spitzte die Lippen und strich sich mit den Fingern kurz durchs Haar.
Er kam mit einem Strauß Nelken in der Hand an die Tür, den er ganz offensichtlich hastig im Supermarkt gekauft hatte. Beth nahm ihm die Blumen ab und sie umarmten sich. Mit den Jahren war er selbst immer dünner und sein Haar immer spärlicher geworden, auch wenn er es lang wachsen ließ. Er trug einen Bart und seine Unterarme waren mit Tattoos übersät.
»Hey, Kumpel«, sagte er und grinste mich an. »Ich bin verdammt froh, wieder zu Hause zu sein. Hab euch schrecklich vermisst.«
Lee war immer schon gut im Umarmen gewesen. Ich spürte seinen Brustkorb an meinem, seine langen Arme um mich. Den Geruch von Tabak in seinem Bart und in seinen Haaren.
»Wir haben dich auch vermisst«, sagte ich. Dann stürzten sich die Kinder auf ihn und er tat so, als sei er zu schwach, sich zu wehren, und ließ sich von ihnen zu Boden ringen. Beth und ich gingen in die Küche und trugen die Schüsseln mit dem Essen zu unserem alten Esstisch, auf dem die Kerzen schon brannten. Dann ging Beth zum Plattenspieler, drehte seine Platte um und setzte die Nadel auf die breite schwarze Rille am Rand.
Wir hörten, wie Lee von der Tür her aufstöhnte, während er auf uns zustolperte, Eleanore und Alex mit sich ziehend, die er mit den Armen unter den Achseln gefasst hatte. Er schüttelte den Kopf. »Lasst uns was anderes hören, okay?«, sagte er. »Ich hänge mir selbst echt zum Hals raus.«
Wir schauten ihm zu, wie er das Essen herunterschlang; es machte uns glücklich, ihn aufpäppeln zu können. Wir tranken Wein und hörten Jazz, und draußen vor den Fenstern raschelten die trockenen Herbstblätter laut an ihren Ästen. Es lag Schnee in der Luft.
»Ich habe gehört, dass du auf Kips Hochzeit einen Song spielst«, sagte ich nach einer Weile.
Lee lehnte sich in seinem Stuhl zurück und stieß die Luft aus. »Ja«, sagte er, »sieht ganz danach aus. Ich hab irgendwann aus heiterem Himmel ’ne SMS von ihm bekommen. Und da war ich so überrascht, dass ich über meine Antwort nicht groß nachgedacht habe. Hätte ich vielleicht tun sollen.«
»Ist das denn okay für dich?«, fragte Beth. »Da zu singen? Und dann auch noch ausgerechnet für Kip?«
Er zuckte mit den Schultern. »Wisst ihr, ich mag Kip schon, aber sehr nahe stehen wir uns nicht. Inzwischen ist er eher ein Bekannter als ein Freund. Aber ich bin zurückgekommen, um euch alle mal wiederzusehen und – ach, ich weiß auch nicht – ihn irgendwie zu unterstützen. Um der alten Zeiten willen und so. Er hat ein paar gute Dinge getan. Die Mühle zum Beispiel. Ich finde, er ist gut für diese Stadt. Und ich bin sowieso lieber hier als im Outback.«
»Oh«, sagte Beth, stützte ihr Kinn in ihre Hand und lächelte. »Dein Leben ist doch gar nicht so übel.«
»Nein«, sagte er. »Mein Leben ist gut. Sehr gut. Aber manchmal bin ich auch einsam. Manchmal fehlen mir Leute, denen ich vertrauen kann. Leute, die nichts von mir wollen. Das alles, es verändert einen mit der Zeit, wisst ihr? Und ich will nicht, dass es mich verändert. Ich möchte hierher zurückkommen und hier leben und einfach nur ich selbst sein können. Mit euch.« Er atmete tief aus und nahm einen großen Schluck Wein.
Wir taten es ihm nach und stießen mit ihm an, wobei die Weingläser wie ein paar stumpfe Glocken zusammenklangen. Dann herrschte eine Weile Stille. Man hörte nur, wie die Kinder unter dem Tisch mit den Beinen baumelten und wie draußen der Wind in den trockenen Maisstengeln und Baumästen raschelte. Lee lächelte wieder und goss sich ein weiteres Glas Wein ein und wir konnten sehen, dass seine Zähne schon ganz violett verfärbt waren. Und dass er glücklich war.
»Ich wünschte, ich hätte euer Leben«, sagte er schließlich. »Wisst ihr, was ich meine?«
Ich küsste Beths Hand, nahm sie dann in meine und sah ihr in die Augen. Sie lächelte mich an, wurde rot und senkte schließlich den Blick.
Daraufhin stand Lee vom Tisch auf, drückte sich die Fäuste ins Kreuz, streckte sich wie eine Katze und sammelte dann unsere Teller ein, um sie zur Spüle in der Küche zu tragen. Beth folgte ihm mit mehreren Weingläsern zwischen ihren langen Fingern, und ich blieb noch einen Moment sitzen, während sie eng nebeneinander an der Spüle standen und er ihr das nasse Geschirr reichte, damit sie es abtrocknen konnte. Erst waren nur seine Hände voller Seifenschaum und dann auch ihre, und beide wiegten sich fast unmerklich im Takt der Jazzmusik hin und her. Es machte mich glücklich, alle wieder beisammenzuhaben, glücklich, dass er wieder da war. Ich nahm mir einen Stapel Zeitungen und ein paar Streichhölzer und ging hinaus in die Dunkelheit, um ein Lagerfeuer anzuzünden.
Der Wind brachte Kälte mit und alle Sterne waren hervorgekommen; der blauweiße Überwurf der Milchstraße bildete ein prächtiges Dach über mir. Ich ging zu dem Holzstapel und trug ein paar Scheite zu der Feuerstelle in unserem Garten, brach dann ein wenig Anzündholz in kleine Stücke und entfachte das Ganze mit einem Streichholz. Dann blies ich vorsichtig in die zarten neuen Flammen. Lagerfeuer habe ich immer schon geliebt.
Irgendwann kam Lee aus dem Haus und ich spürte, wie er sich hinter mich stellte.
»Wie wär’s mit ’nem Joint?«, fragte er.
Ich schaute mich um, obwohl wir im Umkreis von Hunderten und Aberhunderten von Metern keine Nachbarn hatten. »Sind die Kinder im Bett?«, fragte ich, rieb mir die Hände und blies hinein, um sie ein wenig aufzuwärmen. Der Geruch von Alkohol war immer noch da, ganz schwach.
»Beth bringt sie gerade ins Bett«, sagte er und grinste. Wir schwiegen einen Moment. »Ich hatte das heute Abend echt bitter nötig, Mann«, sagte er schließlich. »Brauchte dringend eure Gesellschaft. Um mal wieder etwas Platz zum Atmen zu haben. Gutes Essen zu essen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das vermisst habe.«
Er hatte Zigarettenpapier in den Händen und reichte mir einen Beutel, aus dem es sogar durch das Plastik hindurch schwer und würzig roch. Er drückte die Knospen in das Papier und leckte die Ränder ab. Die Joints, die er baute, waren schon immer die besten gewesen.
»Sollen wir uns nicht einfach einen teilen?«, fragte ich.
»Warum nicht.«
Also standen wir da, die Gesichter vom Schein des Feuers rot und orange beleuchtet, von zwei verschiedenen Rauchduftnoten umweht, während sich über uns das Himmelszelt ganz langsam drehte und gelegentlich Lichter von seltsamer Schönheit auf die Erde niedersprühten.
Irgendwann fing Lee an zu lachen und schüttelte den Kopf. Ich berührte den Flanellstoff seiner Jacke und fragte: »Was ist los? Was?«
»Ich habe eine Freundin.«
»Ach ja? Du hast immer eine Freundin.«
»Diesmal ist es anders«, sagte er. Er schaute mich an und hob die Augenbrauen. Der Rauch füllte unsere Lungen aus, klebrig und gut, und der Joint wanderte zwischen uns hin und her.
»Und? Wer ist sie? Nun komm schon.«
Ich verschluckte mich am Rauch, als er es mir erzählte, und hustete in die Nacht hinaus. Dann schlug ich mir mit der Faust an die Brust. Lee ging mit einem Filmstar aus, einer Frau, die regelmäßig auf den Hochglanzseiten mindestens dreier verschiedener Zeitschriften auftauchte, die bei uns im Haus herumlagen. Sie war berühmt für ihre Eleganz, ihre unergründliche Schönheit und ihr unbestrittenes Schauspieltalent.
Er nickte mir zu, immer noch lächelnd.
»Und was will sie mit einem Penner wie dir?«
»Jeder Mann sollte ab und zu auch mal Glück haben dürfen«, sagte er und zuckte mit den Schultern. Aber ich konnte genau erkennen, dass er in sie verliebt war.
»Ich bringe sie zu Kips Hochzeit mit«, sagte er einen Moment später. »Ich kann es kaum erwarten, sie euch vorzustellen.«
»Herrje, Lee, ich – Scheiße, ich freue mich wahnsinnig für dich«, sagte ich, obwohl da in meiner Brust etwas an mir zog, das sich wie Eifersucht anfühlte. »Ich freue mich wahnsinnig für dich«, wiederholte ich und starrte ins Feuer, durch die Flammen hindurch, dorthinein, wo die Kohle pulsierend glühte, im fahlsten, hellsten Orange. Ich fragte mich, wie es sich wohl anfühlen mochte, ihren Körper zu berühren, mit einer Frau zusammen zu sein, die so unglaublich schön war. Dann schüttelte ich den Kopf, schüttelte all diese Gedanken aus mir heraus und war wieder zurück bei Lee, glücklich und stolz auf ihn.
Seltsam, dachte ich dann, wie sein Leben dem meinen ähnelte und es dann aber wiederum überhaupt nicht tat, obwohl wir doch von demselben kleinen Fleckchen Erde stammten. Und warum? Wie hatten sich unsere Wege getrennt und warum gab es zwischen ihnen überhaupt noch eine Verbindung? Warum stand er in diesem Moment in meinem Garten, auf meiner Farm, umgeben von den Geräuschen von fast zweihundert Kühen? Wie kam es, dass er zurückgekehrt war, dieser berühmte Mann, dieser Mensch, dessen Name jeder schon mal gehört hatte, dessen Stimme Millionen von Leuten wiedererkannten, für den es an so vielen Orten unmöglich war, einfach nur ein Fremder zu sein?
Es fiel mir schwer, zum Nachthimmel hinaufzuschauen und dabei nicht an Lee zu denken und daran, wie berühmt er war. Überall auf der ganzen Welt gab es in diesem Augenblick zweifellos Menschen, die seine Musik hörten. Ich schaute zu, wie er einen letzten Zug von dem Joint nahm, bevor er ihn ins Feuer schnipste. Er leuchtete. Er war ein weißes Glühen.
...
Wenn Lee nicht gerade irgendwo auf Tour war, wohnte Ronny oft bei ihm in dem alten Schulhaus. Sie machten zusammen Musik, Ronny am Schlagzeug, auf das er fröhlich einhämmerte, während Lee seinem versehrten Freund anerkennend zulächelte. Oder sie fuhren zusammen mit Lees Traktor durch die Sonne. Lee machte für Ronny Frühstück, Mittag- und Abendessen. Manchmal saßen die beiden auch gemeinsam auf Lees Veranda und schwiegen einfach nur. Sie schauten den Fledermäusen zu, bei ihren Sturzflügen durch die Sternenkulisse der Nacht. Sie lauschten den Rufen der Eulen. Beobachteten die Rehe, wie sie draußen auf den Feldern grasten.
Lee achtete sehr genau darauf, dass Ronny keinen Alkohol anrührte. Wenn sie da draußen auf ihren Holzsesseln saßen, tranken sie Kaffee oder Kakao, und das war gut und reichte ihnen. In Ronnys Gesellschaft blieb Lee clean, oder zumindest größtenteils. Und wenn sie abends einmal ins VFW gingen, um ein Spiel der Packers zu gucken oder einen Hamburger zu essen oder sich einen Pappteller mit Quarkbällchen zu teilen, dann wich Lee nicht von Ronnys Seite, bestellte Coca-Colas für ihn und hörte mit begeistertem und ehrlichem Interesse den manchmal recht verwickelten Ansichten und Monologen seines Freundes zu. Keiner von uns hatte vor Ronnys Unfall den Alkoholismus so recht verstanden, der unseren Freund fast umgebracht hätte. Es hatte damals den Anschein, als sei der Alkohol während seiner Rodeoreisen zu seinem engsten Weggefährten geworden. Wenn eine Veranstaltung vorbei war, legte er sich meistens in die Badewanne seines Motels, um seinen mit blauen Flecken übersäten Körper zu kühlen, und betrank sich mit billigem Bier oder schlechtem Wodka. Das Trinken wurde seine Geliebte, sein Wiegenlied, seine Nadel und sein Kopfkissen.
Lee hatte einen ganzen Stier schlachten und ausstopfen lassen und ihn dann auf ein Podest mit vier robusten Rädern montiert. Die beiden Freunde rollten den toten Stier oft auf eines von Lees Feldern und verbrachten dann den ganzen Nachmittag damit, auf Lees Traktor um ihn herumzufahren; Ronny mit dem Lasso in der Hand, das er gekonnt mit lächelndem Gesicht über seinem Kopf wirbelte und dann hinaus ins Feld warf, wo es sich jedes Mal ohne Ausnahme um die beiden glänzenden Hörner des reglosen Tieres schlang.
»Seine Muskeln wissen alle noch genau, wie es geht«, sagte Lee oft und schüttelte traurig den Kopf. Und dann sagte er: »Ich sollte ihm ein Pferd kaufen.«
...
Der Junggesellenabschied war ein ziemliches Fiasko. Kip hatte eine Stretch-Limousine gemietet und uns allen einheitliche Polohemden gekauft, die wir den ganzen Tag tragen sollten. Tagsüber gingen wir golfen. Sechsunddreißig Löcher. Er hatte den ganzen Kurs und auch das Clubhaus gemietet. Das Gerücht machte die Runde, es würden Stripperinnen auftreten. Aber Kip hatte Ronny nicht eingeladen und Lee war furchtbar wütend. Mich überraschte das nicht. Kip hatte so eine Art an sich, viel zu hastig zu handeln und kaum zuzuhören. So war er immer schon gewesen. Ronny und er waren nie besonders gut miteinander klargekommen, und vielleicht galt das ja auch für uns alle: dass Kip nie so recht zu uns gepasst hatte. Aber zu Ronny passte er noch am wenigsten. Er starrte Kip einfach nur an, schon als wir noch Teenager waren, und sagte solche Sachen wie: »Also ehrlich, Kip, allen außer dir geht dieses superelitäre College-Vorbereitungsprogramm absolut am Arsch vorbei. Mach mal’n Punkt. Dieses Wochenende steigt eine Party im Steinbruch. Das ist das, worauf ich mich jetzt konzentriere. Jemanden zum Flachlegen zu finden.«
Wenn ich mir dann den Junggesellenabschied vorstellte, zu dem wir da eingeladen waren, hatte ich unwillkürlich Kips Kollegen aus Chicago vor Augen: Männer in Anzug und Krawatte, Männer, die Martinis tranken und Spesenkonten hatten, die auf Eliteuniversitäten gegangen waren und teure Autos fuhren. Männer, die einen Satz brandneuer Golfschläger besaßen und Golfschuhe mit Spikes. Die weiche, glatte Bürohände hatten. Vielleicht hatte Kip Ronny ja nicht eingeladen, um ihn zu beschützen oder weil es ihm zu peinlich war. Aber ich wusste auch, dass keine von diesen Entschuldigungen bei Lee ziehen würden. Seine Liebe zu Ronny war so beschützerisch, dass sie unweigerlich den Zorn des Gerechten in ihm zu entfachen schien.
Ronny hatte den Tag der Hochzeit in seinem Kalender, der an einem Magneten an der Seitenwand seines Kühlschranks hing, rot angestrichen, und während der Monate, die der Hochzeit vorausgingen, fragte er Lee und mich regelmäßig, wann denn der Junggesellenabschied sein würde.
»Man muss einen Junggesellenabschied feiern«, sagte Ronny dann. »Das gehört sich einfach so. Das letzte Hurra. Stimmt’s? Das allerletzte Hurra.«
Der Gedanke, Ronny selbst würde vielleicht niemals heiraten, machte mich traurig.
Lee und ich gingen am Tag des Junggesellenabschieds zu Ronnys Wohnung.
»Hast du eine Einladung bekommen?«, fragte Lee und wühlte besorgt den Haufen Post durch, der sich auf Ronnys Küchentisch stapelte. Das meiste davon war Reklame: Coupons, Parteienwerbung, Kreditkartenangebote. Rechnungen wurden nie an Ronnys Adresse geschickt.
»Nee«, sagte Ronny, »ist wahrscheinlich einfach nur in der Post verlorengegangen. Ich weiß, dass er mich gerne dabeihätte.«
»Daran besteht kein Zweifel, Kumpel«, sagte Lee, der vor Wut kochte. »Kein Zweifel. Warte mal ’ne Sekunde, Kumpel, okay? Ich muss mal kurz telefonieren.« Er warf mir einen ernsten Blick zu, und ich wusste, ich sollte auf Ronny aufpassen und ihn ablenken. Ich machte den Fernseher an und schaltete mich durch die Kanäle, bis wir einen Naturfilm über eine Herde Montanabüffel fanden.
»Du kannst doch mein Telefon benutzen!«, rief Ronny, aber Lee war schon die Treppe hinunter auf die Straße gelaufen. Ich beobachtete ihn vom Fenster aus, wie er auf dem Bürgersteig hin und her lief und in sein Mobiltelefon brüllte. Er sah aus wie jemand, der gerade gerne gegen irgendetwas getreten hätte.
Kurze Zeit später kam Lee die Treppe mit rotem Gesicht wieder hinauf. »He, Kumpel, ist alles in Ordnung, kein Problem!«, sagte er, als er zurück in die Wohnung kam. »Ich habe gerade mit Kip gesprochen und er hat mir alles erklärt. Offenbar ist deine Einladung gerade eben an ihn zurückgesendet worden. Er hat wohl die falsche Adresse draufgeschrieben, oder so.«
Ronny schaute auf den Bildschirm, wo die Büffel in der endlosen Weite der Prärie grasten. »Aber das verstehe ich nicht«, sagte er. »Warum hat er mir die Einladung nicht einfach selbst vorbeigebracht? Ich winke ihm jeden Tag zu, wenn ich an der Mühle vorbeikomme.« Ronny schüttelte den Kopf darüber, wie unlogisch das alles war, und kicherte gutmütig in sich hinein.
Lee atmete aus. »Ich weiß auch nicht, Kumpel. Das ist eine gute Frage.« Seine Fäuste waren geballt. Er schaute zum Fenster hinaus. Es war ein wunderschöner Oktobertag. Die Sonne hell und klar, die Herbstblätter ein kühles Inferno über dem Land. In der Luft lag der Geruch von Dünger und überreifen Äpfeln.
Kurz darauf hielt eine Limousine vor Ronnys Wohnung und hupte sechs Mal. Lee schaute mich an, und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass er ein Mann mit großer Macht war, dass er in der Lage war, mit einem einzigen Telefonanruf die Dinge zu regeln. Ich konnte sehen, dass er daran gewöhnt war, seinen Kopf durchzusetzen, und nur äußerst selten enttäuscht wurde.
Ronny wandte sich vom Fernseher ab und sein Gesicht strahlte vor Aufregung. »Partytime!«, sagte er und grinste. Dann klatschte er uns begeistert an den Händen ab, laut und heftig. Mir schmerzte die Handfläche.
Wir nickten. »Partytime«, sagten wir mit so viel Enthusiasmus, wie wir aufbringen konnten.
Wir gingen nach draußen zu der Limousine, die mit laufendem Motor auf der Straße wartete. Sie war mit vielen unser engsten Freunde vollgestopft, aber es waren auch ein paar fremde Gesichter darunter, unter anderem auch eine Fotografin, eine junge Frau, die zwei Kameras um den Hals hängen hatte. Sie schien mit ihrer teuren Nikon absolut jeden Moment einfangen zu wollen, der auch nur von geringstem Interesse war. Besondere Aufmerksamkeit widmete sie den Händen, in denen Sektgläser, Bierflaschen und Whiskeybecher extravagant vor sich hin schwappten.
»Jawoll!«, schrie Ronny, während er das alles auf sich einwirken ließ. »Ja! Ja! Jaaaaa! Partytiiiiiime!« Die eng zusammengepferchte kleine Menge jubelte reflexartig.
Wir duckten uns, folgten Ronny in die Limousine und setzten uns, während der Wagen bereits von der Hauptstraße abbog und sich wie eine riesige Kompassnadel in Richtung Golfplatz wandte. Im Innern des Autos spielte irgendwelche laute Musik, die ich nicht kannte. Lee beugte sich zu mir herüber. »Pass auf Ronny auf. Lass ihn nicht aus den Augen«, sagte er. »Verstehst du?« Ich nickte und mir wurde klar, dass die Limousine und die Party eine schlechte Idee gewesen waren, dass die ganze Sache eine sehr schlechte Idee war, und jetzt hatten wir uns unwiderruflich darin verfangen. Lee hatte darauf bestanden, dass Ronny eingeladen wurde, aber nun sah er, dass die Party für seinen Freund sehr gefährlich werden konnte. Er saß stocksteif da, ballte die Fäuste und seine Kiefermuskeln spannten sich.
»Schau, dass du ihm irgendwas zu trinken besorgst«, knurrte Lee mich durch den Krach hindurch an. »Aber kein Bier, überhaupt keinen Alkohol.«
Ich fischte nach einer Dose Coca-Cola und öffnete sie für Ronny, der sich ihren Inhalt unverzüglich in den Hals schüttete. »Jaaa!!«, rief er, schnappte nach Luft und wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab. »Jawoll!«
»He, hört mal alle her!«, rief Kip jetzt. »He!« Er klopfte mit einem Schweizer Taschenmesser gegen seinen Sektkelch. »Ich will etwas bekanntgeben, okay? Zeit für eine Ankündigung!« Er erinnerte mich irgendwie an einen Pfadfinderführer, der seine Truppe nicht in den Griff bekam. »Können alle mal ihre verdammte Schnauze halten? He!«
»Eine Reeeeeeede!«, schrie der wilde Haufen. »Eine Rede! Hört, hört!« Die Gruppe bestand zum größten Teil aus unseren Freunden, aber in diesem Moment hatte ich das Gefühl, als seien nur Lee und ich dort, und Ronny, der neben uns saß. Die Fotografin richtete ihre Kamera auf uns, auf Lee, und einen Moment lang blendete uns das Blitzlicht. Es war kaum überraschend, dass sie offenbar nur daran interessiert war, Lee zu fotografieren, und ich konnte mir schon jetzt lebhaft vorstellen, wie sie Ronny und mich aus dem Bild herausschneiden würde. Ich fragte mich, ob so wohl der Ruhm aussah – zahllose Fremde mit Kameras und anschließend dann irgendein blindes Porträt, mit dem man nicht gerechnet hatte. Ich musste an eine Geschichtsstunde in der Mittelstufe denken, in der wir lernten, dass einige Urvölker Amerikas glaubten, eine Fotografie von ihnen aufzunehmen, komme einem Raub ihrer Seele gleich.
»Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel es mir bedeutet, dass ihr heute alle hier seid«, sagte Kip, »und mir dabei helft, meinen großen Tag morgen zu feiern. Ich bin überwältigt, Leute, das könnt ihr mir glauben!« Auch wenn er nicht gerade überwältigt aussah. Seine rötlich-braunen Haare waren dick und lang und mit Haaröl aus seinem engen, schmalen Gesicht gestrichen. Der sauber frisierte Bart folgte den kräftigen Konturen seines Kinns und sein Lächeln war äußerst beherrscht, fast ironisch. »Ich und Felicia«, sagte er, »wir sind wahnsinnig froh, dass ihr alle uns hier im Ort so freundlich wieder aufgenommen habt. Mit offenen Armen. Das bedeutet uns unglaublich viel. Und morgen«, und hier hielt er einen Moment inne, um nun das gesamte übertrieben bedeutungsschwere und dramatische Flair eines erfahrenen Tischredners auszupacken, »werden wir alle zu dieser riesigen alten Scheune gehen, um eine ganz großartige Hochzeit zu erleben und eine richtig zünftige Party zu feiern.«
Er war mit seinem Monolog noch nicht zu Ende, als Ronny schon »Partytime!« schrie und mit den Fäusten in die stickige alkoholschwangere Luft boxte. Einige aus der Gruppe lachten etwas unsicher, doch Lee schlang einen Arm um seinen Freund und flüsterte ihm eindringlich etwas ins Ohr. Ich schaute zu, wie Lees Lippen sich bewegten, auch wenn ich seine Worte nicht verstand. Du bleibst immer ganz dicht in meiner Nähe, Kumpel, stellte ich mir vor, ihn sagen zu hören, Wir werden zusammen ’ne tolle Party feiern, okay? Du und ich.
Kip nickte Ronny nachsichtig zu und fuhr mit seiner Rede fort. »Also hört mal«, sagte er, »ich habe euch allen ein kleines Geschenk mitgebracht, okay? Ein paar Polohemden. Es ist nichts Großes, aber he – es ist wenigstens etwas, oder? Ich möchte, dass ihr die jetzt alle anzieht. Weil heute, heute sind wir nämlich ein Team. Ein Team von Freunden. Versteht ihr? Wir sind Verbündete. Ich will, dass ihr alle Spaß habt. Ich will, dass ihr heute alles andere vergesst, okay? Alles klar. Das war’s. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt lasst uns losziehen und so richtig viel Spaß haben!«