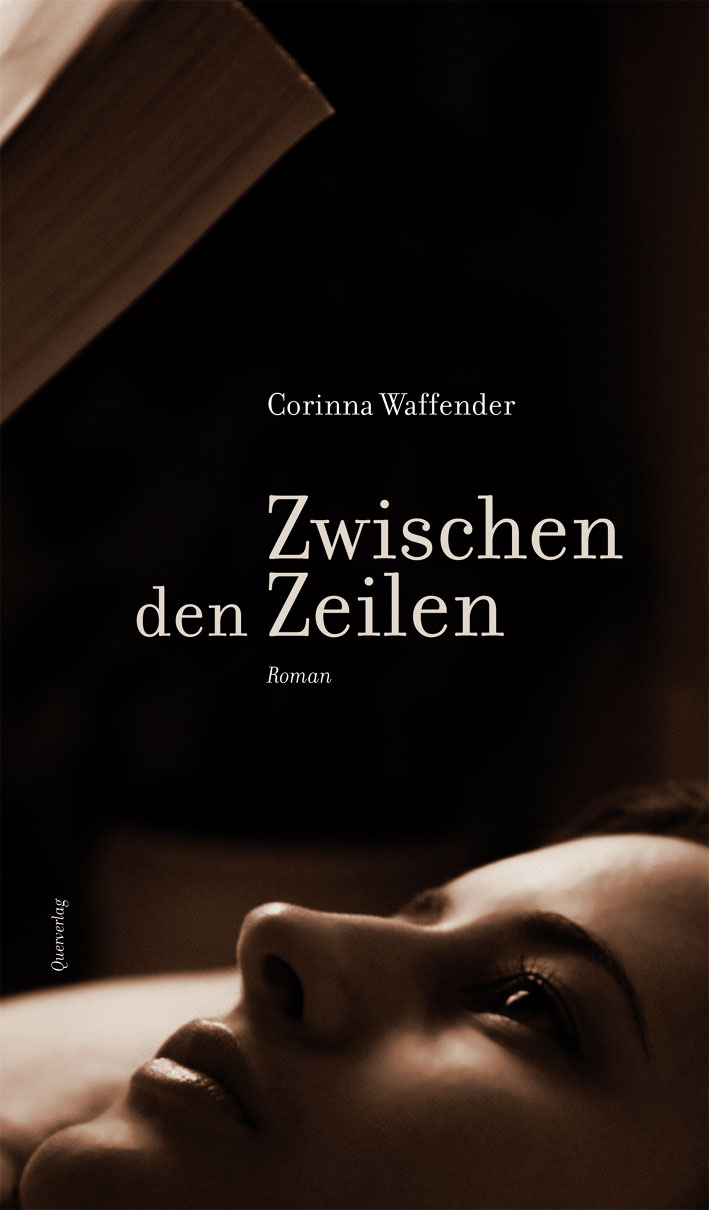
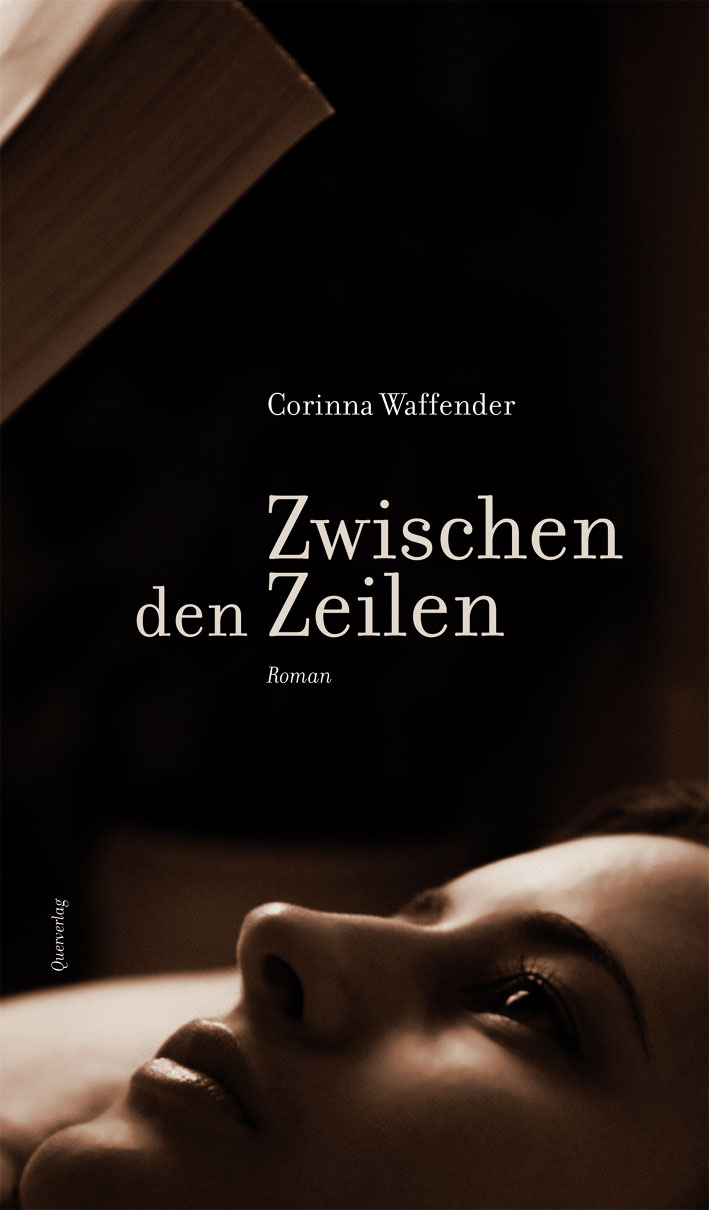

Dank an Beate Rösch für den Impuls und an Gertrud Deutz für das kritische Lektorat
© Querverlag GmbH, Berlin 2002
Erste Auflage September 2002
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie von Peter Sherrard/gettyimages
ISBN 978-3-89656-593-8
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25, D-10823 Berlin
www.querverlag.de
In Erinnerung an Birgit, Heike und die anderen Engel
Escriure, doncs, per escapar de la mort, però també per alliberar les paraules de la presó. De totes les presons. No escrivim sobre les coses, sinó sobre els noms, i així les coses, nosaltres, no ens morim.
Schreiben also, um dem Tod zu entkommen.
Doch auch, um die Worte aus ihrem Gefängnis zu befreien. Aus allen Gefängnissen. Wir schreiben nicht über die Dinge, sondern über ihre Namen.
So sterben die Dinge, wir, nicht.
Montserrat Roig (1946-1991)
Zugfahren ist Kino mit Anwesenheitspflicht. Hier spielt sich eine Welt ab, an der Maria nicht teil hat, eine Welt, die sich ereignet außerhalb des Computers, auf dessen Bildschirm sich ihr Leben vollzieht: überschaubar, kontrolliert und jederzeit abrufbar. Ihre Finger gleiten über die Tastatur wie damals über die Tasten des alten Klaviers der Großmutter. Ihre Augen verfolgen ungeduldig, wie sich die Buchstaben aneinander reihen, Worte ergeben, schließlich Sätze und am Ende den einen oder anderen Sinn.
Schreiben ist das Entdecken von Bedeutung.
Und Übersetzen?
Der Versuch, Bedeutung zu erklären, ohne dass es die Leser merken.
Wenn sie nicht arbeitet, isst sie, trinkt Tee, wäscht ab. Geht joggen. Über die Straße, durch den Park, am Wasser entlang. An den Menschen vorbeilaufen, sie flüchtig wahrnehmen, kein Wort wechseln: großartige Großstadt. Dagegen reduziert ein Zugabteil menschliches Zusammenleben auf kleinstem Raum. Ein Albtraum: Schweißfüße, Kindergeschrei, Zeitungsgeraschel. Ein unvorstellbares Miteinander, das nur auszuhalten ist, wenn sie die Ohren mit dem Kopfhörer ihres Discmans verschließt, den Ton der Mitreisenden ab- und die Musik aufdreht, aus dem, was sie umgibt, einen Stummfilm macht. Beobachten statt teilhaben.
Maria klappt den Laptop auf und wartet, bis das Gerät bereit ist. Das dauert eine kleine Weile.
Ich will das kleinste und leichteste Gerät mit dem besten Akku, sagt sie dem Verkäufer.
Das mit dem Akku weiß sie von einem Kollegen: Dann sitzt du im Zug, weit und breit keine Steckdose, und du ärgerst dich die Platze. Die Platze. Berliner sagen komische Dinge.
Sie können mit diesem Gerät Bilder bearbeiten, ganze Filme produzieren, Musik aus dem Internet herunterladen, schwärmt der Verkäufer, während er nervös mit dem Cursor auf der Bildschirmoberfläche herumfährt.
Und schreiben?
Wie meinen Sie das?
Funktioniert es auch als Schreibmaschine?
Er zieht verächtlich die Augenbrauen nach oben und macht eine ausladende Handbewegung. Es verfügt natürlich über ein Textverarbeitungsprogramm, wenn Sie das meinen.
Dann nehme ich es. Vorausgesetzt, Sie löschen alles andere.
Löschen?
Ein passionierter Updater, denkt Maria. Abrüsten muss für ihn das Schlimmste sein.
Ja, löschen: Alles runter von der Festplatte, bis auf Word.
Sie will keinen Ballast und sie hat keine Ahnung von Technik. Sie kann Dateien verwalten und ihren elektronischen Schreibtisch organisieren, sie kann E-Mails mit und ohne Anhang verschicken und sie weiß, welche Tasten sie gleichzeitig drücken muss, wenn nichts mehr geht. Der Rest interessiert sie nicht. Sie ist froh, dass sie in ihrem Gepäck kein Ton- und Filmstudio mit sich herumschleppt: Möglichkeit verpflichtet.
Maria verspürt keine Lust aufzuschreiben, was um sie herum geschieht. Dass dem Bilderbuch-Vater von gegenüber die Thermoskanne mit Tee zum dritten Mal umfällt, dass der ältere der beiden Jungs unter neurovegetativen Störungen durch zu langes Gameboy-Spielen leidet, dass die Frau neben ihr das dritte Käsebrot in sich hineinschiebt, ohne vor dem Schlucken zu kauen. Ein kleiner böser Zwanzig-Zeiler, eine Glosse mit dem Titel: Szenen einer Bahnreise. Aber sie ist zu träge, um sie zu schreiben. Diese Art der alltäglichen Berichterstattung überlässt sie lieber anderen. Sie kann nicht persiflieren, was sie nicht ernst nimmt. Wo auch immer sie ist, hat sie das Gefühl, im Theater zu sein, jeder Dialog erscheint ihr aus dem Manuskript gefallen, jede Geste einstudiert. Deshalb schreibt sie nicht über etwas, was angeblich das Leben ist, sondern gleich über die Stücke, die man darüber aufführt, über die Bücher, die man darüber verfasst, und die Musik, die man zu seiner Begleitung komponiert. Auf ihrer Visitenkarte steht: Journalistin mit Kulturbeutel. Die wenigen Redaktionen, für die sie arbeitet, schätzen ihr klares Urteil. Zwischen nichts und Sex gibt es nicht viel zu berichten. Mit Kultur verhält es sich genauso: Kuscheln ist langweilig.
Ein Mann kommt nach Hause, und weil er die Sägespäne nicht sieht, bringt er sich um. Was ist passiert?
Der CD-Player hat sich ausgeschaltet und sie gerät mitten in die Unterhaltung des Bilderbuch-Vaters und der Käsebrotesserin. Gleich wird er so tun, als würde er die Geschichte nicht kennen, vorgeben, nach einer nicht minder idiotischen Lösung zu suchen als nach der, die er schon als Jugendlicher auf dem Pausenhof gehört hat. Maria drückt auf die Repeat-Taste und hört die CD noch einmal von vorne.
Alles ist neu: der Computer, der Discman, die Reisetasche. Nach Jahren zum ersten Mal über die Stadtgrenze ohne die Ostsee im Visier. Die Züge sind jetzt moderner, nach Frankfurt dauert es nur dreieineinhalb Stunden, anhalten geht nur noch mit Anlauf.
Damit wir zum Stehen kommen, müssen wir schon viele Kilometer vorher abbremsen, erklärt der Vater seinen Kindern kurz vor Hanau.
Während der Fahrt schaut Maria kaum aus dem Fenster, doch jetzt bleibt ihr Blick hängen. Draußen fliegt eine vertraute Landschaft vorbei. Irgendwo hier in der Nähe ist sie geboren, vor mehr als drei Jahrzehnten. Hier an den Gleisen zwischen zwei Bahnhöfen, an denen der Zug nicht hält, muss die Grabstätte ihres ersten Goldhamsters sein. Am Kopfbahnhof der Messestadt steigt sie nicht aus, um sich zu vergewissern, ob ihr Bruder noch dort lebt. Aber sie steht auf, um sich auf den freien Sitz gegenüber zu setzen: Sie will nicht mehr sehen, was sie hinter sich lässt, sie will wissen, was auf sie zukommt.
Die Schriftstellerin hat keine Ähnlichkeit mit dem Foto auf dem Einband ihrer Bücher. Tatsächlich sieht sie im grellen Neonlicht der kleinen Buchhandlung viel älter aus.
Hätte ich gewusst, wie alt sie aussieht, hätte ich sie am Telefon nicht geduzt.
Erzähl mir von dir, sagt die Schriftstellerin auf dem Weg zu einem Café.
Maria verrät nicht, dass ihr der Geruch der Stadt um diese Tageszeit ein melancholisches Summen im Kopf verursacht. Die Fragen, die sie stellen will, bedürfen keiner Erklärung: Es reicht aus, dass sie Journalistin ist, um in Erfahrung zu bringen, was sie eigentlich nichts angeht.
„Was willst du wissen?“, fragt die Schriftstellerin, als sie an einem Ecktisch sitzen, der weit genug von der Theke, dem Geklapper aneinander schlagender Gläser und dem Fauchen der Espressomaschine entfernt ist.
„Wie betrachtest du die Stadt, die du in deinen Büchern erzählst?“
Die Schriftstellerin nickt bedächtig, als hätte sie ihr eine Aufgabe gestellt, die sie willens sei zu lösen. Sie lehnt sich zurück und betrachtet die Schubfächer hinter der Stirn. Dann zieht sie entschlossen eines auf und beginnt zu reden.
Maria bleibt mit den Augen an dem großen, geschwungenen Mund hängen. Er ist von kleinen Falten umgeben, die sich schnell auf und ab bewegen, wenn sie spricht. Sie hört nicht zu. Später wird sie das Band abspielen und aufschreiben, was sie für wichtig hält. Jetzt versinkt sie in der Melodie, die ihr Gegenüber mit spanischen Worten singt. Wenn sie spürt, dass es dem Ende eines Gedankens zugeht, greift sie den letzten Absatz auf, hängt ihm eine neue Frage an und sorgt dafür, dass der Gesang nicht aufhört.
„Hast du eine literarische Heimat?“
„Meiner Meinung nach haben wir Schriftsteller gar keine Heimat. Alle Städte sind mir Heimat. Oder eben nicht“, sagt die Schriftstellerin.
Maria kann nicht wissen, ob das stimmt, denn sie hat nur ein Kapitel aus einem der Bücher gelesen, die man von der Schriftstellerin kaufen kann. Nicht aus Desinteresse, es hat sich so ergeben. Dabei kauft sie den ersten Roman schon gleich nach seinem Erscheinen. Er liegt ein paar Wochen auf dem Rolltisch, der keinen festen Platz im Zimmer hat, immer da steht, wo sie sitzt.
Deine Bücher sind wie Schmetterlinge, sagt Teresa. Sie fliegen herum, bunte Lampions, und wenn man sie nicht beachtet, werden sie unbemerkt wieder zu Raupen.
Maria holt Bücher von Flohmärkten, aus Buchläden, Bibliotheken und aus Mülltüten. Sie schlägt die erste Seite auf, liest den ersten Absatz, fällt ihr Urteil schnell und schmerzlos. Entweder legt sie ein Buch nach den ersten Sätzen wieder aus der Hand oder sie nimmt es mit. Stapelt es zu den anderen, die überall in der Wohnung kleine Türme bilden.
Im ersten Satz steckt die ganze Geschichte.
Warum reißt du dann nicht einfach die erste Seite heraus und heftest sie ab?
Das Buch der Schriftstellerin liegt einige Wochen auf dem Rolltisch, bis sie es mit all den anderen in der blauen Plastiktüte ohne Aufschrift in den Container auf der Straße wirft. Seitdem liest sie keine Romane mehr. In vier Jahren keine Zeile. Nicht von dieser Schriftstellerin und auch nicht von den anderen, die sie in den nächsten Tagen treffen wird.
„Dann fühlst du dich in Barcelona nicht zu Hause?“
„In diesem Sinne nicht, nein. Abgesehen davon versuche ich mich schon aus Prinzip vor jeder Art von Etikett zu schützen. Und das wäre eines. Aber ich verstehe natürlich, dass diese Frage wichtig für dich ist…“
Die Schriftstellerin dreht sich zur Seite, angelt nach dem Handy, das in ihrer Handtasche klingelt. Maria bezweifelt, dass sie versteht, welche Frage ihr wichtig ist, aber es bekümmert sie nicht. Sie sitzt hier, trinkt kurz vor Mittag ein Bier und die Angst hält sich in Grenzen. Ihre Hände zittern nicht, sie macht einen souveränen Eindruck, das spürt sie. Sie driftet nicht ab, sie sitzt aufrecht, sie schaut der Schriftstellerin in die Augen, sieht dort nichts anderes als die Augen der Schriftstellerin und die langen Wimpern und schaut nur zur Tür, wenn es Sinn macht.
Maria weiß, dass Teresa nicht hereinkommen wird, aber das heißt gar nichts. Sie weiß das schon lange und trotzdem starrt sie monatelang auf jede Tür.
„…natürlich bin ich Feministin. Ich war schon immer sehr rebellisch. Aber ich mag auch das Etikett der Frauenliteratur nicht. Ich glaube sogar, dass uns Schriftstellerinnen gerade dieses Etikett mehr schadet als nützt. Auch wenn es einen weiblichen Blick gibt.“
„Was meinst du damit?“
„Es ist doch so: Jeder Schriftsteller hat zunächst einmal eine eigene Welt. Und auf die schaut er mit seinen Augen. Du merkst an Kleinigkeiten, ob ein Buch von einem Schwarzen, einem Hindu oder einer Katalanin geschrieben ist. Du merkst das nicht am Stil, sondern an der Art, die Welt zu betrachten.“
„Und wie betrachten Frauen die Welt?“
„Keine Ahnung, wie Frauen die Welt betrachten. Ich weiß nur, wie ich als Schriftstellerin die Welt betrachte: von meinem ganz persönlichen Lebensraum aus. Ich sehe nur meine eigene Welt. Wenn du meine Bücher gelesen hättest, wüsstest du besser, was ich meine.“
Maria möchte gerne das Diktiergerät abschalten und gehen. Die Schriftstellerin mit ihrer Cola light sitzen lassen und statt dessen ihre Bücher lesen. Aber das wäre unhöflich und deshalb tut sie so, als ob sie bliebe.
„Was ist mit der mirada bòrnia? Sich ein Auge zuzuhalten, um nicht vom Strom des männlichen Literaturkanons fortgerissen zu werden, und mit dem anderen nach innen zu schauen, einäugig die eigene Stimme zu finden?“
„Die Sichtweise reicht mir nicht“, sagt die Schriftstellerin. „Ich will viel weiter als meine Vorgängerinnen. Ich will mich nicht zufrieden geben mit dem Unterschied. Ich will darüber hinaus.“
Über den Unterschied hinaus. Maria wird nicht danach fragen, was denn nach dem Unterschied kommt. Der Körper als diskursive Oberfläche, würde Judith Butler vielleicht antworten, die sich am Vortag mit katalanischen Arbeiterinnen auf einem Kongress über den kleinen Unterschied zwischen Frauen unterhalten hat. Der Titel des Artikels in der Tageszeitung lautete: Amerikanische Philosophin diskutiert mit spanischen Putzfrauen. Daneben zwei Fotos: eines von der Philosophin, wie sie herausfordernd in die Kamera schaut, und ein anderes, auf dem drei dicke Frauen vor einem Mikrofon stehen und verlegen auf den Boden schauen.
Doch es ist nicht Judith Butler, die Maria gegenübersitzt, sondern eine spanische Literatin, die keine überzeugenden Bilder haben wird für ein Danach, in dessen Davor sie festhängt. Möglicherweise tut Maria ihr unrecht. Möglicherweise sitzt vor ihr eine Diskursspezialistin.
„…natürlich bleibe ich immer eine Frau, wenn ich…“
Nein, vor ihr sitzt keine Diskursspezialistin.
Maria ist müde. Nach drei Tagen und drei Interviews ist ihr langweilig. Das darf in ihrem Beruf eigentlich nie passieren, passiert ihr aber ständig. Sie ist eine mittelmäßige Journalistin. Sie verfügt weder über die Lust, Langweiliges interessant zu schreiben, noch über das Interesse, eine Masse zu begeistern, zu der sie sich nicht zugehörig fühlt. Sie will nicht die Welt verändern mit der Hand voll Artikel, die sie pro Woche schreibt, sie muss sehen, wovon sie ihre Miete bezahlt. Deshalb hat sie das Stipendium beantragt, einen einflussreichen Freund angerufen und gewartet.
Ich will nicht mit dir Bier trinken und ich bin zu müde, um höflich zu sein. Ich brauche das Stipendium. Tu, was du kannst. Bitte.
Und du bist sicher, dass du wieder nach Barcelona willst?
Nein.
Sie ist nicht hier, um sich über Frauenliteratur zu unterhalten. Sie will gar nicht wissen, ob es das gibt. Dann schon lieber: ob Frauen sind und ob Männer sind. Aber die vorwiegend männlich besetzte Kommission zur Vergabe von Forschungsstipendien hätte ihr für die Beantwortung solcher Fragen keinen Pfennig gegeben. Es sind Fragen, die man nur stellt, wenn man sie als Kunst verkaufen kann. Und Kunst ist das Letzte, was sie machen will. Eigentlich will sie gar nichts machen, außer herumsitzen und die Welt betrachten. Vom Sonnenaufgang bis zur Dämmerung. Dann will sie ein Bad nehmen, die Bilder im Kopf und auf der Seele abwaschen, die sich auf die Haut geklebt haben wie Abziehbilder, und nackt in den Schlafsack gleiten, den sie im Hotelzimmer auf das Bett mit den weißen Leintüchern gelegt hat. Weiße Leintücher laden zum Sterben ein und sie will nur schlafen. Tief, kurz, bis es wieder hell wird. Die Dunkelheit vergessen, die Nacht aus dem Leben werfen, so tun, als existiere sie nur im Traum.
„…und schließlich waren es nicht gerade die Frauen, die mich unterstützt haben!“
„Wie meinst du das?“ Das Interview dauert länger als ihr lieb ist.
„Ich habe nicht ins Schema gepasst. Mich weder thematisch noch stilistisch an dem orientiert, was wir Frauen“ – und hier malt die Schriftstellerin überdimensionale Anführungszeichen in die Luft – „schrieben: Meine Bücher waren außergewöhnlich. Irgendwie anders, komisch. Meine Paten, wenn man dieses Wort benutzen will, waren ausschließlich Männer. Dass meine Bücher gerade am Anfang in der Regel von Männern und nicht von Frauen geschätzt wurden, halte ich für symptomatisch.“ Die Schriftstellerin legt den Kopf ein wenig schief. „Nichtsdestotrotz schreibe ich als Frau, denn ich bin eine.“
„Und betrachtest die Welt dabei mit dem weiblichen Blick?“
„Ja. Um ihn zu überwinden. Ich will nicht an ihm festhalten. Ich will ihn in seinem ganzen Charakter aufdecken. Gerade in der Literatur. Das Problem liegt darin, dass die Herren der literarischen Schöpfung es nicht ertragen, dass eine Frau auf einer Stufe mit ihnen steht. Und solange der Kanon von Männern bestimmt wird, solange die Literaturkritik männlich ist…“
„Lässt sich die Situation nicht ändern?“
„Doch. In dem man das System offen legt. Was passiert denn auf der literarischen Bühne? Eine Masse an durchschnittlichen Autorinnen wird in den Himmel gehoben, mit Literaturpreisen eingewickelt und massenweise publiziert. Dann heißt es: Was wollt ihr denn? Frauen verkaufen doch mehr Bücher als Männer! Die meisten meiner männlichen Kollegen verherrlichen gerade solche Autorinnen, die keinen persönlichen Stil haben. Sie propagieren die Mittelmäßigkeit. Und hier setze ich an: Ich fordere alles von mir, ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden als dem Besten. Ich will mein Alles.“ Die Augen der Schriftstellerin blitzen auf. „Mich interessiert nicht die pseudopsychologisierende Light-Literatur vieler Autorinnen, die von so vielen Kritikern beiderlei Geschlechts favorisiert wird.“
Maria spürt, dass sie hier nicht weiter will. Es ist Zeit für die abschließende Frage. „Betrachten wir die erzählte Stadt als Modell für den Ort menschlichen Zusammenlebens: Empfindest du dich dort als literarische Architektin?“
Die Schriftstellerin nickt entschlossen.
„Auf jeden Fall. Mehr noch: Ich glaube, dass ich die Stadt im Laufe meiner Bücher – in denen sie oft der Ort der Handlung ist – transformieren musste. Ich muss die Stadt meines Vaters, meiner Kindheit umbringen, um eine neue zu gebären. Weißt du, nachdem ich mein letztes Buch geschrieben hatte, sah die Stadt plötzlich ganz anders aus: Ich sah die Straße, in der ich aufgewachsen bin, aus einer neuen Perspektive, der Markt war nicht mehr der, auf dem ich als kleines Mädchen einkaufen war. Das Viertel meiner Kindheit hatte aufgehört zu existieren, die Stadt hatte sich vor meinen Augen und durch die Geschichte, die ich auf ihrer Oberfläche hinterlassen habe, verändert.“
Doch eine Diskursspezialistin. Sie weiß es nur noch nicht.
„Findest du das komisch?“ fragt die Schriftstellerin.
„Nein. Im Gegenteil.“ Maria stützt sich auf die Ellbogen, um näher an das Aufnahmegerät zu kommen. „Ich glaube, dass es die Stadt ohnehin nur als Oberfläche gibt, als leere Matrix, die wir mit Bildern füllen: Wir bauen Straßen und Häuser, aber sie werden erst lebendig, wenn sich Geschichten darin abspielen. Deren Anfang wir uns ausdenken und die wir dann, zusammen mit einer Menge anderer Laien und Zufallsschauspieler, im städtischen Theater zur Aufführung bringen. Auf diese Weise sind wir zugleich Publikum und Regisseure.“
„Schönes Bild.“ Die Schriftstellerin zieht die linke Augenbraue nach oben. Das bedeutet offensichtlich Anerkennung. „Von dir?“
Maria kann nur beide Augenbrauen gleichzeitig nach oben ziehen. „Zusammengestückelt.“
Zwischen ihnen ist alles gesagt, ein paar leere Sätze noch, des Ausklangs wegen, die Rechnung.
„Lass mich dich einladen.“
„Ach, Unsinn. Ich zahle natürlich.“
„Nein, nein, lass nur…“
Danke. War mir ein Vergnügen. Hat mich gefreut. Lass uns in Kontakt bleiben.
Die beiden Frauen verabschieden sich, und wer sie nicht kennt, denkt: zwei gute Freundinnen.