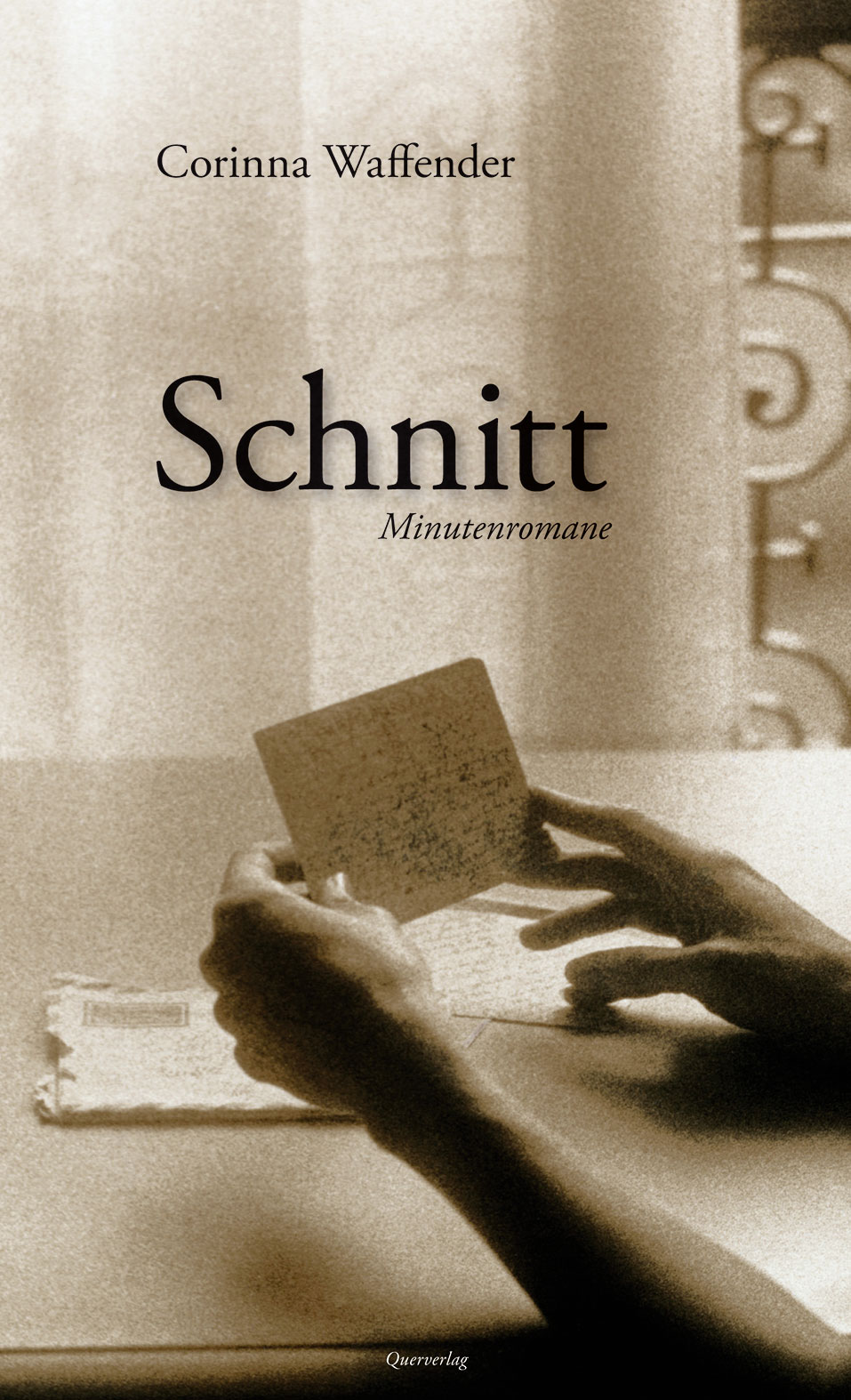
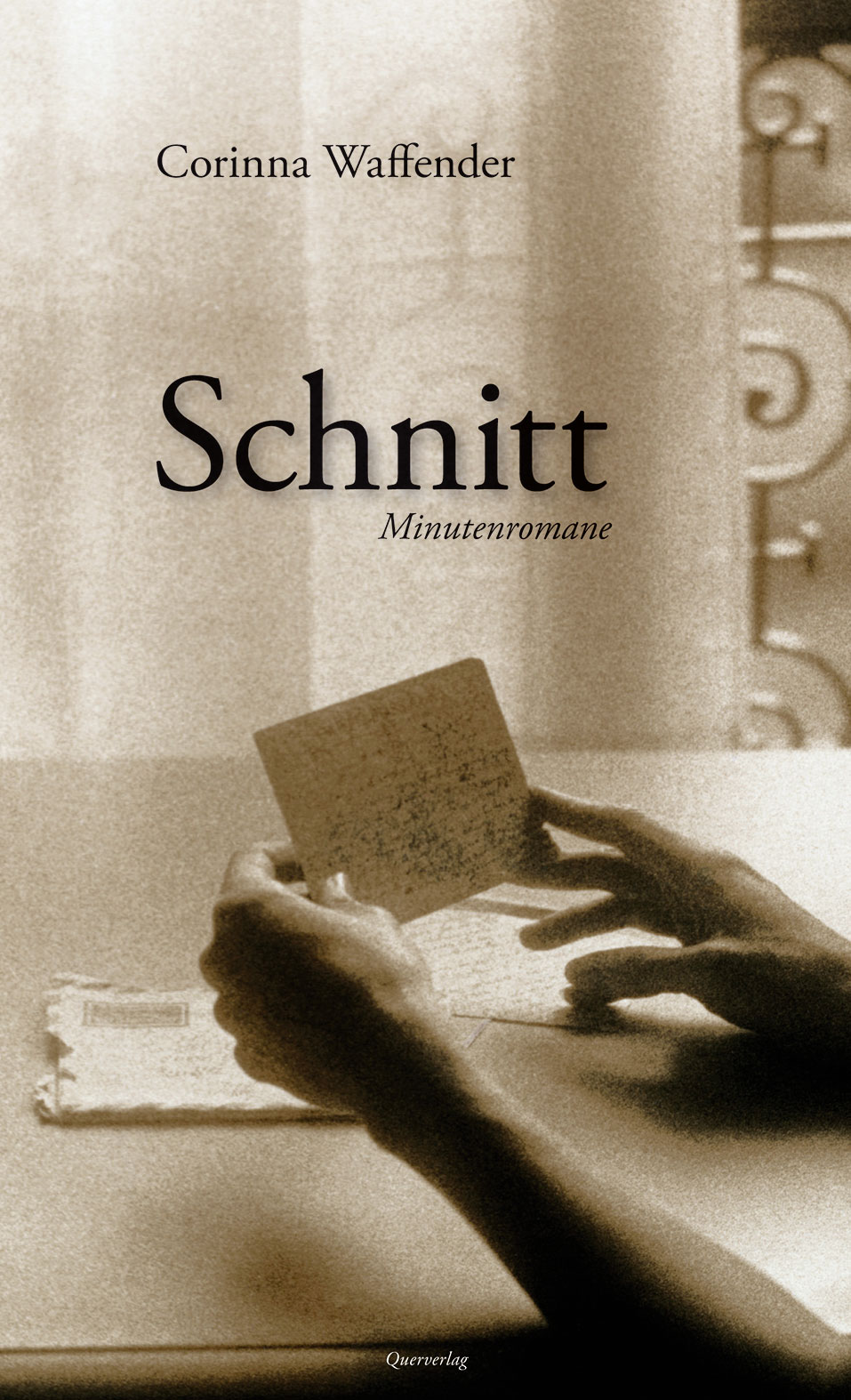

© Querverlag GmbH, Berlin 2005
Erste Auflage März 2005
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung eines Fotos von getty images.
ISBN 978-3-89656-595-2
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25, D-10823 Berlin
www.querverlag.de
für G.
Me dolía la memoria, me dolían los ojos, me dolía el espejo en que me miré.
Alejandra Pizarnik
Fechten mit dem Überall: das heißt Menschsein.
Arno Schmidt
Leipzig, September 1989
Es ist kalt. Gut so. Ines nimmt den weißen Schal aus dem Schrank. Seit sie die Bilder von der letzten Demo im Fernsehen gesehen hat, ist sie entschlossen, Farbe ins Spiel zu bringen. Als ob alle Bürger nur blaue Jacken besäßen… Ein Blick in den Spiegel: Wenn noch einmal ein Reporter der BBC auf sie zukommt, wird sie vorbereitet sein. Liberty, wird sie antworten. Oder freedom. Ganz klar ist ihr der Unterschied noch nicht. Auf Deutsch könnte sie sagen, was sie meint: Die Schere im Kopf muss raus. What do you want? Sie lacht verlegen in das Mikrofon, und der Engländer verschwindet wieder in der Menge. Eine Woche später ist der Bahnhof brechend voll, man kommt kaum raus auf die Straße. In die Kirche geht sie nicht. Was soll sie da? Plötzlich an Gott glauben? Freiheit ist eine einsame Sache, da helfen auch Gebete nicht. Angst hat sie keine, im Gegenteil. Die Montage haben sie in Bewegung gebracht. Sechs Tage warten auf den Zug, der sie von Grimma hierher bringt. Eine halbe Stunde davon träumen, wie es wäre, einfach sitzen zu bleiben, weiterzufahren. Nach Wien, zum Beispiel.
„Was willst du denn in Wien? Da ist es auch nicht anders als in Budapest.“
Alex versteht nichts. Von der Grenze schickt er graue Postkarten ohne Himmel und Versprechen.
„Würdest du wirklich auf einen schießen, der rüber will?“ fragt Ines ihn an einem dieser Samstage, in denen sie beinahe glaubt, es könnte wieder in Ordnung kommen zwischen ihnen.
„Es will doch gar keiner rüber“, antwortet er grinsend.
Doch, denkt sie, ich.
Sie reden immer weniger, die Kluft zwischen ihnen wird größer. Er bringt ihr polnische Unterwäsche mit: Slips, Büstenhalter, Strapse. Schwarze, harte Stoffe, die ihr ins Fleisch schneiden, ihre Haut genauso reizen wie ihn. Sie zieht das Zeug an, damit er es ihr vom Leib reißen kann. Dabei sieht sie aus dem Fenster, in das gelbe Licht der Straßenlaterne, das die Nacht lächerlich sonnig erscheinen lässt.
„Du kannst zu den Kirchentreffen nicht mehr hingehen. Ich krieg Ärger.“
Sie stehen am Bahnhof, und zum ersten Mal hofft sie, er würde sie zum Abschied nicht umarmen.
„Ich gehe, wohin ich will“, hört sie sich sagen, das heißt, sie hört das Lied im Kopf, das ohne Melodie aus ihrem Mund fällt.
„Dann gehst du in Zukunft allein“, sagt er.
„Ich weiß“, antwortet sie, bevor sie mit schnellen Schritten zum Ausgang läuft.
Sevilla, November 1989
Sie liest es an der Bar eines Vier-Sterne-Hotels, in der aufgeschlagenen Zeitung eines deutschen Touristen: Grenze offen! Berliner fallen sich in die Arme! Zuerst hält sie es für einen Witz. Am Abend sieht sie die Bilder in den Nachrichten: wie sie auf der Mauer sitzen, wie die Trabis in den Westen rollen, die Freudentänze am Brandenburger Tor. Ihre Schüler wollen wissen, wie das mit der Grenze war. Sie malt ein Haus an die Tafel und zieht einen Längsstrich. Sie glauben ihr nicht. Sie kann es nicht beweisen. Die Bilder davon existieren nur in ihrem Kopf. Einmal war sie in Eisenach. Konfirmandenfahrt nach Wittenberge. Kaltschale zum Mittagessen, keine Cola und nur Zigaretten ohne Filter. Später neben dem großen Bruder im VW-Bus bei Helmstedt über die Grenze nach Berlin. Aussteigen, ausladen, auspacken, einpacken, einladen, weiterfahren.
„Die können nichts dafür, Schwesterchen“, belehrt er sie, als sie ungeduldig wird. „Die müssen das machen. Schuld sind die Amerikaner mit ihrer Scheißpropaganda.“
Die Transitstrecke ohne Anhalten bis zur Raststätte. Sie zwängen sich an einen der überfüllten Tische und bestellen eine doppelte Portion Buletten, weil sie halb so teuer sind wie im Westen. Auf dem Rückweg allein im Zug riecht es wie in der alten Turnhalle ihrer Schule. Ein Student bietet ihr Rosinen an und findet ihre abstehenden Ohren süß. Sie ist froh, als sie in Frankfurt ankommt. Noch ahnt sie nicht, dass sie zehn Jahre später Stadt und Land verlässt, die ihr nie Heimat waren.
Ost-Berlin, Januar 1990
Ihretwegen sind sie nicht hier. Sie muss das nicht sehen: die Züge voller Männer mit Lederschlipsen auf den Stehkragenhemden von Woolworth und die Hamsterpakete, als könnte die Mauer sich hinter ihnen plötzlich wieder schließen. Pedro wollte nach Berlin.
„Das ist Zeitgeschichte“, sagt er, „da muss man dabei sein.“
Sie muss nirgends dabei sein. Ihre Ruhe will sie, am Strand liegen, mit dem Zeigefinger die Wolkenformationen nachfahren und über einem langweiligen Krimi einschlafen. Von Montag bis Freitag Deutsch unterrichten und am Wochenende in Cafés herumlungern und die Zeit totschlagen. Deshalb lebt sie am südlichsten Zipfel Europas. Pedro nicht. Er ist hier geboren und hasst die Lethargie, die sie liebt. Der einzige Grund, warum sie noch mit ihm zusammen ist, ist die Trägheit, die sie daran hindert, ihn zu verlassen.
West-Berlin, Januar 1990
Die Wohnung ist eine Bruchbude, hat kein Bad, Ofenheizung und schiefe Fenster. Es zieht von überall her. Aber aus der Wand kommt eine Buchse und aus der Buchse kommt ein Kabel und an dem Kabel hängt ein Telefon. Dafür würde sie auch im Windkanal hausen. Am Ende geht alles ganz schnell: ein Loch im System, die Mauer bricht auf, ein Sog zieht sie durch die Lücke und Ines steht plötzlich auf der anderen Seite. Stundenlang geht sie geradeaus und trifft irgendwann auf die Spanischstudentin, die für zwei Monate nach Südamerika will und Zettel aufhängt: Wer passt auf meine Katze auf und gießt meine Grünpflanzen? Miete frei.
Auf einmal lebt Ines in West-Berlin, und es kommt ihr niemand in den Sinn, den sie anrufen könnte.
Pedro fliegt früher zurück, der Mauertourismus langweilt ihn schnell. Sie hält ihn nicht zurück, bleibt einfach auf der Bettkante sitzen. Schafft es nicht, die Koffer zu packen, radiert die Sonne gegenüber von Afrika aus ihrem Gedächtnis. Die kalte Winterluft legt sich auf ihre Lungen, sie atmet schwer. Im Hotelzimmer ist es kühl, die klapprige Heizung schafft es nicht bis unter die Stuckdecke und wieder zurück. Nebenan ist das Schwarze Café, das kennt sie von früher, es hat Tag und Nacht geöffnet, und genau so sieht es auch aus. Sie setzt sich oben ans Fenster und schaut auf die befahrene Straße. Überall auf der Welt quälen sich Menschen in langen Schlangen durch die Stadt, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Dabei, denkt Sofia, ist Bewegung überflüssig. Alles im Leben lässt sich auch an Ort und Stelle erledigen.
Ines betritt das Café nur zögernd. Es ist vollkommen unvernünftig, das bisschen Geld, das sie hat, für derlei Luxus auszugeben. Und doch will sie in einer heißen Schokolade mit Sahne rühren und so tun, als machte sie eine kleine Pause. Vielleicht, um die große Pause, die über sie hereingebrochen ist, zu unterbrechen. Die Leere zwischen Blumengießen und Katze füttern zu füllen. Die bunten Bilder im Kopf anzuhalten, Luft zu holen und Platz zu schaffen für ein Gefühl, irgendein Gefühl zu sich selbst. Wie sie die Haustür aufschließt und eine fremde Wohnung betritt. Wie sie an der Ampel stehen bleibt und die kleine grüne Figur betrachtet, die ihr merkwürdig gelähmt vorkommt, gar nicht so, als würde sie laufen, mehr, als wäre sie im Gehen erstarrt. Wie sie schließlich die Tür zu dem Café öffnet, das seinen Namen verdient, sich durch die stickige Luft nach oben kämpft und sich erschöpft in einen alten Sessel fallen lässt: Hier sind die Dinge ramponiert, hier kann sie bleiben.
Sofia sieht die dunkelhaarige Frau schon durch das Fenster. Sie überquert die Straße erst, als die Autos schon fast losfahren. Ihr Gang gefällt ihr. Als hätte sie kein Ziel. Oder als ob sie ihr Ziel nicht zugeben wollte. Das Gefühl kennt sie. Wenn sie von der Alameda zum Hotel Alfonso XIII. schlendert, so tut, als liefe sie zum Fluss, und dann, kurz vorher, die Straßenseite wechselt, die steinernen Treppen hinaufgeht, jedes Mal wie zum ersten Mal die große Halle mit den Marmorsäulen durchquert, um schließlich an der Bar einen völlig überteuerten Carlos Magno zu bestellen. In diesem Film spielt sie die Hauptrolle und täuscht selbst den aufmerksamsten Zuschauer: sich selbst.
Die Vorräte gehen zu Ende. Ihre letzte Zigarette entpuppt sich als Papierfalte im zerknitterten Päckchen. Ines schaut auf. Zwei Tische weiter hält ihr eine Frau ein aufgeklapptes Zigarettenetui hin. Bewegt sich nicht. Lächelt erst, als sie schon lange bei ihr sitzt.
Wien, Februar 1990
Sie besichtigen nichts. Laufen einfach Hand in Hand durch die Straßen oder bleiben im Hotel. Nur einmal am Abend gehen sie aus. Schlendern über eine Kirmes. Kaufen Lose. Ziehen Nieten. Essen Granatäpfel.
„Soll ich dir was schießen?“ fragt Ines.
Sofia nickt, und Ines legt das Gewehr an. Aufrecht stehend zielt sie auf das weiße Plastikröhrchen und knallt es weg. Lädt sicher nach und legt die ganze mittlere Reihe um. Zwanzig Mal. Der Schießbudenbesitzer schaut ungläubig auf die zu Boden gefallenen oder in Schieflage geratenen Rosen, sammelt sie ein und hält sie ihr hin. Ines schüttelt den Kopf und zeigt auf Sofia. Die grinst und nimmt ihm die Blumen aus der Hand.
„Wofür?“ fragt sie im Weitergehen und riecht an dem Plastik.
„Ja ljublu tebja“, antwortet Ines und küsst sie flüchtig in die Luft.
„Ich muss“, ruft Silke und reißt ihre Jacke von der Garderobe, „sofort ins Krankenhaus.“
Auf der Straße winkt sie ein Taxi heran.
„In die Uniklinik, Notaufnahme, schnell.“
Als sie dort ankommt, ist Anna schon nicht mehr da.
„Sind Sie eine Angehörige?“
„Ich bin ihre Freundin.“
Der junge Arzt legt den Kopf ein wenig schief, als könnte er das für einen Schwindel halten.
„Ihre Lebensgefährtin“, sagt sie in einem Ton zwischen Bestimmtheit und Kontrollverlust.
„Verstehe“, antwortet der weiße Riese und streckt ihr die Hand hin.
Anna würde diese Szene nicht mögen. Wichtigtuerei, würde sie sagen. Der Arzt nimmt sie am Arm, schiebt sie neben sich den Gang entlang, der aussieht wie die Kulisse eines futuristischen Actionfilms: metallene Schiebetüren, bunte Knöpfe, geschäftig rauschende Raumschiff-Besatzung in grün, hellblau und weiß.
„Ihre Freundin ist schwer verletzt.“ Er macht eine Pause, bleibt stehen, sieht sie von der Seite an: „Lebensgefährlich verletzt.“
Sie nickt. Als ob sie verstünde.
„Was ist passiert?“
„Ein herabfallendes Brett aus einem Baugerüst hat sie getroffen.“
Der Himmel, denkt sie, ihr ist tatsächlich der Himmel auf den Kopf gefallen.
„Eines Tages“, hört sie Anna sagen, „erschlägt mich ein Dachziegel.“ Und mit verstellter Stimme: „Gib Acht, mein Freund, ein gräuslicher Ziegelstein, von Abend kommend, hat zum Ziele deinen Kopf sich erkoren.“
„Wann?“ fragt Silke tonlos.
„Heute Mittag. Sie wurde gegen eins eingeliefert. Wir haben sofort operiert. Sie liegt im künstlichen Koma.“
„Kann ich zu ihr?“
„Sie können in ihre Nähe.“
Du. Das dort hinter der Glasscheibe bist du. Dein Kopf und alles, was du jemals gedacht hast, ist eingewickelt in einen weißen Verband, dein Gesicht so klein, dass ich dich kaum wiedererkenne, obwohl ich dich im Schlaf auswendig weiß.
„Fass mich nicht an“, hast du heute Morgen gesagt, „ich will, dass du mich nie wieder anfasst.“
Hier bist du vor jeder Berührung meiner Liebe sicher. Musstest du soweit gehen?
Sie stellen mir einen Stuhl hin, und wenn ich will, kann ich auf einer Liege übernachten. Eine Krankenschwester bringt mir eine Tasse Kaffee. Mir, der größten Schlampe auf Gottes Erdboden, wie du mich vor ein paar Stunden noch nanntest.
Meine Sachen stehen gepackt im Flur. Du solltest mich heute Abend nicht mehr zu Hause antreffen. Ich wollte die nächsten Tage bei Christine bleiben. Fort von dir. Fort von Benjamin. Fort von uns.
„Tot. Ich erkläre uns für tot, hörst du?“ hast du gebrüllt.
Ja, ich habe gehört. Und jetzt sehe ich dich. Nur noch halb am Leben und allein. Beobachte, wie dein Herz schlägt. Der Monitor zeichnet einen Strich, der unregelmäßig nach oben und unten zuckt. Wenn der Schlag zum Stillstand kommt, verläuft eine gerade Linie ins Nichts. Dann ist der Film zu Ende.
Wie fühlt es sich an? Ein dumpfer Schlag auf den Kopf? Hast du es kommen sehen? Zufällig in den Himmel geschaut, wie du es oft tust, weil du die Hoffnung nicht aufgibst, einem Engel zu begegnen? Bist du die Frau, die ich liebe? Nein. Du bist eine der Frauen, die ich liebe. Ich kann mich nicht versprechen. Dabeibleiben ist alles, was ich zu bieten habe. Deshalb bin ich hier.
Du rührst dich nicht. Ich habe das Licht auf meiner Seite der Scheibe gelöscht. Du dagegen bist hell erleuchtet, spielst die Hauptrolle in diesem Stück ohne Vorhang. Von Zeit zu Zeit kommt ein Statist auf die Bühne, liest auf den Geräten Zahlen ab.
Wie soll ich es Benjamin erklären? Bin ich seine Mutter, solange du es nicht sein kannst? Und wenn du nicht wiederkommst? Habe ich dann ein Kind, das ich nie wollte, das mir nicht zusteht, das mir kein Gericht der Welt zusprechen wird?
Du wirst nie wieder dieselbe sein. Wenn du dies hier überlebst, kommst du von hinter Glas zurück. Möglicherweise verrückt. Erschüttert. Verändert. Anna. Deinen Namen kann man herumdrehen, und er bleibt gleich. Auch wenn dein Inneres den Salto Mortale übt.
„Gehen Sie doch nach Hause“, sagt der Arzt. „Wir rufen sofort an, wenn ihr Zustand sich verändert.“
Er versteht nicht, dass ich zu Hause bin, wo du bist. Auch, wenn du mich hinausgeworfen hast. Auch wenn ich fremde Körper in Hotels liebe. Fremde Körper sind unverbindlich und unsterblich. Deiner nicht. Deiner ist die Zuflucht einer Seele, die mich angeht. In jedem Zustand. Schreiend, lachend, schweigend. Jetzt bist du ein verschlossenes Buch, das ich stotternd lesen lerne, dessen Ende der Anfang meiner Sprachlosigkeit ist. Die Stille, in der du schwebst, berührt mein Herz.