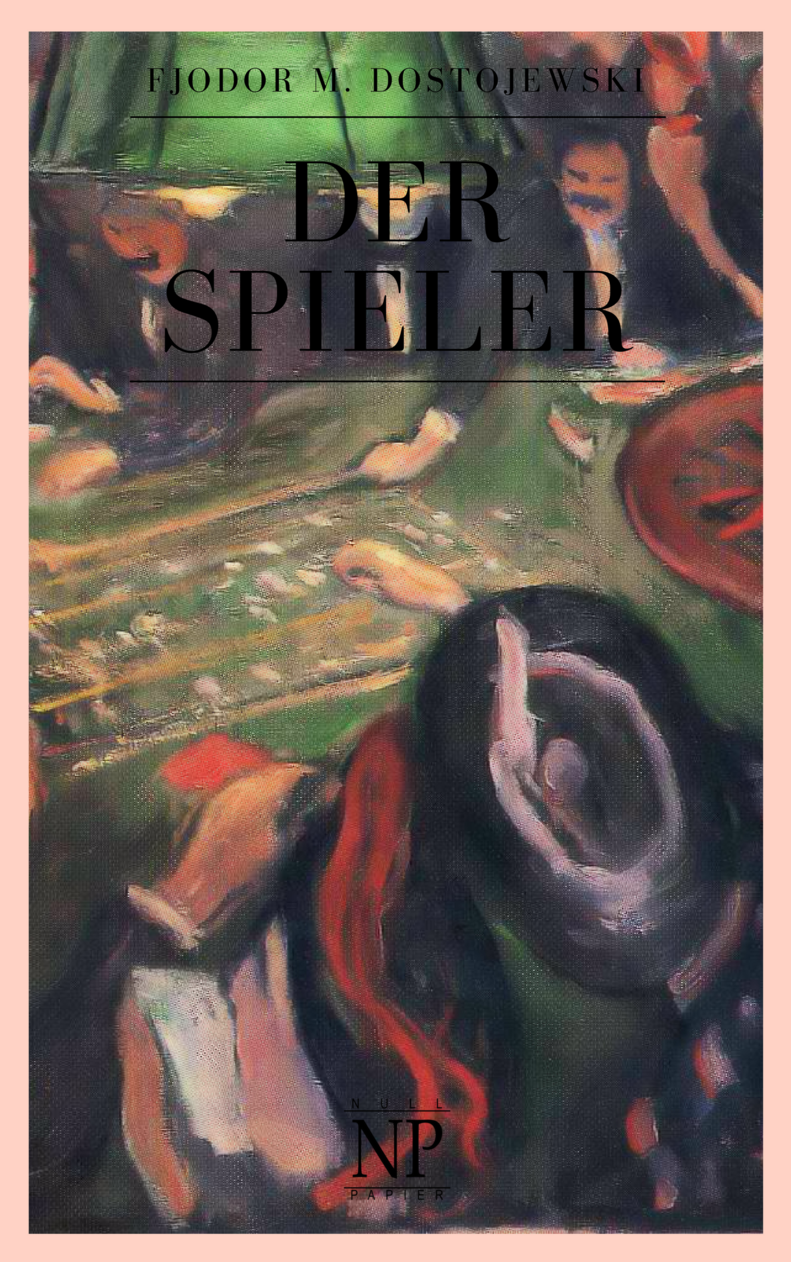
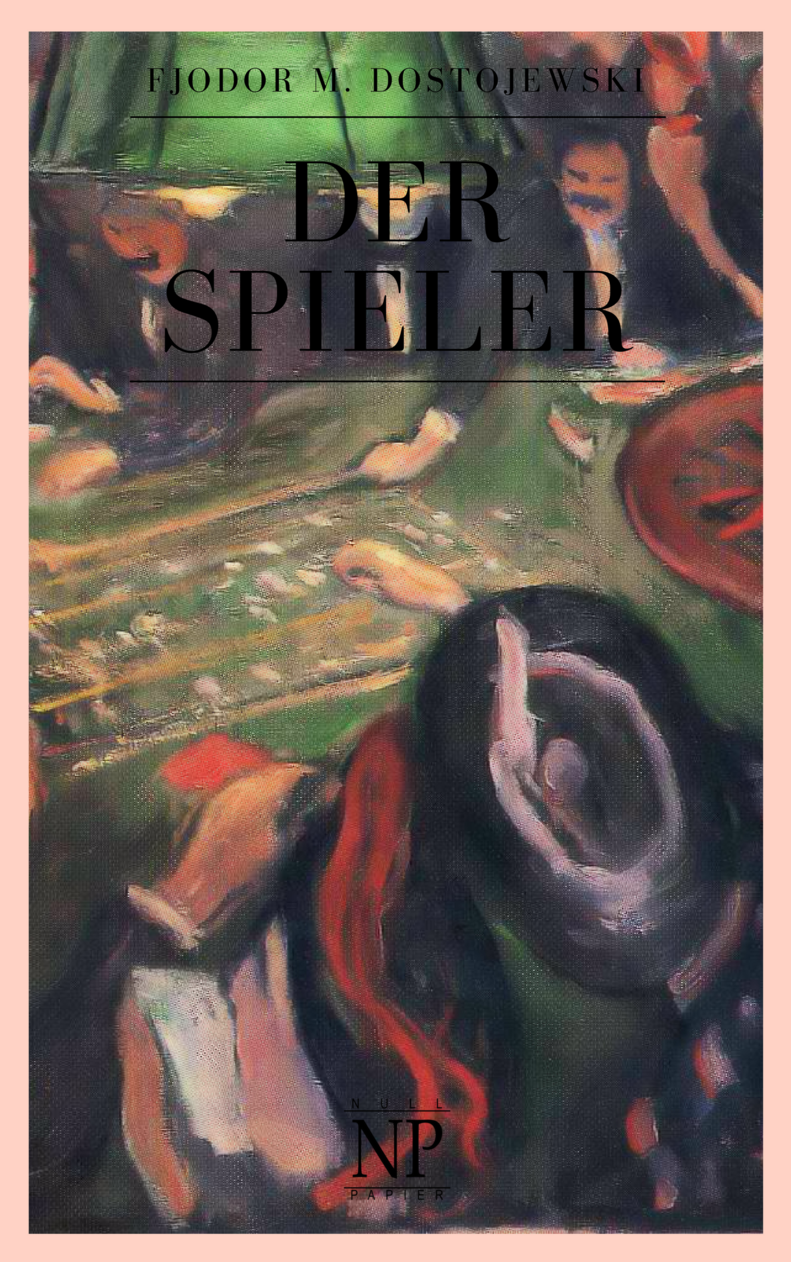
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Der Spieler
Aus den Aufzeichnungen eines jungen Mannes
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Der Spieler
Aus den Aufzeichnungen eines jungen Mannes
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2019
Übersetzung: Hermann Röhl
EV: Insel-Verlag, Leipzig, 1919
2. Auflage, ISBN 978-3-954183-35-7
www.null-papier.de/derspieler
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Autor und Werk
Die wichtigsten handelnden Personen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr
Jürgen Schulze
Der Newsletter informiert Sie über:
https://null-papier.de/newsletter
»Der Spieler« ist ein Roman von Fjodr Michailowitsch Dostojewski.
Erzählt wird die komische, gelegentlich ins Groteske abrutschende Geschichte einer Gruppe von Menschen, in der jeder für sich kurz vor dem finanziellen Ruin steht. Im erfundenen Kurort Roulettenburg lauert man auf den Tod der reichen Erbtante und die damit eintretende, errettende Erbschaft. Doch statt der Nachricht über ihr erwartetes Ableben erscheint die Tante selbst, die sich bester Gesundheit erfreut und zum Schrecken aller das Roulettespiel für sich entdeckt.
»Der Spieler« wird 1866 bald nach »Schuld und Sühne« veröffentlicht. Dostojewski hatte Spielschulden, und sein Verleger Stellowski forderte eine schnellstmögliche Fertigstellung. Der Roman trägt autobiografische Züge, so ist in Roulettenburg unschwer Wiesbaden zu erkennen, wo Dostojewski erstmalig mit Roulette in Berührung kam. Präzise Kenntnisse rund um das Glückspieler-Milieu kennzeichnen diese Geschichte, die der Autor in Rekordzeit seiner Stenotypistin und späteren Ehefrau Anna diktierte.
»Der Spieler« ist die Vorlage für Sergei Prokofjews gleichnamige Oper von 1917 sowie für mehrere Verfilmungen.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (geb. 11. November 1821 in Moskau; gest. 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg) gilt als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller.
Fjodor Dostojewski war das zweite Kind von Michail Andrejewitsch Dostojewski und Maria Fjodorowna Netschajewa. Er hatte zwei Brüder und drei Schwestern. Die Familie entstammte verarmtem Adel; der Vater war Arzt. Nach dem Tod seiner Mutter, 1837, ließ sich Dostojewski mit seinem Bruder Michail in St. Petersburg nieder, wo er von 1838 bis 1843 Bauingenieurwesen studierte. 1839 soll sein Vater auf dem heimischen Landgut durch Leibeigene ermordet worden sein.
Dostojewski war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe mit der Witwe Maria Dmitrijewna Isajewa endete 1864 nach sieben Jahren mit dem Tod Marias und war kinderlos. Seine zweite Frau war Anna Grigorjewna Snitkina. Aus der am 15. Februar 1867 geschlossenen Ehe, die bis zu Dostojewskis Tod andauerte, gingen vier Kinder hervor, von denen jedoch nur zwei das Erwachsenenalter erreichten.
Dostojewski begann 1844 mit den Arbeiten zu seinem 1846 veröffentlichten Erstlingswerk »Arme Leute«. Mit dessen Erscheinen wurde er schlagartig berühmt; die zeitgenössische Kritik feierte ihn als Genie. 1847 trat er dem revolutionären Zirkel bei. 1949 denunzierte man ihn, und er wurde zum Tode verurteilt. Eigentlich hätte er am 22. Dezember 3. Januar 1850 durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden sollen. Erst auf dem Richtplatz begnadigte Zar Nikolaus I. ihn zu vier Jahren Verbannung und Zwangsarbeit in Sibirien, mit anschließender Militärdienstpflicht. In der Haft in Omsk wurde bei Dostojewski zum ersten Mal Epilepsie diagnostiziert.
1854 trat er seine Militärpflicht im Rahmen seiner Verbannung in Semei (Semipalatinsk) an; 1856 wurde er zum Offizier befördert. Nach seiner Heirat 1857 und schweren epileptischen Anfällen beantragte er seine Entlassung aus der Armee, die jedoch erst 1859 bewilligt wurde, sodass Dostojewski nach St. Petersburg zurückkehren konnte.
1859, noch zur Zeit seiner sibirischen Verbannung, entstand sein Roman »Onkelchens Traum«, unmittelbar vor den »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (1860).
Gemeinsam mit seinem Bruder gründete er die Zeitschrift »Zeit« (Wremja), in der im darauf folgenden Jahr sein Roman »Erniedrigte und Beleidigte« erschien.
Bereits 1863 jedoch fiel die Zeitschrift der Zensur zum Opfer und wurde verboten. In der 1860er Jahren reist Dostojewski mehrmals durch Europa.
1863 spielte er zum ersten Mal Roulette. 1864 starben in kurzer Folge Dostojewskis erste Frau, sein Bruder und sein Freund Apollon Grigorjew; die Nachfolgezeitschrift der »Zeit«, die »Epoche«, musste er aus Geldmangel einstellen.
1865 verspielte er beim Roulette in der Spielbank in Wiesbaden seine Reisekasse. Im Mittelpunkt seines 1866 erschienenen Romans »Der Spieler« steht ein Roulettespieler. Im selben Jahr erschien der erste der großen Romane, durch die Dostojewskis Werk Teil der Weltliteratur wurde: »Schuld und Sühne« (oder auch in der Neuübersetzung: »Verbrechen und Strafe«).
Kurz nach seiner zweiten Eheschließung, 1867, nach dem Zusammenbruch der mit seinem Bruder gegründeten zweiten Zeitschrift ins Ausland, um sich dem Zugriff seiner Gläubiger zu entziehen. Er wohnte längere Zeit in Dresden.
Erst 1871 kehrte er wieder nach Russland zurück. Entgegen der weitverbreiteten Annahme, Dostojewski habe große Beträge am Roulettetisch verloren, war er ein Spieler mit geringen Einsetzen, der oft tagelang mit dem Geld eines gerade verpfändeten Kleides seiner Frau spielte.
1868 erschien sein zweites Großwerk, »Der Idiot«, die Geschichte des Fürsten Myschkin, der (wie Dostojewski selbst) unter Epilepsie leidet und aufgrund seiner Güte, Ehrlichkeit und Tugendhaftigkeit in der St. Petersburger Gesellschaft scheitert.
Zu seinem Ende hin verlief das Leben Dostojewskis in ruhigeren Bahnen. Er verfasste seine beiden letzten großen Werke, den Roman »Der Jüngling« – in der Neuübersetzung »Ein grüner Junge« – und schließlich den Roman »Die Brüder Karamasow«, den er in den 1860er Jahren, also in der Zeit der Entstehung von »Schuld und Sühne«, begonnen hatte und der die Entwicklung der russischen Gesellschaft bis in die 1880er Jahre behandeln sollte.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski starb am 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg an einem Lungenemphysem; an seinem Begräbnis nahmen 60.000 Menschen teil. Sein Grab befindet sich auf dem Tichwiner Friedhof des Alexander-Newski-Klosters.
Der General: Witwer
Polina Alexêndrowna, auch Praskówja: seine Stieftochter
Alexéj Iwênowitsch: Hauslehrer im Hause des Generals, Spieler und Erzähler dieses Romans
Mademoiselle Blanche de Cominges, alias Mademoiselle Barberini, alias Mademoiselle Selma, alias Mademoiselle du Placet: Verlobte und spätere Frau des Generals
Antonída Wassíljewna Tarassewitschewa: Gutsbesitzerin, Tante des Generals
Marquis de Grieux: Gläubiger des Generals
Mister Astley: englischer Zuckerfabrikant
Weitere Personen
Mêrja Filíppowna: Schwester des Generals
Míscha und Nêdja: seine Kinder
Fedósja: Kinderfrau im Hause des Generals
Madame veuve de Cominges: Mutter von Mademoiselle Blanche
Potêpytsch: Haushofmeister von Antonída Wassíljewna Tarasséwitschewa
Mêrfa: ihre Zofe
Endlich bin ich nach vierzehntägiger Abwesenheit zurückgekehrt. Die Unsrigen befinden sich schon seit drei Tagen in Roulettenburg. Ich hatte geglaubt, sie warteten bereits auf mich mit der größten Ungeduld; indes ist dies meinerseits ein Irrtum gewesen. Der General zeigte eine sehr stolze, selbstbewusste Miene, sprach mit mir ein paar Worte sehr von oben herab und schickte mich dann zu seiner Schwester. Offenbar waren sie auf irgendwelche Weise zu Geld gekommen. Es kam mir sogar so vor, als sei es dem General einigermaßen peinlich, mich anzusehen. Marja Filippowna hatte außerordentlich viel zu tun und redete nur flüchtig mit mir; das Geld nahm sie aber in Empfang, rechnete es nach und hörte meinen ganzen Bericht an. Zum Mittagessen erwarteten sie Herrn Mesenzow, außerdem noch einen kleinen Franzosen und einen Engländer. Das ist bei ihnen einmal so Brauch: sobald Geld da ist, werden auch gleich Gäste zum Diner eingeladen, ganz nach Moskauer Art. Als Polina Alexandrowna mich erblickte, fragte sie mich, was ich denn solange gemacht hätte; aber sie entfernte sich dann, ohne meine Antwort abzuwarten. Selbstverständlich tat sie das mit Absicht. Indessen müssen wir uns notwendigerweise miteinander aussprechen. Es hat sich viel Stoff angesammelt.
Es wurde mir ein kleines Zimmer im vierten Stock des Hotels angewiesen. Hier ist bekannt, dass ich »zur Begleitung des Generals« gehöre. Aus allem war zu entnehmen, dass sie es bereits verstanden hatten, sich ein Ansehen zu geben. Den General hält hier jedermann für einen steinreichen russischen Großen. Noch vor dem Diner gab er mir, außer anderen Kommissionen, auch den Auftrag, zwei Tausendfrancscheine, die er mir einhändigte, zu wechseln. Ich bewerkstelligte das im Büro des Hotels. Nun werden wir, wenigstens eine ganze Woche lang, für Millionäre gehalten werden. Ich wollte mit Mischa und Nadja spazierengehen, wurde aber, als ich schon auf der Treppe war, zum General zurückgerufen; er hielt es für nötig, mich zu fragen, wohin ich mit den Kindern gehen wolle. Dieser Mann ist schlechterdings nicht imstande, mir gerade in die Augen zu sehen; in dem Wunsch, es doch fertigzubringen, versucht er es öfters; aber ich antworte ihm jedes Mal mit einem so unverwandten, respektlosen Blick, dass er ordentlich verlegen wird. In sehr schwülstiger Redeweise, wobei er eine hohle Phrase an die andere reihte und schließlich völlig in Verwirrung geriet, gab er mir zu verstehen, ich möchte mit den Kindern irgendwo im Park spazierengehen, in möglichst weiter Entfernung vom Kurhaus. Zum Schluss wurde er ganz ärgerlich und fügte in scharfem Ton hinzu: »Also bitte, führen Sie sie nicht ins Kurhaus zum Roulett. Nehmen Sie es mir nicht übel; aber ich weiß, Sie sind noch ziemlich leichtsinnig und wären vielleicht imstande, sich am Spiel zu beteiligen. Ich bin zwar nicht Ihr Mentor und hege auch gar nicht den Wunsch, eine solche Rolle zu übernehmen; aber jedenfalls habe ich wenigstens ein Recht darauf, mich von Ihnen nicht kompromittiert zu sehen, um mich so auszudrücken.«
»Ich habe ja gar kein Geld«, antwortete ich ruhig. »Um Geld verspielen zu können, muss man doch welches besitzen.«
»Geld sollen Sie sofort erhalten«, erwiderte der General, wühlte in seinem Schreibtisch umher, nahm ein kleines Buch heraus und sah darin nach; es ergab sich, dass er mir ungefähr hundertzwanzig Rubel schuldig war.
»Wie wollen wir also unsere Rechnung erledigen?« sagte er; »wir müssen es in Taler umrechnen. Nehmen Sie da zunächst hundert Taler; das ist eine runde Summe; das übrige bleibt Ihnen natürlich sicher.«
Ich nahm das Geld schweigend hin.
»Sie müssen sich durch meine Worte nicht gekränkt fühlen; Sie sind so empfindlich … Ich wollte Sie durch meine Bemerkung nur sozusagen warnen, und das zu tun habe ich doch natürlich ein gewisses Recht …«
Als ich vor dem Mittagessen mit den Kindern nach Hause zurückkehrte, fand ich eine ganze Kavalkade vor. Die Unsrigen machten einen Ausflug, um eine Ruine zu besuchen. Eine schöne Equipage, mit prächtigen Pferden bespannt, hielt vor dem Hotel; darin saßen Mademoiselle Blanche, Marja Filippowna und Polina; der kleine Franzose, der Engländer und unser General waren zu Pferde. Die Passanten blieben stehen und schauten; der Effekt war großartig, kam aber dem General verhältnismäßig teuer zu stehen. Ich rechnete mir aus: wenn man die viertausend Franc, die ich mitgebracht hatte, und das Geld, das sie inzwischen augenscheinlich erlangt hatten, zusammennahm, so mochten sie jetzt sieben- oder achttausend Franc haben. Das war für Mademoiselle Blanche eine gar zu geringe Summe.
Mademoiselle Blanche wohnt gleichfalls in unserem Hotel, und zwar mit ihrer Mutter; desgleichen auch unser kleiner Franzose. Die Hoteldienerschaft nennt ihn »Monsieur le comte«, und Mademoiselle Blanches Mutter wird »Madame la comtesse« betitelt; nun, vielleicht sind sie auch wirklich ein Graf und eine Gräfin.
Ich wusste vorher, dass Monsieur le comte mich nicht erkennen werde, als wir uns nach dem Mittagessen zusammenfanden. Dem General kam es natürlich nicht in den Sinn, uns miteinander bekannt zu machen oder auch nur mich ihm vorzustellen; Monsieur le comte aber hat sich selbst in Russland aufgehalten und weiß, was für eine unbedeutende Person ein Hauslehrer in Russland ist. Er kennt mich übrigens recht gut. Aber, die Wahrheit zu gestehen, ich erschien beim Mittagessen, ohne überhaupt dazu aufgefordert zu sein; der General hatte wohl vergessen, eine Anordnung darüber zu treffen; sonst hätte er mich wahrscheinlich geheißen, an der Table d’hôte1 zu essen. Ich stellte mich von selbst ein, sodass der General mir einen unzufriedenen Blick zuwarf. Die gute Marja Filippowna wies mir sogleich einen Platz an; aber mein früheres Zusammentreffen mit Mister Astley half mir aus der Verlegenheit, und so wurde ich, wie wenn das selbstverständlich wäre, als berechtigtes Mitglied dieser Gesellschaft angesehen.
Mit diesem sonderbaren Engländer war ich zum ersten Mal in Preußen zusammengetroffen, im Eisenbahnwagen, wo wir uns gegenübersaßen, als ich in Eile den Unsrigen nachreiste. Dann war ich jetzt auf ihn gestoßen, als ich nach Frankreich hineinfuhr, und endlich in der Schweiz, also während dieser zwei Wochen zweimal. Und nun kam ich mit ihm plötzlich hier in Roulettenburg zusammen. Nie in meinem Leben habe ich einen Menschen gefunden, der schüchterner gewesen wäre; seine Schüchternheit streift schon an Dummheit, und er selbst weiß das natürlich, da er ganz und gar nicht dumm ist. Im übrigen ist er ein sehr lieber, stiller Mensch. Gleich bei der ersten Begegnung in Preußen fasste er ein solches Zutrauen zu mir, dass er ganz gesprächig wurde. Er teilte mir mit, er sei in diesem Sommer am Nordkap gewesen und habe große Lust, sich die Messe in Nischni-Nowgorod anzusehen. Ich weiß nicht, wie er mit dem General bekannt wurde; mir scheint, dass er bis über die Ohren in Polina verliebt ist. Als sie eintrat, wurde sein Gesicht rot wie der Himmel beim Aufgang der Sonne. Er freute sich sehr darüber, dass ich bei Tisch neben ihm saß, und scheint mich schon als seinen Busenfreund zu betrachten.
Bei Tisch spielte sich der kleine Franzose stark auf und benahm sich gegen alle geringschätzig und hochmütig. Und dabei weiß ich noch recht gut, wie knabenhaft er in Moskau zu reden pflegte. Er sprach jetzt furchtbar viel über Finanzwesen und über die russische Politik. Der General raffte sich mitunter dazu auf, ihm zu widersprechen, aber nur in bescheidener Weise und lediglich in der Absicht, auf seine Würde nicht völlig Verzicht zu leisten.
Ich befand mich in einer eigentümlichen Stimmung. Selbstverständlich legte ich mir, schon ehe noch die Mahlzeit halb zu Ende war, meine gewöhnliche, stete Frage vor: »Warum gebe ich mich mit diesem General ab und bin nicht schon längst von all diesen Menschen weggegangen?« Mitunter blickte ich zu Polina Alexandrowna hin; sie schenkte mir gar keine Beachtung. Schließlich wurde ich ärgerlich und bekam Lust, grob zu werden.
Ich machte den Anfang damit, dass ich mich auf einmal ohne jede Veranlassung laut und ungefragt in ein fremdes Gespräch einmischte. Namentlich hatte ich den Wunsch, mich mit dem kleinen Franzosen zu zanken. Ich wandte mich an den General und bemerkte, indem ich ihn unterbrach, auf einmal sehr laut und in sehr bestimmtem Ton, es sei in diesem Sommer für Russen so gut wie unmöglich, in den Hotels an der Table d’hôte zu speisen. Der General warf mir einen verwunderten Blick zu.
»Wenn man einige Selbstachtung besitzt«, fuhr ich fort, »so gerät man unfehlbar in Streit und setzt sich argen Beleidigungen aus. In Paris und am Rhein, sogar in der Schweiz sitzen an der Table d’hôte so viel Polen und so viel Franzosen, die mit ihnen sympathisieren, dass es unmöglich ist, ein Wort zu reden, wenn man bloß Russe ist.«
Ich hatte das auf französisch gesagt. Der General sah mich ganz verblüfft an und wusste nicht, sollte er sich darüber ärgern oder sich nur darüber wundern, dass ich mich so vergessen hatte.
»Es hat Ihnen gewiss irgendwo jemand eine Lektion erteilt«, sagte der kleine Franzose in nachlässigem, geringschätzigem Ton.
»In Paris stritt ich mich einmal zuerst mit einem Polen herum«, antwortete ich, »und dann mit einem französischen Offizier, der die Partei des Polen nahm. Darauf aber ging ein Teil der Franzosen auf meine Seite über, als ich ihnen erzählte, dass ich einmal einem Monsignore hätte in den Kaffee spucken wollen.«
»Spucken?« fragte der General mit würdevollem Erstaunen und blickte rings um sich. Der kleine Franzose sah mich ungläubig an.
»Allerdings«, erwiderte ich. »Da ich ganze zwei Tage lang glaubte, dass ich in unserer geschäftlichen Angelegenheit möglicherweise würde für ein Weilchen nach Rom reisen müssen, so ging ich in die Kanzlei der Gesandtschaft des Heiligen Vaters in Paris, um meinen Pass visieren zu lassen. Dort fand ich so einen kleinen Abbé, etwa fünfzig Jahre alt, ein dürres Männchen mit kalter Miene; der hörte mich zwar höflich, aber sehr gleichgültig an und ersuchte mich zu warten. Obwohl ich es eilig hatte, setzte ich mich natürlich doch hin, um zu warten, zog die Opinion nationale aus der Tasche und begann eine furchtbare Schimpferei auf Russland zu lesen. Währenddessen hörte ich, wie jemand durch das anstoßende Zimmer zu dem Monsignore ging, und sah, wie mein Abbé ihn durch eine Verbeugung grüßte. Ich wandte mich noch einmal an ihn mit meiner früheren Bitte; aber in noch trocknerem Ton ersuchte er mich wieder zu warten. Bald darauf trat noch jemand ein, kein Bekannter, sondern einer, der ein geschäftliches Anliegen hatte, ein Österreicher; er wurde angehört und sogleich nach oben geleitet. Da wurde ich nun aber sehr ärgerlich; ich stand auf, trat an den Abbé heran und sagte zu ihm in entschiedenem Ton, da der Monsignore empfange, so könne er auch mich abfertigen. Mit einer Miene des äußersten Erstaunens wankte der Abbé vor mir zurück. Es war ihm geradezu unfassbar, wie so ein wertloser Russe es wagen könne, sich mit den anderen Besuchern des Monsignore auf eine Stufe zu stellen. Im unverschämtesten Ton, wie wenn er sich darüber freute, mich beleidigen zu können, rief er, indem er mich vom Kopf bis zu den Füßen mit seinen Blicken maß: ›Meinen Sie wirklich, dass Monsignore um Ihretwillen seinen Kaffee stehenlassen wird?‹ Nun fing ich gleichfalls an zu schreien, aber noch stärker als er: ›Spucken werde ich Ihrem Monsignore in seinen Kaffee; das mögen Sie nur wissen! Wenn Sie meinen Pass nicht augenblicklich fertigmachen, so gehe ich zu ihm selbst hin.‹
›Wie? Während der Kardinal bei ihm ist?‹ rief der kleine Abbé, indem er erschrocken von mir wegtrat, zur Tür eilte, die Arme kreuzweis übereinanderlegte und dadurch zu verstehen gab, dass er eher sterben als mich durchlassen wolle. Da antwortete ich ihm, ich sei ein Ketzer und ein Barbar, que je suis hérétique et barbare,2 und all diese Erzbischöfe, Kardinäle, Monsignori usw. seien mir absolut gleichgültig. Kurz, ich machte Miene, meinen Willen durchzusetzen. Der Abbé blickte mich mit grenzenlosem Ingrimm an; dann riss er mir meinen Pass aus der Hand und ging mit ihm nach oben. Eine Minute darauf war er schon visiert. ›Da ist er; wollen Sie ihn sich ansehen?‹ Ich zog den Pass heraus und zeigte das römische Visum.«
»Aber da haben Sie denn doch …«, begann der General.
»Das hat Sie gerettet, dass Sie sich als einen Barbaren und Ketzer bezeichneten«, bemerkte der kleine Franzose lachend. »Cela n’était pas si bête.«3
»Sollen wir Russen uns so behandeln lassen? Aber unsere Landsleute sitzen hier, wagen nicht, sich zu mucken, und verleugnen wohl gar ihre russische Nationalität. Aber wenigstens in Paris, in meinem Hotel, gingen die Leute mit mir weit respektvoller um, nachdem ich allen mein Renkontre mit dem Abbé erzählt hatte. Ein dicker polnischer Pan, der an der Table d’hôte am feindseligsten gegen mich aufgetreten war, sah sich völlig in den Hintergrund gedrängt. Die Franzosen nahmen es sogar geduldig hin, als ich erzählte, dass ich vor zwei Jahren einen Menschen gesehen hätte, auf den im Jahre 1812 ein französischer Chasseur geschossen habe, einzig und allein, um sein Gewehr zu entladen. Dieser Mensch war damals noch ein zehnjähriger Knabe gewesen, und seine Familie hatte nicht Zeit gefunden, aus Moskau zu flüchten.«
»Das ist unmöglich!« fuhr der kleine Franzose auf. »Ein französischer Soldat wird nie auf ein Kind schießen!«
»Und es ist trotzdem wahr«, erwiderte ich. »Der Betreffende, nun ein achtungswerter Hauptmann a. D., hat es mir selbst erzählt, und ich habe auf seiner Backe die Schramme von der Kugel selbst gesehen.«
Der Franzose opponierte mit großem Wortschwall und in schnellem Tempo. Der General wollte ihm dabei behilflich sein; aber ich empfahl ihm, beispielsweise einzelne Abschnitte aus den Memoiren des Generals Perowski zu lesen, der sich im Jahre 1812 in französischer Gefangenschaft befunden hatte. Endlich begann Marja Filippowna, um dieses Gespräch abzubrechen, von etwas anderem zu reden. Der General war sehr unzufrieden mit mir, weil ich und der Franzose schon beinahe ins Schreien hineingeraten waren. Aber Mister Astley hatte, wie es schien, an meinem Streit mit dem Franzosen großes Gefallen gefunden; als wir vom Tisch aufstanden, lud er mich ein, mit ihm ein Glas Wein zu trinken.
Am Abend gelang es mir, wie das ja auch dringend erforderlich war, eine Viertelstunde lang mit Polina Alexandrowna zu sprechen. Unser Gespräch kam auf dem Spaziergang zustande. Alle waren in den Park zum Kurhaus gegangen. Polina setzte sich auf eine Bank, der Fontäne gegenüber, und gestattete der kleinen Nadja in ihrer Nähe mit anderen Kindern zu spielen. Ich ließ Mischa gleichfalls zur Fontäne gehen, und so blieben wir beide endlich allein.
Zuerst begannen wir natürlich von den geschäftlichen Angelegenheiten zu reden. Polina wurde geradezu böse, als ich ihr insgesamt nur siebenhundert Gulden einhändigte. Sie hatte mit Bestimmtheit geglaubt, ich würde ihr aus Paris als Erlös von der Verpfändung ihrer Brillanten mindestens zweitausend Gulden oder sogar noch mehr mitbringen.
»Ich brauche unter allen Umständen Geld«, sagte sie. »Beschafft muss es werden; sonst bin ich einfach verloren.«
Ich fragte, was sich an Ereignissen während meiner Abwesenheit zugetragen habe.
»Weiter nichts, als dass wir aus Petersburg zwei Nachrichten erhielten: zuerst die, dass es der alten Tante sehr schlecht gehe, und zwei Tage darauf eine andere, dass sie, wie es verlaute, schon gestorben sei. Diese letztere Nachricht stammt von Timofej Petrowitsch«, fügte Polina hinzu, »und das ist ein verlässlicher Mensch. Wir warten nun auf die letzte, endg ültige Nachricht.«
»Also befinden sich hier alle in gespannter Erwartung?« fragte ich.
»Gewiss, allesamt; seit einem halben Jahr leben sie nur von dieser Hoffnung.«
»Und auch Sie hoffen darauf?«
»Verwandt bin ich ja mit ihr eigentlich überhaupt nicht; ich bin nur eine Stieftochter des Generals. Aber ich glaube bestimmt, dass sie in ihrem Testament meiner gedacht haben wird.«
»Ich meine, es wird Ihnen eine bedeutende Summe zufallen«, erwiderte ich zustimmend.
»Ja, sie hatte mich gern; aber wie kommen gerade Sie zu dieser Meinung?«
»Sagen Sie«, antwortete ich mit einer Frage, »unser Marquis ist wohl gleichfalls in alle Familiengeheimnisse eingeweiht?«
»Warum interessiert Sie denn das?« fragte Polina, indem sie mich kühl und unfreundlich anblickte.
»Nun, das ist doch sehr natürlich. Wenn ich nicht irre, hat der General schon Geld von ihm geborgt.«
»Ihre Vermutung trifft durchaus zu.«
»Nun also; hätte der denn etwa das Geld hergegeben, wenn er nicht über die alte Tante orientiert wäre? Haben Sie nicht bei Tisch bemerkt: als er irgend etwas von ihr sagte, nannte er sie etwa dreimal ›Großmamachen‹. Was für ein vertrauliches, freundschaftliches Verhältnis!«
»Ja, Sie haben recht. Und sobald er erfahren wird, dass auch mir etwas durch das Testament zufällt, wird er sofort zu mir kommen und um mich werben. Das wollten Sie doch wohl gern wissen.«
»Er wird erst noch werben? Ich dachte, er täte das schon längst.«
»Sie wissen recht gut, dass das nicht der Fall ist«, sagte Polina ärgerlich. »Wo sind Sie denn mit diesem Engländer früher schon zusammengetroffen?« fügte sie nach kurzem Stillschweigen hinzu.
»Das habe ich doch gewusst, dass Sie nach dem sofort fragen würden.« Ich erzählte ihr von meinen früheren Begegnungen mit Mister Astley auf Reisen.
»Er ist schüchtern und liebebedürftig, und natürlich ist er schon in Sie verliebt?«
»Ja, er ist in mich verliebt«, antwortete Polina.
»Und er ist selbstverständlich zehnmal so reich wie der Franzose. Besitzt denn der Franzose wirklich etwas? Ist das nicht sehr zweifelhaft?«
»Nein, zweifelhaft ist das nicht. Er besitzt ein Château. Noch gestern hat der General zu mir mit aller Bestimmtheit davon gesprochen. Genügt Ihnen das?«
»Ich würde an Ihrer Stelle unbedingt den Engländer heiraten.«
»Warum?« fragte Polina.
»Der Franzose ist schöner, aber er hat einen schlechten Charakter; der Engländer dagegen ist nicht nur ein ehrenhafter Mann, sondern auch zehnmal so reich wie der andere«, erklärte ich in entschiedenem Ton.
»Ja, aber dafür ist der Franzose ein Marquis und klüger«, entgegnete sie mit größter Seelenruhe.
»Aber ist das auch sicher?« fragte ich wie vorher.
»Vollständig sicher.«
Polina war über meine Fragen sehr ungehalten, und ich sah, dass sie mich durch den scharfen Ton ihrer Antwort ärgern wollte. Das hielt ich ihr denn auch sofort vor.
»Nun ja, es amüsiert mich wirklich, wie grimmig Sie werden«, entgegnete sie darauf. »Schon allein dafür, dass ich Ihnen erlaube, solche Fragen zu stellen und solche Mutmaßungen zu äußern, müssen Sie einen Preis bezahlen.«
»Ich halte mich in der Tat für berechtigt, Ihnen solche Fragen zu stellen«, antwortete ich ganz ruhig, »namentlich deswegen, weil ich bereit bin, dafür jeden Preis zu zahlen, den Sie verlangen, und mein Leben jetzt für nichts achte.«
Polina lachte.
»Sie haben das letztemal auf dem Schlangenberg zu mir gesagt, Sie seien bereit, sich auf das erste Wort von mir kopf- über hinabzustürzen, und es geht dort, glaube ich, tausend Fuß tief hinunter. Ich werde später einmal dieses Wort aussprechen, lediglich um zu sehen, wie Sie Ihrer Verpflichtung nachkommen, und seien Sie überzeugt, dass ich nicht aus der Rolle fallen werde. Sie sind mir verhasst, besonders weil ich Ihnen soviel erlaubt habe, und in noch höherem Grade deshalb, weil ich Sie so nötig habe. Aber solange Sie mir nötig sind, darf ich Sie nicht zu Schaden kommen lassen.«
Sie stand auf. Sie hatte in gereiztem Ton gesprochen. In der letzten Zeit schloss sie jedes Gespräch, das sie mit mir führte, mit Ingrimm, Gereiztheit und ernstlichem Zorn.
»Gestatten Sie mir die Frage: was für eine Person ist eigentlich diese Mademoiselle Blanche?« fragte ich. Ich wollte sie nicht fortlassen, ohne einige Auskunft von ihr erhalten zu haben.
»Was für eine Person Mademoiselle Blanche ist, das wissen Sie selbst. Neues hat sich seit Ihrer Abreise weiter nicht begeben. Mademoiselle Blanche wird wahrscheinlich Frau Generalin werden, selbstverständlich nur, wenn sich das Gerücht von dem Tod der Tante bestätigt; denn Mademoiselle Blanche und ihre Mutter und ihr entfernter Vetter, der Marquis, wissen alle sehr genau, dass wir ruiniert sind.«
»Ist denn der General ernstlich in sie verliebt?«
»Das geht uns jetzt nichts an. Hören Sie einmal zu, was ich sagen will, und merken Sie es sich genau: nehmen Sie diese siebenhundert Gulden und spielen Sie damit! Gewinnen Sie mir damit am Roulett, soviel Sie nur können: ich brauche jetzt um jeden Preis Geld!«
Hierauf rief sie die kleine Nadja heran und ging nach dem Kurhaus, wo sie sich an die ganze Gesellschaft der Unsrigen anschloss. Ich meinerseits schlug, nachdenklich und verwundert, den erstbesten Steig nach links ein. Von ihrem Auftrag, zum Roulett zu gehen, fühlte ich mich wie vor den Kopf geschlagen. Es ging mir seltsam: ich hatte doch so vieles, worüber ich hätte nachdenken können und sollen; aber dennoch vertiefte ich mich vollständig in eine kritische Prüfung meiner Empfindungen gegenüber Polina. Wahrlich, während meiner vierzehntägigen Abwesenheit war mir leichter ums Herz gewesen als jetzt am Tag meiner Rückkehr, obgleich ich auf der Reise mich wie ein Unsinniger nach ihr gesehnt hatte, wie ein Verrückter umhergerannt war und sogar im Schlaf sie alle Augenblicke vor mir gesehen hatte. Als ich einmal im Waggon eingeschlafen war (es war in der Schweiz), fing ich laut mit Polina zu sprechen an, zur großen Erheiterung aller Mitreisenden. Und jetzt legte ich mir noch einmal die Frage vor: »Liebe ich sie?« Und auch diesmal wieder verstand ich nicht auf diese Frage zu antworten, das heißt, richtiger gesagt, ich antwortete mir zum hundertsten Male wieder, dass ich von Hass gegen sie erfüllt sei. Ja, ich hasste sie. Es gab Augenblicke (namentlich jedes Mal am Schluss unserer Gespräche), wo ich mein halbes Leben dafür gegeben hätte, sie zu erwürgen. Ich schwöre es: wenn ich ihr hätte ein spitzes Messer langsam in die Brust bohren können, so hätte ich, wie ich glaube, nach diesem Messer mit Wonne gegriffen. Und trotzdem schwöre ich bei allem, was heilig ist: hätte sie auf dem Schlangenberg, auf jenem Aussichtspunkt, wirklich zu mir gesagt: »Stürzen Sie sich hinab!«, so würde ich mich sogleich hinabgestürzt haben, und sogar mit Wonne; das weiß ich sicher. Aber nun musste, so oder so, die Entscheidung kommen. Polina hat für all dies ein überaus feines Verständnis, und der Gedanke, dass ich mit vollkommener Klarheit und Richtigkeit ihre ganze Unerreichbarkeit für mich, die ganze Unmöglichkeit der Erfüllung meiner Träumereien einsehe, dieser Gedanke gewährt ihr (davon bin ich überzeugt) einen außerordentlichen Genuss; könnte sie, eine so vorsichtige, kluge Person, denn sonst mit mir in so familiärer, offenherziger Art verkehren? Mir scheint, als habe sie von mir bis jetzt eine ähnliche Anschauung gehabt wie jene Kaiserin des Altertums von ihrem Sklaven, in dessen Gegenwart sie sich entkleidete, weil sie ihn nicht für einen Menschen hielt. Ja, sie hat mich viele, viele Male nicht als einen Menschen angesehen.
Aber nun hatte sie mir einen Auftrag erteilt: am Roulett zu gewinnen, zu gewinnen um jeden Preis. Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, zu welchem Zweck und wie schnell dieser Geldgewinn nötig sei, und was für neue Pläne in diesem fortwährend spekulierenden Kopf entstanden sein mochten. Außerdem hatte sich in diesen vierzehn Tagen offenbar eine Unmenge neuer Ereignisse zugetragen, von denen ich noch keine Ahnung hatte. All dies musste ich enträtseln, in all dies klaren Einblick gewinnen, und zwar so schnell wie möglich. Aber vorläufig, im Augenblick hatte ich dazu keine Zeit: ich musste zum Roulett.
Wörtlich: »Die Tafel des Hausherrn« – Mittagsmenü bzw. Tageskarte <<<
dass ich ketzerisch und barbarisch bin. <<<
Es war nicht so albern. <<<
Ich muss gestehen: dieser Auftrag war mir nicht angenehm. Ich hatte mir zwar vorgenommen gehabt, mich gleichfalls am Spiel zu beteiligen, dabei aber in keiner Weise angenommen, dass ich damit anfangen würde, es für andere zu tun. Das stieß mir gewissermaßen meine Pläne über den Haufen, und so betrat ich denn die Spielsäle in einer recht verdrießlichen Stimmung. Unausstehlich ist mir die Lakaienhaftigkeit in den Feuilletons der Zeitungen der ganzen Welt und namentlich unserer russischen Zeitungen, wo fast in jedem Frühjahr unsere Feuilletonisten von zwei Dingen erzählen: erstens von der prachtvollen, luxuriösen Einrichtung der Spielsäle in den Roulettstädten am Rhein, und zweitens von den Haufen Goldes, die angeblich auf den Tischen liegen. Bezahlt werden ja die Schriftsteller dafür nicht; sie erzählen das aus eigenem Antrieb, aus uneigennütziger Dienstfertigkeit. Von Pracht ist in diesen dürftigen Sälen nicht die Rede, und Gold bekommt man überhaupt kaum zu sehen, geschweige denn, dass es in Haufen auf den Tischen läge. Allerdings, manchmal erscheint im Laufe der Saison plötzlich irgendeine wunderliche Persönlichkeit, ein Engländer oder ein Asiat oder wie in diesem Sommer ein Türke, und verliert oder gewinnt auf einmal eine sehr große Summe; aber alle übrigen spielen um ein paar lumpige Gulden, und im großen und ganzen liegt auf den Tischen immer nur sehr wenig Geld.
Als ich in den Spielsaal trat (es war das erstemal in meinem Leben), konnte ich mich eine Zeit lang nicht dazu entschließen mitzuspielen. Ich fühlte mich durch das dichte Gedränge abgestoßen. Aber auch wenn ich allein dagewesen wäre, auch dann wäre ich wohl am liebsten bald wieder weggegangen und hätte nicht angefangen zu spielen. Ich bekenne: das Herz klopfte mir stark, und ich war nicht kaltblütig; ich glaubte zuverlässig und sagte mir das schon lange mit aller Bestimmtheit, dass es mir nicht beschieden sein werde, aus Roulettenburg so ohne weiteres wieder fortzukommen, dass sich da mit Sicherheit etwas zutragen werde, was für mein Lebensschicksal von tiefgehender, entscheidender Bedeutung sei. Das sei ein Ding der Notwendigkeit und werde so geschehen.
Mag es auch lächerlich sein, dass ich vom Roulett soviel für mich erwarte, für noch lächerlicher halte ich die landläufige, beliebte Meinung, dass es töricht und sinnlos sei, vom Spiel überhaupt etwas zu erwarten. Und warum soll denn das Spiel schlechter sein als irgendein anderes Mittel des Gelderwerbs, zum Beispiel schlechter als der Handel? Das ist ja richtig, dass von hundert nur einer gewinnt. Aber was geht mich das an?
Jedenfalls beschloss ich, zunächst nur zuzusehen und an diesem Abend nichts Ernstliches zu unternehmen. Wenn an diesem Abend überhaupt etwas geschah, so sollte es nur zu- fällig und nebenbei geschehen; das war meine Absicht. Überdies musste ich doch auch das Spiel selbst erst lernen; denn trotz tausend Beschreibungen des Rouletts, die ich stets mit großer Gier gelesen hatte, verstand ich, ehe ich nicht seine Einrichtung selbst gesehen hatte, schlechterdings nichts davon.
Von vornherein erschien mir alles überaus schmutzig, ich meine im übertragenen Sinne garstig und schmutzig. Ich rede nicht von jenen gierigen, unruhigen Gesichtern, die zu Dutzenden, ja zu Hunderten die Spieltische umgeben. Ich sehe absolut nichts Schmutziges in dem Wunsch, möglichst schnell und möglichst viel Geld zu gewinnen; als sehr dumm ist mir immer der Gedanke eines behäbigen, wohlsituierten Moralphilosophen erschienen, der auf jemandes Entschuldigung: »Es wird ja nur niedrig gespielt«, antwortete: »Umso schlimmer, da dann der Eigennutz kleinlich ist.« Als ob kleinlicher Eigennutz und großartiger Eigennutz nicht auf dasselbe hinauskämen! Das sind nur relative Begriffe. Was für Rothschild eine Kleinigkeit ist, das ist für mich eine große Summe; aber was Gewinn und Profit anlangt, so geht das Streben der Menschen nicht etwa nur beim Roulett, sondern auf allen Gebieten nur darauf, einander etwas wegzunehmen oder abzugewinnen. Ob Profitmachen und Gewinnen überhaupt etwas Garstiges ist, das ist eine andere Frage, auf deren Beantwortung ich mich jetzt nicht einlasse. Da ich selbst im höchsten Grade von dem Wunsch, zu gewinnen, erfüllt war, so hatte all dieser Eigennutz und, wenn man es so ansehen will, all dieser Schmutz des Eigennutzes beim Eintritt in den Saal für mich sozusagen etwas Vertrautes und Verwandtes. Das beste ist, wenn einer dem anderen gegenüber keine gewundenen Redensarten macht, sondern offen und ehrlich verfährt; und nun gar sich selbst zu betrügen, was hat das für einen Zweck? Eine ganz wertlose, unökonomische Tätigkeit!
Besonders hässlich erschien mir auf den ersten Blick bei dem unfeinen Teil der Roulettspieler die Wichtigkeit, die sie ihrer Tätigkeit beilegten, das ernste, sogar respektvolle Wesen, mit dem sie alle die Tische umringten. Darum wird hier scharf unterschieden zwischen derjenigen Art zu spielen, die als »mauvais genre« bezeichnet wird, und derjenigen, die einem anständigen Menschen gestattet ist. Es gibt eben zwei Arten zu spielen: eine gentlemanhafte und eine plebejische, selbstische, das ist die der unfeinen Menge, des Pöbels. Hier wird dazwischen ein strenger Unterschied gemacht; und doch, wie wertlos ist in Wirklichkeit dieser Unterschied! Ein Gentleman wird zum Beispiel fünf oder zehn Louisdor, selten mehr, setzen oder auch, wenn er sehr reich ist, tausend Franc; aber er darf das lediglich um des Spieles willen tun, nur zum Zeitvertreib, eigentlich nur um den Vorgang des Gewinnens oder Verlierens zu verfolgen; für den Gewinn selbst darf er durchaus kein Interesse zeigen. Hat er gewonnen, so darf er zum Beispiel laut lachen, zu einem der Umstehenden eine Bemerkung machen; er darf sogar noch einmal setzen und dabei verdoppeln, aber einzig und allein aus Wißbegierde, um die Chancen zu beobachten und Berechnungen anzustellen, aber nicht in dem plebejischen Wunsch zu gewinnen. Kurz, all diese Spieltische, Rouletts und Trente-et-quarante-Spiele darf er nur als einen Zeitvertreib betrachten, der lediglich zu seinem Amüsement eingerichtet ist. Von der Gewinnsucht und den Fallstricken, die die Grundlage und Einrichtung der Spielbank bilden, darf er nicht einmal eine Ahnung haben. Sehr gut wäre es sogar, wenn es ihm schiene, dass auch alle übrigen Spieler, dieser Pöbel, der um einen Gulden bangt und zittert, dass auch sie ebensolche reichen Leute und Gentlemen seien wie er selbst und nur zur Zerstreuung und zum Zeitvertreib spielten. Eine solche völlige Unkenntnis der Wirklichkeit und harmlose Meinung von den Menschen wäre gewiss sehr aristokratisch. Ich sah, dass viele Mütter ihre unschuldigen, hübschen, fünfzehn- oder sechzehnjährigen Töchter zum Spieltisch vorwärtsschoben, ihnen einige Goldstücke gaben und sie über das Spiel belehrten. Die jungen Damen gewannen oder verloren, lächelten aber in jedem Falle und traten sehr zufrieden wieder zurück. Unser General kam in gemessenem Schritt und würdevoller Haltung zum Spieltisch; ein Diener eilte herbei, um ihm einen Stuhl zu reichen; aber er bemerkte den Diener gar nicht. Sehr langsam zog er seine Börse heraus, sehr langsam entnahm er ihr dreihundert Franc in Gold, setzte sie auf Schwarz und gewann. Er nahm den Gewinn nicht, sondern ließ ihn auf dem Tisch. Wieder kam Schwarz; auch dies