Die dreizehnte Stunde
Herausgegeben von Frank Stefan Becker und Jochen Rudschies
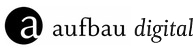
Zwölf Meister ihres Fachs – zwölf Sternstunden der Geschichte
Ein außergewöhnliches Projekt: Zwölf renommierte Autoren berichten von schicksalhaften Augenblicken, die die Welt aus den Angeln gehoben haben. Mitreißende Geschichten über folgenschwere Momente, die das Ende oder den Beginn einer Epoche markieren – und zu Platon, Kleopatra oder ins Kalifenreich führen. Zeitwenden von der Antike bis in die Neuzeit, farbenprächtig und brillant erzählt.
mit: Tanja Kinkel, Kari Köster-Lösche, Bernhard Kempff, Gisbert Haefs, Guido Dieckmann, Frederik Berger, Eric Walz, Charlotte Lyne, Iris Kammerer, Eve Rudschies, Frank S. Becker, Michael Pfrommer
Die dreizehnte Stunde
Herausgegeben von Frank Stefan Becker und Jochen Rudschies
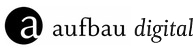
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
VORWORT
DAS BUCH DER TOTEN
Kleopatra VII. und ihr Ende
Michael Pfrommer
DER TRAUM VON CANOSSA
Bußgang und Versöhnung der Mathilde von Tuszien
Frederik Berger
CAGLIOSTRO
oder Die Erforschung der Lüge
Eric Walz
EIN SCHIFF FÜR DIE EWIGKEIT
Von der Geburtsstunde Englands
Charlotte Lyne
DER GOLDENE FINK
Aus den Rosenkriegen in England
Bernhard Walter Kempff
DIE MESSIANERIN
Flora Tristan und die Geburt der Arbeiterbewegung
Eve Rudschies
DAS GASTMAHL DES TYRANNEN
Platons zweite Sizilienreise
Iris Kammerer
DER BLINDE VON BAGDAD
Das Ende einer Epoche
Frank Stefan Becker
TÖDLICHE HOCHZEIT
Gaspard de Coligny
Guido Dieckmann
AVE ATQUE VALE
Quinctilius Varus’ Entourage
Tanja Kinkel
DIE BLATTERN DER MELKDEERNS
Peter Plett und die Pocken
Kari Köster-Lösche
TODESTAUSCH
Ambrose Bierce, Wiedergänger
Gisbert Haefs
DIE AUTOREN
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Historische Romane sollen unterhalten, zugleich aber auch mehr bieten: Die Vergangenheit lebendig werden lassen, neue Einblicke vermitteln und das ewig Gültige im menschlichen Leben darstellen. Historische Kurzgeschichten tun all das in einer verdichteten Form. Von der Antike (Platon) bis in die Neuzeit (Ambrose Bierce) reicht die Zeitspanne der Erzählungen in dieser Anthologie, von sehr Bekannten (Kleopatra, Varus), weniger Bekannten (Gaspard de Coligny, Cagliostro und Flora Tristan) und fast Unbekannten (König Raedwald, Peter Plett und dem letzten Kalifen von Bagdad) wird berichtet. Es gibt viel zu entdecken auf dieser Zeitreise durch die Epochen und Länder.
Dabei gehen die Autorinnen und Autoren ganz unterschiedlich vor: Tanja Kinkel lässt Überlebende der Schlacht im Teutoburger Wald zu Wort kommen; Frederik Berger träumt mit der Markgräfin Mathilde vom Gang ihrer Jugendliebe nach Canossa; Guido Dieckmann zeigt uns die Schrecken der Bartholomäusnacht aus dem Blickwinkel eines protestantischen Mädchens, während Bernhard Walter Kempff einen Jungen mit seinem Schimmel in den Rosenkrieg schickt; Eric Walz nimmt uns mit in die Gefängniszelle des größten Betrügers seiner Zeit; und Gisbert Haefs führt uns an den Rand des Phantastischen und einen Schritt darüber hinaus.
Doch welcher Sujets die Autorinnen und Autoren sich auch angenommen haben, alle zeigen sie uns die »dreizehnte Stunde« ihrer Heldinnen und Helden: den seltenen Moment der Wahrheit, dem niemand ausweichen kann, wenn er erst einmal gekommen ist, und der eine Wegscheide markiert: einen Moment des Untergangs und des Todes, aber auch des Neuanfangs, des Fortschritts – und vielleicht der Unsterblichkeit.
München, im Mai 2010
Frank S. Becker und Jochen Rudschies
Der Nachtwind frischte auf, und mit ihm verstärkte sich der Geruch von Tang und Dünung. Die See leckte mit feinen Wellen an der Kaimauer. Von der im Hafen ankernden Flotte klangen Postenrufe ans Ufer, doch die Schiffe waren für mich nichts als vage Schemen, genauso unsichtbar wie die Große Bibliothek direkt hinter mir.
Sogar das Signalfeuer des gigantischen Leuchtturms, das seit Jahrhunderten Alexandrias Hafeneinfahrt beschirmte, war seit Tagen erloschen, als hielte selbst dieses Weltwunder den Atem an, so wie die ganze Metropole. Meine Vaterstadt lag in tiefer Finsternis, es herrschte beinahe Totenstille. Die Alexandriner duckten sich angstvoll in ihren Häusern, paralysiert von der bangen Frage, ob die siegreichen Römer nicht doch noch brandschatzen und plündern würden.
Als ich mich auf die Kaimauer setzte, glaubte ich die Angst beinahe körperlich zu spüren, obwohl ich doch eigentlich zu den Siegern zählte. Zwar war ich gebürtiger Alexandriner, aber zugleich auch der Lehrer und einstige Erzieher Octavians, dessen Legionen den Weltmachtsträumen einer Kleopatra vor wenigen Tagen ein gewaltsames Ende bereitet hatten.
Der kaum 33-jährige Sieger hatte darauf bestanden, dass ich beim Einmarsch seiner Truppen neben ihm ritte. Während wir inmitten seiner Legionäre durch die Straßen paradierten, erkundigte er sich entspannt nach mancherlei Sehenswürdigkeiten, und selbst ich zermarterte mir den Kopf, was er damit bezwecken könnte. Wenig später verkündete er der vor Angst gelähmten Bürgerschaft, er werde ihre Stadt aus drei Gründen verschonen. Zum Ersten in Erinnerung an Alexander den Großen, der die Stadt vor drei Jahrhunderten gegründet habe. Zum Zweiten, weil er die Schönheit der Metropole bewundere, und zum Dritten aus Respekt vor mir, seinem langjährigen Lehrer und Freund Areios.
Noch nach Tagen wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Im Grunde hielt ich noch jetzt den Atem an und fragte mich, was diesen geborenen Politiker wohl daran gehindert haben mochte, das legendäre Alexandria seiner Soldateska zum Fraß vorzuwerfen. Ich wusste nur allzu gut, dass mein einstiger Schüler keine Skrupel kannte, wenn es darum ging, seine Feinde auszuschalten, und die besiegte Nilmetropole war die Hauptstadt Kleopatras, die Octavian selbst zur größten Feindin Roms erklärt hatte. Sein generöses Verhalten war nicht nur unverständlich, sondern geradezu unheimlich, schließlich überließ er nichts, aber auch gar nichts dem Zufall. Ich hatte nie einen kälter kalkulierenden Mann erlebt.
Mitternacht war längst vorüber, und ich grübelte immer noch, sogar hier vor der Ruine der einst weltgrößten Bibliothek. Selbst nach Jahren der Abwesenheit spielte mir meine Phantasie immer noch Streiche, und so hatte ich auch jetzt den Geruch jenes Feuersturms in der Nase, dem die Bibliothek vor Jahren zum Opfer gefallen war. Seit meiner Rückkehr zog es mich nun Nacht für Nacht an diesen Ort, an dem mein Großvater ein grausig-loderndes Ende gefunden hatte, als er versuchte, in letzter Sekunde kostbare Schriftrollen zu retten. Philosophie und Bildung waren ihm zum Schicksal geworden.
Für einen Philosophen war das fraglos ein würdiges Ende und die zusammenstürzende Bibliothek ein gewaltiges Grab, doch angesichts des Ausmaßes der Katastrophe hatte man seinerzeit nicht einmal seine Überreste bergen können. Noch immer fiel es mir schwer, mich damit abzufinden, dass das Grab des alten Herrn einzig in dem imposanten Mahnmal bestand.
»Areios?« Eine raue Soldatenstimme riss mich abrupt aus meiner Grübelei. »Areios? Wo bist du? Epaphroditos verlangt nach dir.«
Der Mann schwenkte eine Fackel, sonst hätte ich ihn in der Dunkelheit niemals entdeckt. »Worum geht es?«, fragte ich, als ich ihn erreichte.
»Komm schnell zum Grab Kleopatras, es ist dringend.« Im nächsten Moment eilte er auch schon voran und zwang mich buchstäblich in sein Kielwasser. Epaphroditos war ein früherer Sklave Octavians und nach seiner Freilassung heute einer seiner engsten Berater. Auch wenn wir uns nicht mochten, so war der Mann bei weitem zu einflussreich, als dass ich die Aufforderung hätte ignorieren können. Mich beschlich ein ungutes Gefühl, als ich hinter dem Legionär herhastete, in der mondlosen Nacht kein leichtes Unterfangen. Erst jetzt dämmerte mir, dass man wahrscheinlich eine ganze Reihe von Boten losgeschickt hatte, um mich in der nächtlichen Metropole aufzuspüren. Der Anlass musste also mehr als dringlich sein. Zumindest ahnte ich, dass mein junger Fackelträger ein solches Tempo nur deshalb anschlug, um meinen Fragen zuvorzukommen.
Ich wusste, dass Kleopatra nach der Kapitulation ihrer Truppen von Octavian die Erlaubnis erhalten hatte, in ihrem Mausoleum der Asche ihres geliebten Antonius ein Totenopfer darzubringen. Und auch wenn die einst mächtigste Frau der Welt jetzt nur noch eine Gefangene war, so war die Königin für Octavian nach wie vor eine Schlüsselfigur. Dennoch konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weshalb man mich nun plötzlich zu Hilfe rief, und so verstärkte sich meine Beklemmung mit jedem Schritt. Letztlich sollte ich wahrscheinlich nur irgendwelche Wogen glätten.
Im Grunde vermittelte ich seit Tagen zwischen den arroganten Römern, den verwirrten Ägyptern und den panischen Alexandrinern. Ziemlich zynisch, dass ausgerechnet ein Mann wie ich in meiner alten Heimat plötzlich wieder so hoch im Kurs stand, obwohl ich doch seit Jahren als Persona non grata gehandelt worden war. Schließlich hatte ich nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich Kleopatra verabscheute, so wie insgeheim viele meiner alexandrinischen Landsleute.
Die Trümmer der Großen Bibliothek lagen mittlerweile weit hinter uns, und dann schälte sich am Ufer das Grab im Schein zahlreicher Fackeln aus der Dunkelheit.
Die Königin hatte das Bauwerk erst in den letzten Monaten vor unserem Einmarsch aufmauern lassen. Ganz im Gegensatz zu ihrer Vorliebe für Prunk und Pomp war das Gebäude nicht sonderlich groß, kaum vierzig Ellen lang und zwanzig Ellen breit.
Eine vergitterte Fensterreihe öffnete sich im ersten Stock über einem trutzigen Erdgeschoss, dessen fensterlose Mauern sich nur für die mächtige Pforte öffneten, während das hohe Giebeldach mit dem Nachthimmel verschmolz, als wüchse es direkt in die Sterne hinein.
Mit dem rohen Mauerwerk glich die Grabstätte schon beinahe einer Festung, und die verzweifelte Königin hatte sie bei unserer Invasion auch tatsächlich als Zuflucht genutzt und sich hier zusammen mit zwei Hofdamen, ihrem Staatsschatz und Unmengen von Teer und Werg verschanzt. Ein wahrhaft symbolisches Refugium, zumal sie gedroht hatte, den Schatz samt Gebäude anzustecken, um in den Flammen zu sterben, falls Octavian nicht auf Verhandlungen eingehen würde. Doch am Ende waren die drei Frauen und der Schatz den Siegern lebend und unversehrt in die Hände gefallen.
Unser Einmarsch hatte die Bauarbeiten unterbrochen, die Außenwände waren wie das Innere weitgehend schmucklos geblieben. Noch jetzt lagerte überall Baumaterial, das wohl nie mehr Verwendung finden würde. Beinahe sinnbildlich für das gescheiterte Lebenswerk und die politischen Phantasien der Bauherrin. Grenzen hatte eine Kleopatra nie akzeptiert.
Eigentlich unglaublich, aber sie hatte tatsächlich um die Weltherrschaft gespielt, der einsame Kampf einer einsamen Frau, bei dem ihr zwei Männer zum Sieg hatten verhelfen sollen. Erst der göttliche Iulius Caesar und nach seiner Ermordung sein vormaliger Reitergeneral Mark Anton. Und beide Männer waren von ihr geradezu besessen gewesen. Caesar wollte sich sogar zum König krönen lassen, um seiner königlichen Freundin ebenbürtig zu sein, und zahlte für diese Hybris im republikanischen Rom mit seinem Leben. Er wurde von seinen besten Freunden ermordet. Ob Kleopatra einen der beiden wirklich geliebt hatte? Den alternden Caesar vielleicht weniger als den Frauenhelden Antonius, aber wer konnte schon in die Seele einer Frau blicken?
Doch Liebe hin oder her, wie so viele aus der Familie der Ptolemäer hatte auch Kleopatra davon geträumt, das Weltreich Alexanders des Großen aufs Neue zu errichten. Und so hatte sie ihre Kinder, die sie Caesar und Mark Anton geboren hatte, zu Königen Asiens gekrönt. Warum klein anfangen, wenn man die Welt besitzen kann?
Um das Römerreich zu kontrollieren, hatte sie schließlich Mark Anton in einen Bürgerkrieg gegen Octavian und weite Teile der römischen Oberschicht getrieben, und Octavian war pikanterweise der Adoptivsohn Caesars. Erst die Seeschlacht von Actium brachte im letzten Jahr die entscheidende Wende, bis Mark Anton in aussichtsloser Lage Selbstmord beging und damit Kleopatras letzte Machtoption brach. Sie hatte fürwahr ein königliches Spiel gespielt und zweimal knapp verloren, knapp, aber endgültig.
Was als größenwahnsinniges Ringen um die Weltherrschaft seinen Anfang nahm, endete als Kampf dreier Frauen gegen den Rest der Welt und gegen die Legionen Roms. Am Ende regte sich selbst in Kleopatras eigener Hauptstadt keine Hand zu ihrer Verteidigung. Eine Königin ohne Volk, eine wahrhaft tragische Einzelkämpferin. Weltgeschichte konnte episch sein, vor allem wenn sie von Römern geschrieben wurde.
Als wir das Grabmal erreichten, fanden wir das Areal von Legionären abgeriegelt. Mein Begleiter musste mehrfach Parole geben, um die Wachen zu passieren. Die Legionäre wirkten hochgradig nervös, ich fing betretene Blicke allerorten. Nein, hier ging es nicht um irgendeinen lästigen Zwischenfall, hier ging es um eine Katastrophe.
Der Gedanke war kaum vollendet, als mir Epaphroditos auch schon entgegenstürzte. »Die Frauen sind tot, alle drei!« Seine Stimme versagte vor Aufregung.
»Kleopatra ist tot?«, versicherte ich mich und wusste im ersten Augenblick nicht, ob ich schockiert oder erleichtert reagieren sollte.
»So wie ihre Dienerinnen.« Epaphroditos gestikulierte wild zu dem Bauwerk hinüber. »Sie liegen neben ihrer Herrin, und dabei wollten die drei angeblich nur ein Totenopfer ausrichten. Schöne Ausrede für einen Freitod. Wie ich hörte, warteten die zur Bewachung abgestellten Legionäre stundenlang vor der verschlossenen Pforte, weil sie Weisung hatten, die Frauen nicht zu stören. Schließlich drangen die Soldaten ein. Kleopatras Hofdame Charmion ordnete gerade sterbend das Haar ihrer toten Herrin. Ein Zenturio schrie Charmion noch an, ob sie diesen Selbstmord richtig fände …« Wieder hielt er atemlos inne.
»Und?«, drängte ich.
»Sie erwiderte, es sei richtig und würdig für eine Königin, die von so vielen Herrschern abstamme. Die verdammte Hure brachte den Satz gerade noch zu Ende, dann sank sie leblos zu Boden, direkt neben ihrer Herrin.«
Hatte ich es doch geahnt. Die drei Frauen hatten ihren eigenen Ausweg gefunden, und wir Lebenden mussten uns nun arrangieren. »Und wie ist es geschehen? Ich meine, wie konnten sich drei hilflose Frauen unter den Augen ihrer Wächter umbringen? Haben sie sich vergiftet?«
Epaphroditos hob wütend die Hände. »Es wurde alles kontrolliert, was sie in den Grabbau schafften, alle Speisen und Getränke, das schwöre ich bei den Göttern Roms! Ich habe verdammt noch mal keine Ahnung, wie sie das Gift hineingeschmuggelt haben. Was runzelst du die Stirn? Ich weiß selbst, wie übel sich die Sache anhört.«
Übel war eine Untertreibung. Wenn die Nachricht von diesem Desaster in Alexandria die Runde machte, würde so gut wie jeder vermuten, dass sich das übermächtige Rom seiner schlimmsten Feindin einfach entledigt hatte. Schließlich war Kleopatra in den Augen ihrer Gegner nach dem legendären Hannibal die ärgste Feindin, die dem Römerreich je erwachsen war.
Das wäre nicht gerade der beste Start für die goldene Friedensepoche, die nach dem Willen Octavians heraufdämmern sollte. Aber die volltönende Ideologie von einem neuen Weltzeitalter war jetzt meine geringste Sorge.
Das Ende des römischen Bürgerkriegs hatte sich bisher zum Glück nicht in einem verheerenden Straßenkampf zwischen den Legionen und Kleopatras Anhängern entladen. Seit dem römischen Einmarsch befanden sich die Alexandriner in Schockstarre, aber wie lange noch? Zwei Jahrzehnte vorher hatten sie Iulius Caesar hier in der Metropole einen neunmonatigen Kampf auf Leben und Tod geliefert, und der große Caesar hatte diese Belagerung wie durch ein Wunder überlebt, zusammen mit der damals blutjungen Kleopatra. Keine Frage, dass Octavian jetzt die Geschichte des Alexandrinischen Krieges durch den Kopf schoss.
Doch das war bei weitem noch nicht das ganze Problem, denn Alexandria war nicht Ägypten. Die Metropole bildete einen multikulturellen Mikrokosmos, griechisch geprägt und zu beinahe zwei Fünfteln von Juden bewohnt. Die Ägypter, die eigentlichen Herren des Nillandes, spielten hier oftmals eine untergeordnete Rolle, es war die Bevölkerung, die sich so schwer kalkulieren ließ. Zwar war die Königin hier in ihrer Hauptstadt weidlich verhasst gewesen, aber im restlichen Ägypten war das anders, und die Römer verabscheute man hier wie dort.
Wie sich Kleopatras gewaltsames Ende auswirken würde, stand also in den Sternen. Wenn sich die Alexandriner in Gefahr wähnten, etwa angesichts einer drohenden Plünderung, dann versank hier möglicherweise alles im Chaos, dann würde hier mit Kleopatra nicht nur die Dynastie der Ptolemäer ihr Ende finden, dann würde von meiner Heimatstadt wahrscheinlich kein Stein auf dem anderen bleiben. Bei dem Gedanken, dass alles wieder so schlimm kommen würde wie in den Tagen des Alexandrinischen Krieges, wurde mir speiübel.
Die siegreichen Römer waren so verhasst, dass wahrscheinlich niemand an Kleopatras Selbstmord glauben würde. Ich konnte sie schon hören, die unvermeidlichen Verschwörungstheorien, und nicht eine einzige würde Octavian in ein vorteilhaftes Licht rücken, darauf hätte ich jeden Eid geleistet. Andererseits, mein Freund Octavian herrschte nun unangefochten über das Römerreich von Spanien bis Syrien. Was wollte ich eigentlich mehr?
Doch selbst bei mir meldeten sich nagende Zweifel. Sollte Octavian am Ende nicht doch seine Hand im Spiel gehabt haben? Der Verdacht blitzte wie selbstverständlich durch mein Bewusstsein und ließ sich nicht mehr bannen, beinahe wie ein Dämon, dem man versehentlich einen Weg in die Freiheit ebnet. Schließlich war der Tod der Königin das Beste, was Octavian zustoßen konnte.
Der Freitod schien mir sogar für Kleopatra selbst die glücklichste aller Lösungen, denn eigentlich hätte Octavian die Besiegte im Triumphzug durch Rom schleifen müssen, um sie hinterher nach römischer Tradition zu liquidieren. Doch eine Exekution hätte heikel werden können. Denn auch wenn Octavian einen überaus erfolgreichen Propagandakrieg gegen Kleopatra und Mark Anton angezettelt hatte, so konnte die Königin selbst in der römischen Oberschicht immer noch auf Hunderte von Anhängern zählen. Ich musste mich nur daran erinnern, dass beim Ausbruch des Bürgerkrieges ein Drittel des römischen Senats Italien verlassen hatte, um für Antonius und Kleopatra Partei zu ergreifen. Eine lebende Kleopatra wäre für Octavian eine latente Gefahrenquelle gewesen.
Schon sein göttlicher Adoptivvater Caesar hatte höchst unheilvolle Erfahrungen gemacht, als er seinerzeit Kleopatras jüngere Schwester Arsinoe im Triumphzug durch Rom schleppte. Kleopatra und Arsinoe waren eigentlich wie Feuer und Wasser und hassten sich nach Kräften. Schließlich war Kleopatra in Caesars Bett gelandet, während ihre Schwester die Alexandriner zum Kampf gegen Caesar aufgestachelt hatte. Nach dem Triumphzug hätte man Arsinoe nach römischer Tradition exekutieren müssen, doch verhielt sich die junge Frau derart königlich, dass die römischen Massen ihre Freilassung forderten. Für den göttlichen Iulius, der seiner Kleopatra völlig verfallen war, eine höchst peinliche Situation. Arsinoe wurde notgedrungen begnadigt und ins Exil geschickt, wo sie erst Jahre später auf Betreiben ihrer Schwester umgebracht wurde.
Die Erinnerungen zogen vorüber wie Bilder aus einer anderen Welt. Nicht auszudenken, wenn Kleopatra genauso erfolgreich agiert hätte.
All dies schoss mir wie ein wirres Kaleidoskop durch den Sinn, und ich hatte Mühe, mich auf Epaphroditos zu konzentrieren. Ich realisierte erst jetzt, dass er anscheinend die ganze Zeit auf mich eingeredet hatte.
»Wie konnte das im Angesicht all dieser Legionäre geschehen?«, unterbrach ich ihn. Zum Glück war ihm meine Geistesabwesenheit völlig entgangen, denn er stürzte sich umgehend in die nächste Erklärung.
»Keine Ahnung, aber ich werde alle Beteiligten streng verhören. Zunächst lasse ich die Umgebung abriegeln, wir brauchen keine Zeugen …«
Hypernervös war noch die harmloseste Umschreibung seines Zustands. Kein Wunder, schließlich wusste er so gut wie ich, dass Octavian umgehend nach einem Sündenbock Ausschau halten würde, und auch in dieser Hinsicht war ich beileibe nicht aus dem Schneider.
»Sag endlich was!«, fuhr er mich an. »Rede! Schließlich hast du dich persönlich dafür eingesetzt, dass Kleopatra dieses Totenopfer vornehmen durfte. Da kannst du dich nicht so einfach herausreden.«
Sieh an, sieh an, mein guter Epaphroditos war bereits auf der Suche nach einem Schuldigen. Beinahe hätte ich zynisch aufgelacht, aber im Grunde war mir gar nicht nach Lachen zumute. Höchste Zeit, die Stimmung zu deeskalieren. »Hat außer den Legionären noch jemand das Grab betreten?« Ich fragte so sachlich wie möglich und ohne auf seine Anschuldigung einzugehen.
»Was weiß ich?«, knurrte er. »Ich war nicht vor Ort. Auch die Wachtruppe wurde vor Stunden gewechselt. Die Legionäre wissen nur, dass vor ihrem Dienstantritt ein Bote mit einem Korb voller Feigen für die Königin kam, angeblich ein Freund Kleopatras. Der verantwortliche Zenturio schwört, dass die Feigen in Ordnung gewesen seien. Der Unbekannte kostete die Früchte vor den Augen der Soldaten, und auch die Legionäre aßen davon. Sie waren nicht vergiftet …«
»Und die Legionäre ließen einen Fremden zu den Frauen?«, unterbrach ich entgeistert.
Epaphroditos verdrehte die Augen. »Wir werden das klären, ich … Moment mal, was war das?« Er zuckte herum wie ein Raubtier.
Nun bemerkte auch ich den Schatten, der gerade hinter einem Quaderstapel hervorhuschte. Epaphroditos’ Schrei alarmierte auch den saumseligsten Legionär, und im nächsten Moment stürzte eine wahre Meute hinter dem Flüchtigen drein. Er besaß nicht die geringste Chance. Ein kreischendes Aufbrüllen, dann wurde er auch schon niedergeworfen. Wie war es dem Mann gelungen, sich unbemerkt durch den Kreis der Wachen zu schleichen? Und vor allem, weshalb war er hier?
Zeit zum Nachdenken blieb mir nicht, denn die Soldaten schleppten ihre hilflose Beute wie eine Puppe ins Fackellicht. Ein kahlköpfiger Ägypter mittleren Alters in einem recht noblen Gewand, das von den rohen Fäusten stark in Mitleidenschaft gezogen worden war.
»Wie heißt du?«, brüllte Epaphroditos.
»Thanefer, Sohn des Hor«, keuchte der Unglückliche und straffte sich, als müsse sein Name irgendein Echo auslösen, doch selbst mir sagte der Name absolut nichts und Epaphroditos schon gar nicht.
»Ein neugieriger Ägypter«, knurrte Epaphroditos angewidert. »Pech gehabt, mein Bester, hier ist niemand erwünscht.« Dabei machte er die Geste des Halsabschneidens. Der Wink war unmissverständlich, und der erste Legionär griff nach seinem Schwert.
Thanefer schien erst jetzt seine Lage so wirklich zu begreifen. »Die Synode«, ächzte er. »Ich muss ihr berichten …«
Er kam nicht weiter, schnürte ihm doch die Lederschlinge eines Soldaten die Kehle zu, so dass er kaum noch röcheln konnte. Allein der Anblick schickte mir einen Schauder durch die Glieder. Ich hasste so etwas, ich hatte genug davon, hatte in den letzten Jahren einfach zu viel gesehen. Angewidert hob ich die Hand, doch beachtete mich niemand.
»Wen interessiert deine Synode?«, höhnte Epaphroditos und brach erst ab, als ich warnend nach seinem Arm fasste.
»Welche Synode?« Meinte er eine Priesterversammlung? In der Tat konnte der Ägypter mit seinem kahlrasierten Schädel gut als Priester durchgehen. »Lasst den Mann los! Ich will mit ihm reden.« In mir keimte ein vager Verdacht, doch dann überlief es mich siedend heiß. Wieso intervenierte ich für einen Unbekannten? Mein Vorpreschen mochte mich Kopf und Kragen kosten. Doch jetzt gab es kein Zurück mehr. Zum Glück hatte mich Octavian so mit Aufmerksamkeiten überhäuft, dass ich sogar einfachen Legionären ein Begriff war. Mein Prominentenstatus rettete jetzt das Leben dieses Ägypters, wenn auch vielleicht nur für wenige Augenblicke.
Der Legionär blickte dennoch erst auf Epaphroditos, und als dieser widerwillig nickte, lockerte er endlich seine Schlinge. Danach brachte der Gefangene immer noch kaum einen Laut heraus. »Mich … mich sendet die Synode von Theben«, krächzte er schließlich.
Hatte ich es doch geahnt!
Die Römer musterten uns misstrauisch, als ich den Ägypter zur Seite zog. Er war zwar totenbleich, aber er bemühte sich merklich um Haltung. Offenbar kannte er mich nicht, und ich wusste im ersten Augenblick nicht, ob ich beleidigt sein sollte oder nicht. Eine für einen Philosophen völlig absurde Eitelkeit, die ich leider bei mir nicht zum ersten Mal diagnostizierte. Im Grunde eine amüsante Selbsterkenntnis, wenn auch nicht gerade schmeichelhaft. »Ich bin Areios aus Alexandria«, stellte ich mich vor. »Du findest besser deine Sprache wieder, sonst kannst du dir gleich die Kehle durchschneiden lassen.«
Seine Augen weiteten sich, als ich meinen Namen nannte, doch dann riss er sich gewaltsam zusammen, auch wenn er wieder und wieder zu dem Grabbau hinüberschielte. Weshalb interessierte er sich, ungeachtet seiner bedrohlichen Lage, immer noch für dieses Gemäuer? Er wirkte so fahrig, als brenne ihm die Zeit auf den Nägeln. Wäre ich nicht selbst so aufgewühlt gewesen, sein Verhalten hätte unbedingt meinen Verdacht geweckt, doch jetzt war ich mit meinen Gedanken ganz woanders.
»Areios, der alexandrinische Freund Octavians?«, versicherte er sich ungläubig.
Sein Kehlkopf zuckte, und ich hustete trocken. »Da Octavian mittlerweile zum mächtigsten Mann des Erdkreises aufgestiegen ist, scheint es mir wichtiger, dass er mein Freund ist und nicht etwa umgekehrt.«
Mein Sarkasmus perlte an ihm ab, ja er musterte mich aus schmalen Augen. »Und damit du seiner Freundschaft auch sicher bist, hast du deine ägyptische Heimat den Römern ausgeliefert!«
Nicht schlecht! Der Mann hatte wirklich Nerven, in seiner Lage solch eine Anklage zu wagen. Ich klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. »Wirklich unglaublich, dass ich das noch erleben darf. Ein Ägypter akzeptiert einen griechischen Alexandriner als Landsmann. Dabei betont ihr Ägypter doch ständig, dass Alexandria gar nicht in Ägypten, sondern nur in der Nähe von Ägypten liege und dass man von Ägypten aus nach Alexandria reisen müsse wie in ein fremdes Land. Also sag mir nicht, dass wir Griechen nun plötzlich für Ägypten verantwortlich seien.«
Er ignorierte meinen Hohn. »Wenn du tatsächlich Areios bist, habe ich eine Nachricht für Octavian.« Dabei trat er so dicht an mich heran, dass er sogar meinen Mantel fassen konnte. Ein goldener Fingerring blitzte im Fackellicht. Es war verblüffend, wie gefasst der Mann agierte. »Mich sendet die Synode von Theben mit einer Botschaft für Kleopatra. Heute wollte mir die Königin ihre Entscheidung mitteilen.«
»Welche Entscheidung?«, fragte ich ahnungsvoll.
»Die vereinigte Priesterschaft hat sich entschlossen, Kleopatra die Hilfe Ägyptens anzutragen. Ganz Oberägypten wird sich erheben, um gegen die Römer ins Feld zu ziehen, falls die Königin unser Angebot akzeptiert.«
Ich wäre ihm beinahe an die Kehle gesprungen. Das erklärte allerdings, warum er sich hergewagt hatte, und ich verbarg mit Mühe meine Bestürzung. »Kleopatra hat sich gerade das Leben genommen. Vielleicht ist das ihre Antwort?«
Er maß mich mit einem so mörderischen Blick, dass ich um ein Haar einen Schritt zurückgewichen wäre. »Und wer sagt mir, dass sie nicht ermordet wurde?«, fauchte er mit unterdrücktem Grimm. »Lass mich zu ihr, ich muss mich persönlich überzeugen! Ich will herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ich traue nur meinen eigenen Augen. Mir reicht weder das Wort eines Römers noch ein Zeugnis von dir, der du deine Heimat seit Jahren hintergehst.«
Ich wusste genau, was ihm jetzt durch den Sinn schoss. Ich kannte ihn nur zu gut, diesen Schimmer von Verachtung in den Augen meiner Landsleute. »Dir ist doch klar«, hielt ich dagegen, »dass ein Aufstand Hunderttausende das Leben kosten würde?«
»Ein Tod für Ägypten ist stets eine Ehre!« Seine Stimme schwankte kein Jota.
Ich seufzte möglichst hörbar. »Und was ist mit den Opfern eurer großartigen Revolte? Doch zum Glück ist dieses Massaker ganz einfach zu verhindern. Ich lasse dir die Kehle durchschneiden. Dann wartet die Synode vergeblich, und niemand wird sich erheben.«
Für einen Moment fixierten wir uns finster, und ich hörte nichts als das Knistern der Fackeln. Daraufhin trat er so dicht an mich heran, dass ich seinen Atem spürte. »Nur zu, Römerfreund, lass mich ermorden. Aber die Folgen verantwortest du ganz allein. Denn kehre ich nicht zurück, sind wir im Krieg. So wurde es abgesprochen, und so wird es ausgeführt. Wenn Alexandria in Flammen steht, dann sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ihr Alexandriner mögt eure Königin gehasst haben, aber wir Ägypter empfinden anders.«
Kein Wunder, schließlich kannte ich alle jene Gerüchte, die Kleopatra zum illegitimen Spross einer ägyptischen Mätresse erkoren. »Die Ptolemäer betrachteten Ägypten stets als unterworfenes Land. Ihr würdet für eine tote Königin ins Feld ziehen, deren Familie nicht einmal Ägyptisch sprach?«
»Kleopatra sprach fließend Ägyptisch!«, protestierte er.
»Aber sie war die erste Ptolemäerin, die je die Landessprache lernte.«
Er winkte unwirsch ab. »Es geht nicht nur um eine tote Königin. Die Dynastie darf nicht enden, Ägypten braucht einen Pharao. Nur so wird unsere Welt Bestand haben.«
»Dann glaubst du tatsächlich, das Schicksal Ägyptens hinge davon ab, ob ein Pharao in den Tempeln seine Opfer vollzieht?«, forschte ich ungläubig.
Er bewegte sich unbehaglich. »Es genügt, dass meine Landsleute so empfinden.«
»Du und deine Priesterkollegen lassen sie das glauben«, korrigierte ich trocken, auch wenn mir immer mulmiger wurde. Falls sich Ägypten tatsächlich erhob, dann bestand zwar kein Zweifel am Sieg der Römer, sie siegten immer, aber der Nil würde sich blutrot verfärben, und ich konnte mir unschwer ausrechnen, auf wen sich der Hass konzentrierte, sobald den Ägyptern erst einmal klar wurde, dass sie den Legionen nicht gewachsen waren. Dann würde man sich auf die Griechen stürzen, deren Familien zum Teil seit den Tagen Alexanders im Nilland lebten. Bis zum Tode Kleopatras konnten wir Griechen uns sicher sein, dass wir der herrschenden Kultur angehörten. Doch jetzt waren Kleopatra und ihre Ptolemäer nur noch Geschichte, jetzt konnten wir Griechen über Nacht zum Freiwild werden. Selbst wenn die Römer die Hauptstadt kontrollierten, die Griechen im Hinterland waren weitgehend schutzlos. Und den Alexandrinern hier in der Stadt würde es auch nicht besser ergehen, denn die Legionäre würden keinen Unterschied machen zwischen griechischen Alexandrinern und aufständischen Ägyptern. Zudem war Alexandria reich, in der Metropole gab es für Soldaten eine Menge zu holen, und auch ein Octavian würde seine Soldateska im Falle eines Aufstands nicht zurückhalten. Schließlich kannte ich meinen Schüler – wenn er sein Ziel nicht gewaltlos erreichen konnte, dann ging er über Leichen und …
»Bist du fertig?«, brüllte Epaphroditos. »Ich kann mich nicht die ganze Nacht mit diesem Kerl aufhalten.«
Ich atmete tief durch. »Ist auch nicht nötig, ich muss mit ihm ins Grab. Allein.«
»Bist du von Sinnen?«, staunte er. »Niemand betritt diese Ruine, du nicht und dieser Mensch schon gar nicht. Ich …«
Ich zog ihn mit Nachdruck zur Seite. Er lauschte mit großen Augen und steigendem Unwillen. »Und du glaubst an diese Synode?«
Ich zuckte vielsagend die Achseln.
Er nagte an seiner Unterlippe. »Nun gut«, murmelte er abrupt. »Und ehe ich es vergesse, da drin wird nichts verändert und nichts hinaus- oder hineingebracht. Außerdem geschieht alles auf deine Verantwortung.«
»Natürlich.« Auch wenn ich versuchte, Zuversicht in meine Stimme zu legen, ich machte mir nichts vor. Octavian wurde den ganzen Tag von Günstlingen umschwärmt. Die meisten hassten mich allein schon ob unserer Freundschaft, die letztlich darauf beruhte, dass ich nie irgendetwas Außergewöhnliches erbeten hatte. Doch falls diese Angelegenheit hier schiefging, würde ich meine Position verlieren und für Epaphroditos einen perfekten Sündenbock abgeben. Er ließ mich nicht in das Grabmal, weil er von der Dringlichkeit überzeugt war. Dieser mit allen Wassern gewaschene Höfling gewährte mir Zutritt, weil er auf meinen Fehltritt hoffte.
Als ich Thanefer näher winkte und durch die eingeschlagene Pforte in das Grabmal trat, hatte ich das widerliche Gefühl, als spränge ich freiwillig in das Maul eines Raubtiers. Die zerborstenen Türflügel klafften uns entgegen wie die Fänge eines Drachen, der nur darauf wartete, seinen Rachen über uns zu schließen. Dem Ägypter erging es nicht besser, zumindest zog er den Kopf zwischen die Schultern. Ich hatte diesen Ort bisher ganz instinktiv gemieden, und jetzt wusste ich auch, wieso.
Noch ein Schritt, dann standen wir in einem schmucklosen Vorraum, der einem Rohbau glich. Zwei einsame Fackeln in bronzener Halterung warfen loderndes Licht auf flüchtig gekalkte Wände, die gerade ihren ersten Putz empfangen hatten, als Kleopatra das Grab in eine Festung verwandelte. Der schmale Raum hinter der Türe kam mir plötzlich vor wie der Eingang zum Hades.
Dabei hatte sich hinter diesen kargen Mauern Weltgeschichte vollzogen. Die Eingangspforte war ursprünglich so konstruiert worden, dass man die schwere Türe nicht mehr öffnen konnte, sobald sie einmal verriegelt war. Hinter diesem hermetisch verschlossenen Eingang hatte die verzweifelte Königin verhandelt, während die Römer unbemerkt an der rückwärtigen Front durch eines der Fenster im Obergeschoss geklettert waren. Dann waren die Eindringlinge die beiden Treppenhäuser nach unten gestürmt, die sich neben der Türe zum Hauptraum zur Linken wie zur Rechten öffneten.
Als sich Kleopatra umringt sah, richtete sie einen Dolch gegen sich selbst, doch man überwältigte sie und ihre Gefährtinnen und zerrte die drei Frauen nach draußen zurück in eine Welt, die sie schon verlassen zu haben glaubten.
Und als offenbarte sich hinter diesen Mauern tatsächlich eine andere Welt, begrüßte mich das Gebäude mit einer seltsamen Aura. Ein verwirrender Duft von Zimt, Mörtel und frischem Mauerwerk.
Mein Großvater hatte mir einst von einem König berichtet, dessen Reich über seinem Kopf zusammenbrach und der sich mit seinen letzten Getreuen in einen Turm flüchtete. »Werft eure Speere rings um den Turm«, hatte der besiegte König gefordert, »denn so weit unsre Lanzen fliegen, so weit reicht jetzt mein Königreich.«
Als sich Kleopatra hier verbarrikadierte, hatte sie nicht einmal eine Lanze, und nun war der Bau endgültig zu ihrem Grab geworden, ein Mahnmal für eine Dynastie, die vor dreihundert Jahren an der Seite Alexanders ihren Anfang genommen hatte. Damals hatte die griechische Kultur mit Alexanders Armee das ferne Indien, die Steppen Innerasiens und Ägypten durchdrungen. Wir hatten den Orient unterworfen, und der große Alexander hatte hier an der ägyptischen Küste seine berühmteste Stadt gegründet.
Und heute?
Heute duckten wir uns vor römischen Schwertern wie weiland der Orient vor Alexander. Am Ende hatte es nur eine einsame Königin gewagt, sich dieser römischen Flut in den Weg zu werfen. Und als sie sich besiegt in ihrem Grab verschanzte, da versteckten sich ihre griechischen Untertanen in ihren Häusern oder gefielen sich darin, in den Reihen der Sieger über ihr eigenes Volk zu triumphieren. Dabei wäre es unsre Sache gewesen, für jene Epoche zu kämpfen, die uns nach Indien und an den Nil geführt hatte. Stattdessen hatten wir unser Schicksal drei Frauen überlassen, drei Frauen ohne Volk.
Mit einem Mal fühlte ich mich armselig, wie ich da in diesem Vorraum stand, klein und passiv wie die meisten meiner Landsleute, die den Untergang unserer Welt beobachteten wie ein Theaterstück, das mit römischer Feder geschrieben wurde. Wir benahmen uns, als könnten wir jederzeit aufstehen, um nach Hause zurückzukehren. Aber es gab keinen Ausgang für uns Griechen, genauso wenig, wie es vor Jahrhunderten beim Einmarsch Alexanders einen Ausgang für die Ägypter gegeben hatte.
Der Aufstand der oberägyptischen Priester mochte vielleicht verantwortungslos sein, aber irgendwie war er auch heroisch. Als müsste am Ende eines mythischen Frauenlebens mehr stehen als nur diese Ruine.
Ich schrak erst auf, als Thanefer auf Zehenspitzen in den Hauptraum tappte und auf der Türschwelle zurückprallte. Für einen Moment glaubte ich, er würde die Flucht ergreifen oder zu Boden sinken. Er musste sich am Türpfeiler abstützen, um das Gleichgewicht zu wahren. Hätte ich nicht ohnehin gewusst, wie sehr ihn das Drama aufwühlte, jetzt hätte ich es endgültig erkannt.
Als ich nun selbst an Thanefer vorüberwollte, sah ich Kleopatras Ankleidedame Ira reglos hinter der mächtigen Türschwelle liegen, als gelte es, ihre Herrin noch im Tode zu schützen. Im Halbdunkel der Grabkammer wäre ich um ein Haar auf den Leichnam getreten.
Wenn der Vorraum bedrückend wirkte, so durchdrang den Hauptraum eine geradezu mystische Stille. Die Feuer in den bronzenen Kohlenbecken schwelten kaum noch, was die magische Aura weiter verstärkte. Als ich dann mit einer Fackel den Raum betrat und die Flammen die drei Toten zum ersten Mal aus der Dunkelheit rissen, sank Thanefer mit einem Seufzer neben Ira in die Knie.
Die Frauen wirkten in ihren kostbaren Gewändern wie Skulpturen, die Königin im Hintergrund lag ausgestreckt auf einem goldenen Ruhebett und ihre zweite Dienerin Charmion neben ihr auf dem Steinfußboden.
Der Anblick wirkte so beklemmend endgültig, dass ich tief Atem holte, als ich mich Kleopatra näherte. Schon nach wenigen Schritten empfing mich ihr intensives Parfüm, das seit jeher zu ihr gehörte, schon damals, als sie als Neunzehnjährige das Herz Caesars eroberte. Oder sollte ich sagen, brach? Auf jeden Fall hatte sich der alternde Lebemann für die junge Ptolemäerin seinerzeit in den waghalsigsten aller Kriege gestürzt. Nach dem Sieg unternahm er mit ihr sogar eine monatelange Nilfahrt, als sei ihm jeder Realitätsbezug abhandengekommen.
Selbst als die Königin nun wie ein Marmorbild vor mir lag, glaubte ich ihre hypnotische Stimme zu hören. Ja sie schien geradezu über den Tod zu triumphieren, als erfülle sich erst jetzt ihr Anspruch, eine Göttin zu sein, die nicht sterben, sondern nur entrückt werden könne. Schließlich sahen ihre Anhänger sie stets als lebendiges Abbild der großen Göttin Isis und somit geradezu als Schöpferin und Bewahrerin der Welt.
Nun lag sie wie aufgebahrt und in all dem Prunk, den Ägypten seit jeher von seinen Pharaonen erwartete. Das goldene Untergewand und ihr purpurroter Mantel, in der Tradition Alexanders, verliehen ihr Erhabenheit. Mit ihren geschlossenen Augen wirkte sie so unnahbar wie einst im Leben, vielleicht unnahbarer als je zuvor. Auch der große Caesar hatte von diesen Augen geschwärmt und von der Geschmeidigkeit ihrer Sprache, doch nun waren ihre Lider geschlossen und die Lippen für immer verstummt.
Sie hatte ihre Augen nach ägyptischer Sitte tiefschwarz geschminkt und um die Stirn das Diadem gebunden, das seit Alexander alle Könige trugen. In den gekreuzten Händen hielt sie die mystischen Insignien Ägyptens, Krummstab und Wedel, als besiegle sie im Tode das Ende zweier Kulturen, die Epoche Alexanders und das pharaonische Ägypten. Aufgebahrt wie das letzte Kunstwerk einer Menschheitsepoche.
Selbst im Tode hatten ihre Begleiterinnen nichts an ihrer Erscheinung dem Zufall überlassen, schon gar nicht ihre Frisur mit den scharf gezogenen Scheiteln und straff gedrehten Rippen, die im Nacken in einen kreisförmigen Zopf zusammenliefen. Fraglos war diese Perfektion das Werk von Ira, die sich seit zwei Jahrzehnten um das Haar ihrer königlichen Freundin gekümmert hatte.
Kleopatra hatte seit jeher Sonnenlicht gemieden, um sich ihren hellen Teint zu erhalten, der jetzt mit dem Schwarz des Kajals kontrastierte. Der Tod verstärkte ihre fahle Blässe, als fiele das Licht meiner Fackel allein auf ihre weiße Haut. Sogar die reglosen Hände schimmerten in unwirklichem Weiß, auch wenn so mancher Fingernagel gesplittert war. Hatte es hier am Ende doch einen Kampf gegeben? Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte. Keine Frage, welche Überlegungen ein Thanefer anstellen würde.
Doch ungeachtet der malträtierten Nägel wirkte die Königin bestürzend entspannt, als könnte sie jede Sekunde die Augen aufschlagen, um sich mit jener so charakteristischen Geschmeidigkeit zu erheben. Ja ich ertappte mich dabei, dass ich sicherheitshalber ihren Puls kontrollierte und erleichtert aufatmete, als ich nichts mehr spürte. Bis zu diesem lähmenden Moment war ich nicht wirklich überzeugt gewesen, dass eine Kleopatra überhaupt sterblich wäre.
Dabei hatte mich ihre physische Erscheinung nie sonderlich begeistert, nicht ihr dunkles Haar, nicht ihre alabasterweiße Haut und schon gar nicht ihre übergroße Nase, ein unschönes Erbteil ihrer königlichen Ahnen. Allein ihre leuchtenden Augen hatten mich gefesselt, zumindest zu jener Zeit, als wir noch miteinander sprachen.
Dennoch, irgendetwas störte mich an diesem majestätischen Bild, aber erst als ich die Flecken am Hals gewahrte und ihre wunden, zum Teil aufgeschlagenen Fingerknöchel, wurde mir klar, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Waren das Abwehrverletzungen? Ich ertappte mich dabei, dass ich mich nach Thanefer umsah und dankbar war, als er immer noch wie versteinert neben Ira kniete. Die verletzten Hände beunruhigten mich zunehmend. Was mochte hier vorgefallen sein?
Auch Charmions Hände waren verletzt. Sie lag zusammengesunken neben dem gedrechselten Fuß des Ruhebetts, leblos, aber keineswegs wie ein Häuflein Elend, im Gegenteil. Es konnte gut sein, dass sich die Hofdame noch sterbend um ihre Königin bemüht hatte. Und dennoch …
Charmions Ruf war so dunkel wie ihr kohlrabenschwarzes Haar und ihre Hautfarbe, die allerdings mehr davon herrührte, dass sie sich seit jeher keine Mühe gab, wie Kleopatra oder Ira, Sonnenlicht zu meiden. Sie war auch weit zierlicher als Ira, die sogar ihre königliche Freundin deutlich überragt hatte, so unübersehbar, dass Ira sich bei öffentlichen Anlässen stets einige Schritte im Hintergrund hielt, um den Größenunterschied zu kaschieren.
Doch was Charmion an physischer Statur abging, hatte ihr Charakter mühelos wettgemacht, ja ich war seit jeher der Meinung gewesen, dass die schon etwas ältere Frau in diesem seltsamen Dreigestirn eine tragende Rolle gespielt hatte. Hätte Kleopatra ohne Charmion ihre Allmachtsphantasien entwickelt? Stammte der verwegene Plan, die damals neunzehnjährige Kleopatra in einen Teppich und einen Bettsack gewickelt zu Caesar zu schicken, am Ende doch von ihr, wie mancherorts gemunkelt wurde? Ich würde es niemals erfahren.
Es passte irgendwie zu ihrer Unbeugsamkeit, dass sie die beiden überlebt hatte, sterbend zwar, aber bis zum Ende ungebrochen. Doch wie war sie eigentlich zu Tode gekommen?
Mittlerweile klebte mir das Gewand am Körper, ich war in Schweiß gebadet. Von Thanefer kam immer noch kein Laut. Dies gab mir Zeit, mich etwas genauer umzusehen.
Erst jetzt bemerkte ich hinter der Liege die goldene Urne mit der Asche Mark Antons. Das kostbare Gefäß stand auf einem dreifüßigen Tischchen zwischen den korinthischen Säulen, die alle noch unverputzt und unbemalt waren. Die rohen Säulen rahmten den Raum auf drei Seiten und stützten hoch oben unter dem Fensterkranz eine Empore, während die eigentliche Grabkammer über beide Stockwerke hindurch bis in den Dachstuhl reichte.
Wohin ich auch blickte, überall standen Früchte und Speisen auf kleinen Tischchen, darunter auch jener Korb mit frischen Feigen, den Epaphroditos erwähnt hatte. Der Korb war heruntergefallen und die Feigen zum Teil hinter die Säulen gerollt. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie aufzuheben. Ich begriff nicht einmal, warum mich das störte.
Sobald ich mich von Kleopatra abwandte, schwand die Wirkung ihres Parfüms, und der süßliche Duft von Weihrauch mischte sich mit dem Geruch von Zimt. Das war beileibe kein Zufall. Das Gewürz galt aufgrund seines immensen Wertes als Teil des Staatsschatzes, und so hatte Kleopatra Zimt und Preziosen in ihre Kammer schaffen lassen. Als sie überwältigt wurde, ließ Octavian den Staatsschatz unter massivem Begleitschutz abtransportieren. Alles, was zurückblieb, war der Duft von Zimt.
Für Alexandria erwies sich der von den Römern erbeutete Ptolemäerschatz als wahrer Segen. Schließlich war Octavian aufgrund seiner immensen Ausgaben für den Ägyptenfeldzug äußerst knapp bei Kasse. Seine Soldaten mussten dringend entlohnt werden. Die Plünderung von Alexandria hätte seine Soldateska zweifellos zufriedengestellt, aber genau diese Apokalypse scheute der gewiefte Politiker. Und wenn ich mir jetzt Thanefers Botschaft vor Augen führte, dann begriff ich auch, wie real Octavians Bedenken waren …
Augenblick mal.
Das war es! Er musste von dem Aufruhr gewusst haben, und zwar bereits vor seinem Einmarsch. Ja, hier lag wahrscheinlich der Grund für seine überraschende Milde. Er wollte der Revolte die Legitimation entziehen oder sie zumindest nicht provozieren. Also hatte nicht etwa seine Freundschaft zu seinem alten Lehrer Alexandria gerettet, so schmeichelhaft es auch gewesen wäre, es war eiskaltes Kalkül. Er wollte einen jahrelangen Abnutzungskrieg vermeiden, wahrscheinlich weil er ihn schlicht nicht finanzieren konnte.
Irgendwie war ich erleichtert, hatte ich doch schon an meiner Menschenkenntnis gezweifelt. Schließlich hatte ich nie einen listigeren Politiker erlebt. Schon ein Caesar hatte die Talente des neunzehnjährigen Octavian erkannt und maßgeblich gefördert. Das alles blitzte mir noch durch den Sinn, als mich Thanefers Wut zurückriss in die Realität.
»Ihr habt sie ermordet!«
Ich fuhr herum. Der Ägypter stürzte mir entgegen, ich konnte nicht mehr ausweichen. Schon packte er meine Oberarme und stieß mich gegen Kleopatras Ruhebett. Für einen Moment wähnte ich den Geruch von Feigen in der Nase, dann verflog die absurde Assoziation.
Am Ende war es nur der Anblick der Königin, der Thanefer zur Vernunft brachte. Zumindest starrte er so bestürzt in ihr marmorweißes Antlitz, als habe sie ihm gerade einen ihrer tadelnden Blicke zugeworfen. Irgendwie charakteristisch für unsere verrückte Welt: Ein Ägypter stritt sich mit einem Griechen, während die Römer draußen über unser Schicksal entschieden. Einfach absurd.
Thanefer ließ zögernd von mir ab, anscheinend ging es ihm nicht anders als mir, er fühlte sich wie ein Frevler.
Sein Schweigen wurde immer lastender, bis ich mich schließlich räusperte. »Sieh her, wie ruhig die Königin liegt. Die Frauen wurden nicht bedroht, sie …«
Er winkte heftig ab. »Du kannst mich nicht täuschen! Ira liegt nicht umsonst dort drüben an der Türschwelle. Ich wette, sie wollte Hilfe holen, aber die Legionäre waren wohl selbst die Mörder.«
»Mörder? Ich vermute, Ira wollte verhindern, dass jemand den Raum betrat«, hielt ich dagegen. »Die Frauen wurden nicht bedroht.«
»Nicht bedroht?«, fuhr er mich an. »Ira wurde misshandelt, geschlagen … Du glaubst mir nicht? Sieh sie an!« Er riss die Fackel an sich und zerrte mich zu Ira hinüber.
Sie lag zusammengekrümmt auf dem Boden. Schmerz und Panik hatten ihr ebenmäßiges Gesicht in eine groteske Maske verwandelt. Das blonde Haar war zerwühlt, und die Hände waren so fest in den Mantel gekrallt, dass die Fingerknöchel selbst jetzt noch weiß hervortraten. Kein Zweifel, sie hatte sich bis zur letzten Sekunde gegen ihr Schicksal gestemmt. Jetzt im hellen Fackellicht bot ihr Leichnam ein Bild der Qual. Ein entsetzlicher Anblick, der meine ganze Selbstbeherrschung forderte. Schließlich hatte ich mich in glücklicheren Tagen recht gut mit ihr verstanden, während ich Charmion stets mit äußerster Vorsicht begegnet war.