

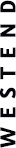
FUCKING
GERMANY
Das letzte Tabu oder
mein Leben als Escort

Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

ISBN 978-3-864896-18-7
© Westend Verlag Frankfurt/Main
in der Piper Verlag GmbH, München 2009
Typografie und Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
Inhalt
Einleitung Auf der Besucherritze
1 Drei auf einen Streich
2 Problemtürkentum als Chance
3 Die extraschlanke Exklusivität
4 Ecstasy
5 Weißbier mit Schaumkrone
6 Bauer Franzens Geburtstag
7 Der Doktor und das liebe Vieh
8 Allein unter Blue Boys
9 Fick mit Migrationshintergrund
10 Ficken 2.0
11 Blasen mit Paulo Coelho
12 Mal unter uns Nutten
13 Sandwich mit Seife
14 Schwanz in Spitzen
15 Euro-Ficker
16 Auf dem Sklavenmarkt
17 Ohne Ständer im Kempinski
18 Im Bett mit Onkel Horst
19 Gehen Sie direkt auf Los
20 Drive-in-Sex
21 Die zweite Haut
22 Wir gehen ins Pornokino
Schluss Mal raus hier
Einleitung
Auf der Besucherritze
Der Mann mit dem Tattoo auf dem Rücken, der vorne auf dem Buchcover abgebildet ist, das bin ich. Ich hatte Bedenken, mich zu zeigen, obwohl es in meinem Beruf ganz selbstverständlich ist, nicht nur das Gesicht, sondern auch die Genitalien öffentlich zur Schau zu stellen. Wenn auch nur im Rahmen der entsprechenden Internet-Communitys und Websites. Sie heißen erados.com, maleescorts.com oder auch gayromeo.com. Dort bin ich öffentlich einsehbar. Dort ist meine Mobilnummer angegeben, unter der ich für jedermann erreichbar bin, der einen Mann für gewisse Stunden sucht. Ich bin ein Escort, und wenn ich jedermann sage, dann meine ich damit, dass es meistens Männer sind, die mich anrufen, und nur in ganz seltenen Fällen Frauen. Der Alltag eines männlichen Sexarbeiters hat in der Regel wenig gemein mit jenem eines Richard Gere in American Gigolo. Meine Aufgabe besteht nicht darin, Ladys im Rentenalter zum Höhepunkt zu bringen, und mein Name ist auch nicht Helg Sgarbi, Frau Susanne Klatten habe ich leider nie kennengelernt, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich mich mit ein paar Millionen weniger zufrieden gegeben hätte.
Ich bin kein Gigolo für Millionärinnen – und auch kein »Private Dancer«. Mich gibt es schon für hundert Euro die Stunde. Dafür gibt es den Vollwaschgang: Ficken-Bumsen-Blasen-Kommen, Wörter, die mein Handy glücklicherweise von alleine kennt, es wäre mühselig, das immer wieder neu schreiben zu müssen. Härtere Sachen wie Vergewaltigung, Demütigung und bizarre Quälereien kosten extra. Es gibt Escorts, die verlangen sogar hundertfünfzig Euro oder mehr – zumindest behaupten sie offiziell, dass sie so viel verlangen. Selbstdarstellung gehört für uns zum Geschäft: Selfmarketing, denn wir tragen unsere Haut beziehungsweise unsere Schwänze zu Markte. Nicht wenige halten natürlich auch ihren Arsch hin, aber die Kundschaft weiß in der Regel aktive, »richtige« Kerle zu schätzen. Im Gegensatz zu Frauen können wir uns nicht einfach hinlegen und während der Arbeit fernsehen oder aus dem Fenster schauen. Wir können auch meistens keinen Orgasmus vortäuschen. Ein richtiger Orgasmus wird erwartet, und seine Echtheit ist überprüfbar. In dem Punkt haben wir es schwerer, aber im Gegenzug haben wir auch meistens keinen Zuhälter an der Backe. Klar, der bringt seinen »Angestellten« vielleicht mal Pommes auf den Strich, man ist also trotz allen Nachteilen, die so ein Mitesser mit sich bringt, geschützt. Meine männlichen Kollegen vom Strich müssen sich, wenn sie nicht genug Geld haben, um sich etwas zu essen zu kaufen – und das ist relativ häufig der Fall –, einen »Frikadellenfreier« suchen, irgendeinen Typen, der sie über Nacht aufnimmt und vielleicht noch was Essbares im Kühlschrank hat – gegen Sex, versteht sich. Auch Bordelle, »House of Boys«, sind eher selten und wenn, dann nur in Großstädten zu finden. Wir arbeiten auf eigene Faust und auf eigene Rechnung.
Die fetteste Kohle machen natürlich die wenigen Luxus-Escorts, die sich auf Prominente spezialisiert haben, die allerhöchsten Wert auf Diskretion legen und dafür auch entsprechendes Geld auf den Tisch blättern. In Italien hat einer dieser Besserverdiener, ein ehemaliger Fußballer, im letzten Jahr trotzdem ausgepackt und erzählt, dass Italiens Topfußballer gern mal die Heterobastion verlassen: 1500 Euro verlange er für seine Dienste von seinen entweder gelegentlich oder ausschließlich dem männlichen Geschlecht zugeneigten Fußballkollegen, dreißig Kunden habe er aus dem Bereich, davon ein gutes Dutzend aus der A-Serie. Er selbst war zuvor in der italienischen Dritten Liga aktiv, was ihm bei seiner Arbeit sehr helfe. Wenn ein aktiver Profifußballer mit einer solchen Angelegenheit auffliegen würde, dann wäre das ein Riesenskandal, und die heile Männerwelt des Fußballs würde in sich zusammenbrechen – zumindest befürchten dies die entsprechenden Spieler, die sich – verständlicherweise – nicht trauen, ehrlich zu sein. Gesellschaftliche Liberalität hat eben Grenzen.
Nur wenige Escorts spielen in dieser Liga, aber insgesamt sind wir verdammt viele, besonders an der Stricherfront. Allein in Berlin schätzen Sozialarbeiter ihre Zahl auf dreitausend, dazu kommen noch rund sechshundert Escorts, also Edelstricher, Profis, die haupt- und nebenberuflich in der Branche tätig sind. Diese Zahlen beruhen auf der Arbeit von Stricher- und Sexarbeiterprojekten, die vor Ort versuchen, Kontakt mit den Kollegen aufzunehmen. Sie fahren zu Pornokinos, Autobahnrastplätzen und in nächtliche Parks, bieten den Jungs Kaffee und etwas zu essen an, um ihnen nebenbei ein paar wichtige Informationen zu ihrer Gesundheit zukommen zu lassen: Kondome schützen. Mag sein, aber die Freier mögen es natürlich lieber ohne. Da legt man noch ein bisschen drauf, und das war es dann mit dem Kondom. Die wissen in der Regel genau, was sie wollen: Frischfleisch. Die Jungs selbst wissen oft gar nicht so richtig, wo links oder rechts ist. Mittlerweile handelt es sich bei ihnen meistens um Migranten, der Wegfall der Grenzen in weiten Teilen Europas hat es ihnen möglich gemacht, Armut und Elend ihrer Heimatländer hinter sich zu lassen, um hier, umgeben von allen materiellen Annehmlichkeiten, in neues Elend zu stürzen. Manche von ihnen sind auch nur in Deutschland, damit sie zu Hause ihre Familien ernähren können.
Ein rumänischer Stricher, er ist gerade mal 24, hat mir neulich sogar die Fotos seiner beiden Töchter gezeigt. Sie leben in Arat an der Grenze zu Ungarn und warten darauf, ihren Papa mal wieder zu sehen. Doch der muss sich nachts im Park von fremden Kerlen im Dunkeln einen blasen lassen, damit sie zu Hause in Arat wenigstens einmal am Tag ein warmes Essen auf dem Tisch haben. Und weil es immer mehr von seiner Sorte gibt, muss er die Hosen häufig schon für zwanzig oder dreißig Euro runterlassen. Die immer größer werdende Kluft zwischen Reich und Arm spüren wir jedenfalls in unserem Gewerbe schon lange, die Wirtschaftskrise beschleunigt diesen Prozess aber noch. Das Angebot steigt, und die Herren von der Nachfrageabteilung, die Freier, wollen immer weniger zahlen. Es ist wie auf dem Viehmarkt, aber mit dem Problem steht unsereins ja nicht alleine da – mit dem Unterschied, dass bei uns niemand einen »Rettungsschirm« aufspannt und wir auch ansonsten eher nicht in den Genuss von Subventionen kommen. Wir sind Freelancer, wie sie im Buche stehen. Jeder für sich und Gott für uns alle.
Wir fallen aus jedem Raster. Auch, weil es uns männliche Sexarbeiter eigentlich gar nicht gibt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Ganz im Gegensatz wiederum zu den Kolleginnen, die in regelmäßigen Abständen Auskunft im Fernsehen geben. Wenn eine Domenica aus Hamburg stirbt, dann ist das eine Meldung, die durch die Presse geht. Letztes Jahr gab es im Stern eine Titelstory »Wer verdient was in Deutschland«. Gleich auf Seite zwei der Story stand, dass »Angela « 3000 Euro im Monat verdient, einen Sohn hat, vormals im Sonnenstudio jobbte und Streetworkerin werden will. Klar, Prostitution eben, ist ja schon alles bekannt, Thema durch. Angela, die Prostituierte, neben Heiko, dem Unternehmensberater, und Dieter, dem Seelotsen, irgendwie Alltag, nicht? Aber ist es vorstellbar, dass der Stern »Raul« abbildet? Stricher, 22 Jahre, Zukunftsperspektive gleich null, Kundschaft: der situierte Mann aus der Mitte der Gesellschaft? Zum Thema weibliche Prostitution ist fast alles gesagt: Zwangsprostitution, WM-Bordell, Prostitutionsgesetz, »Bordsteinschwalben« als Touristenattraktion in Berlin-Mitte, die Herbertstraße in Hamburg. Folklore. Und das auch noch ganz legal, seitdem die rot-grüne Regierung das Prostitutionsgesetz durchgedrückt hat. Seitdem können »Sexarbeiterinnen« ganz unkompliziert an den Sozialsystemen teilnehmen, können für die Rente einzahlen und müssen Steuern abdrücken, so sie nicht schwarzarbeiten.
Sicher, irgendwie weiß man, dass es auch Männer gibt, die im Sexgeschäft tätig sind. Aber dabei denkt und dachte man eher an eine Art von Damenbegleitung, an die Zahnarztgattin eben, die sich aus lauter Langeweile mal was Fesches leistet. Ein Irrtum. Man hat irgendwann begonnen, sich ein wenig mit uns zu beschäftigen, als Aids aufkam. Damals wurden in Deutschland erstmals öffentliche Gelder lockergemacht, um bei unsereinem mal ein wenig nach dem Rechten zu schauen. Plötzlich waren wir nicht mehr nur unsichtbare Schattenwesen, die in den Grauzonen der Gesellschaft herumlungern, sondern gefährliche Virenschleudern, die die heilige deutsche Kleinfamilie bedrohen. Was, wenn das Familienoberhaupt sich während einer Mittagspause im Pornokino oder bei einer kurzen Rast auf dem Autobahnparkplatz mit HIV infiziert und dieses Mitbringsel an seine nichtsahnende Frau weitergibt? Die Stricher und Escorts – damals sagte man wohl noch eher Callboys – bewegen sich eben tatsächlich häufig in Grauzonen, also dort, wo es weder Heteros noch Homos gibt, sondern einfach Männer, die mit anderen Männern Sex haben.
Und davon gibt es mehr, als der »Normalbürger« denkt. Es sind Männer, die sich nie als schwul bezeichnen würden und zu deren Leben doch ganz selbstverständlich gehört, ab und zu einen Schwanz lutschen zu wollen, wenn ihnen danach ist – nicht jeder hat das Bedürfnis oder sieht eine Notwendigkeit darin, sich über seine Sexualität zu definieren. Es sind Männer, die aus anderen Kulturen nach Deutschland gekommen sind und die auf Sex mit Männern zurückgreifen, weil sie gewohnt sind, keinen Zugriff auf Frauen zu haben, solange sie nicht verheiratet sind. Es sind Männer, die zwar bisexuell sind, aber deshalb nicht auf ein geregeltes Familienleben verzichten wollen – und die keineswegs bereit sind, sich aufgrund ihres Begehrens zwingen zu lassen, ein völlig anderes Leben zu führen, also zwischen Darkroom, Travestie-Show und Eurovision Song Contest zu tingeln. Für viele von ihnen wäre es ein unvorstellbarer und anstrengender Horror, sich in eine solche Kiste stecken zu lassen, vielen von ihnen fehlt auch schlicht der Mut, sie selbst zu sein.
Es sind Männer, die genau diesem Klischee entsprechen, durchschnittliche Schwule über vierzig, die Schwierigkeiten haben, auf dem unentgeltlich florierenden schwulen Sexmarkt noch jemanden abzubekommen, der ihren Vorstellungen entspricht. Es sind Männer, die eigentlich gar keinem Klischee entsprechen, auch nicht dem schwulen, und die sich eine solche sexuelle Abwechslung von Zeit zu Zeit nicht entgehen lassen wollen – sie zahlen, so wie man für ein gutes Abendessen zahlt, völlig undramatisch. Es sind ältere und auch jüngere schwule Paare, die ihre Beziehung sexuell öffnen – aber nur in einem festgelegten Rahmen – und jemanden dafür gemeinsam bezahlen. Das schafft eine emotionale Distanz, die Eifersuchtsdramen von vornherein verhindert.
Und es sind solche Schwule, die eigentlich nur mit dem Finger schnippen müssten, aber keine Zeit haben, sich auf abendliche Männerjagd zu begeben. Oder die schlicht weder Zeit noch Lust haben, sich auf die im Vergleich zur übrigen Gesellschaft zwar niedrigschwelligen, aber manchmal auch nervtötenden und demütigenden Balzrituale der schwulen Szene einzulassen: stundenlanges Cruising oder Chatten im Internet, immer mit dem Risiko verbunden, am Ende abgewiesen zu werden, mehrfach.
Andere machen es getreu dem Motto aus der Werbung: »Weil ich es mir wert bin.« Sie kaufen sich jemanden, der exakt ihren Wunschvorstellungen entspricht und der ihnen das Programm bietet, das sie sich vorstellen. Ich gebe zum Beispiel den »authentischen« knallharten Türkenmacker von der Straße, der hat jetzt schon lange Konjunktur und wird immer noch hervorragend nachgefragt.
Meine Erfahrung ist, dass die Leute sich gerade nach klaren Ansagen sehnen. Sie wollen Führung. Die einen machen Fortbildungen und lesen Ratgeber, die anderen buchen mich, um mal vorübergehend zu wissen, wo es langgeht. So einfach ist das. Wenn man sich am Markt behaupten möchte, muss man sich diesen Strömungen und Modeerscheinungen anpassen. Eine Zeitlang, in den Neunzigern, waren Skinheads gefragt, heute sind es verstärkt Türkenmachos. Vielleicht hängt das mit den jeweiligen Angst- und Bedrohungsszenarien zusammen, die gerade durch die Köpfe der Menschen geistern. Vielleicht sollte ich mir mal einen Vollbart stehenlassen und auf islamistischen Bombenleger machen?
»Ausländer« sind jedenfalls in Deutschland anscheinend – Diskussionen um Fremdenfeindlichkeit oder Integration hin oder her – gerade sehr gefragt, wenn es um Sex geht. Das liegt zum einen am Angebot, zum anderen aber wohl auch daran, dass man hierzulande das Exotische mittlerweile schätzt. Sie wollen ja auch nicht immer nur Gulasch und Schnitzel essen, sondern zwischendurch gerne mal Döner, Spaghetti oder Sushi. Und während es hierzulande nicht mehr üblich ist, die Geschlechterrollen so ernst zu nehmen, wie es früher üblich war – Männer sind so, Frauen sind so –, verkauft sich »der neue Mann« auf dem Sexmarkt denkbar schlecht. (Davon abgesehen habe ich noch nie von einem anderen Metrosexuellen gehört als von David Beckham. Oder kennen Sie noch einen zweiten?) Dort sind klassische Rollenbilder gefragt, ähnlich wie bei den Kolleginnen, die im Winter als Skihasen am Straßenrand stehen und im Sommer High Heels zum kurzen Rock präsentieren. Das liegt auch daran, dass es im Bett schlussendlich ums Ficken geht, um das Begehren. Und nicht um Feuilleton- oder Seminardebatten. Ich höre mir manches davon gerne an und freue mich immer, wenn ich auf einen Kunden treffe, mit dem ich über interessante Themen diskutieren kann. Aber am Ende läuft es eben doch genau darauf hinaus, dass sie vor mir knien und meinen harten Türkenprügel lutschen wollen.
Natürlich wollen viele Männer nur das Eine – und das kauft man sich dann halt. Könnte es aber tendentiell sein, dass Männer, die Frauen kaufen, wahlweise nur Triebabfuhr oder Macht haben wollen, bumsen, bezahlen, tschüss, während sie bei Männern allzu oft dem verborgenen Wahn anhängen, endlich ihren Traumprinzen entdeckt zu haben, der sie zu allem Überfluss auch noch zurückliebt, wenn man sich nur gut genug kennengelernt, sprich, oft genug getroffen hat? Darüber hinaus sind die Jungs ja auch mit allen Wassern gewaschen. Ein lässig dahingeworfenes »und pass auf dich auf …« vorm Auseinandergehen reicht beim gemeinen Kunden schon aus zur genauso völlig naiven wie irrigen Annahme, man wäre irgendwie wichtig im Leben des anderen. Ist man ja auch, allerdings nur so, wie man es sich unter freiwilliger Ausschaltung sämtlicher Frühwarnsysteme und im Herbeiphantasieren baldigen Glücks nicht eingestehen will.
Eigentlich müsste man doch annehmen, dass Prostitution in unserer Zeit überflüssig geworden ist. Wir schreiben das Jahr 2009, dreißig bis vierzig Jahre nach der sogenannten sexuellen Revolution. Man könnte doch meinen, dass mittlerweile alle Menschen in der Lage wären, einfach ihre Sexualität zu leben. Die Zwangsmoral der Kirchen wurde zurückgedrängt, die Trennung von Staat und Kirche schreitet voran, die Menschen sind aufgeklärt durch die Schule, die Medien und natürlich das Internet. Oder stimmt das alles doch nicht so? Denn das Gewerbe ist keineswegs überflüssig geworden, es hat sich nur der neuen Zeit angepasst. Sexmarkt 2.0. Und noch immer gibt es eine Menge Menschen, die in dieser Sparte des Berufslebens Geld verdienen. Zum Teil auch einfach Geld verdienen müssen, weil sie sonst keine andere Möglichkeit sehen. Am Ende bleibt einem eben nur der nackte Körper.
Es ist total einfach geworden, Sex zu verkaufen: Man kann im Internet ein Profil einrichten, ein paar sexy Bilder einstellen und auf Kundschaft warten. Und wenn man gerade keine Lust oder Zeit hat, geht man einfach offline ; »away« oder »nicht am Rechner« steht dann dort als Überschrift. Man kann dann stattdessen ins Kino gehen oder seinen anderen Jobs nachgehen – ich bin zum Beispiel nebenberuflich DJ. Damit nähere ich mich amerikanischen Verhältnissen an, denn dort ist es inzwischen üblich, mindestens drei Jobs zu haben. Ansonsten lebe ich in überschaubaren, vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen. Ich habe eine kleine, schöne Zweizimmerwohnung und lebe im großen und ganzen so, wie man als Student oder junger Kreativer in Berlin eben so lebt. Man braucht hier gar nicht so viel Bares, um über die Runden zu kommen – arm, aber sexy! Wenn ich Geld brauche, bin ich einfach online – und auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin, können mich die Kunden übers Handy erreichen. In dieser Zeit bin ich dann tatsächlich allzeit bereit. Und ja, das kann verdammt anstrengend sein. Aber müssen wir uns nicht alle besser verkaufen?
In meinem Fall kann das aber auch manchmal recht entspannt sein. Ich sitze auf der Couch und schaue mir die Simpsons an oder döse vor mich hin – und irgendwann macht es »pling«, und Kundschaft schneit über das Netz hinein. »Pling« oder »plong«, man kann auch ein Hühnergackern oder Schweinegrunzen als Benachrichtigungston einstellen zum Beispiel. Das lockert die Arbeit ein wenig auf. Warum auch nicht, immerhin melden sich auch Kunden, die »Almhütte« heißen oder »Geburtszange«. Häufig weiß man nicht und erfährt auch nie, wer diese Menschen im richtigen Leben sind, aber im Gegensatz zu früher, als das Geschäft noch über Zeitungsanzeigen lief, weiß man heute häufiger, was auf einen zukommt.
Aber nicht immer, denn viele der Leute haben kein Portraitfoto in ihren eigenen Profilen, wenn es sich um eine »Community« handelt. Andere schicken eine normale E-Mail, viele rufen einfach nur auf dem Handy an. Dann kann man nur an der Stimme erahnen, was für ein Mensch auf der anderen Seite ist. Es ist auch hilfreich, sich erst mal ein wenig allgemein zu unterhalten, dann weiß man in der Regel recht schnell, wo die Reise hingeht. Oft verschwendet man aber auch seine Zeit, weil die Kundschaft bloß spielen will, sich nicht sicher ist oder Angst hat. Dann chattet man ewig oder telefoniert, und am Ende bleibt die Hose tot – und das Portemonnaie leer.
Aber das ist immer noch besser, als irgendwo – wie früher üblich – richtig auf dem Strich zu stehen. So wie einst in Berlin in der Jebenstraße hinter dem Bahnhof Zoo. Es ist auch immer noch besser, als nächtelang in Stricherbars herumzuhängen, und auf Freier zu warten. Am Ende betrinkt man sich aus lauter Langeweile – und führt, wenn man Pech hat, elend lange Nonsense-Gespräche mit Typen, die sich dann am Ende für jemand anderen entscheiden oder einfach nur labern wollten.
Für mich wäre das nichts. Und außerdem bin ich schon zu alt für dieses Geschäft. Nicht wirklich, ich bin erst dreißig, aber Jungs in meinem Alter arbeiten in der Regel als Escort, das Geschäft auf dem Strich und in den Bars ist in der Hand der jüngeren Kollegen. Klar vermischt sich das natürlich. Auch die Jungen schalten Anzeigen im Netz, doch aufgrund der Sprachbarriere – Stichwort Osteuropa – sind sie dort naturgemäß nicht so gut aufgestellt. Wobei es inzwischen auch im Netz einen digitalen Straßenstrich gibt, zum Beispiel unter der Rubrik »Escort« bei homo.net, die früher viel treffender, da allgemeiner, »Profis« hieß. Dort tummelt sich alles, vom bulgarischen Jungstricher über den Vollprofi aus dem gehobenen Preissegment mit Geldnöten bis hin zum vierzigjährigen Hartz-IV-Gelegenheitsstricher, der zu dem Schluss gekommen ist, dass sein einziges verbliebenes Kapital sein überdimensional großer Schwanz ist – eine Qualifikation zumindest, die von keiner Arbeitsmarktumwälzung in Frage gestellt wird. Anfänger und solche, die noch davon träumen, Anfänger zu werden, findet man auch in digitalen Kleinanzeigen-Portalen wie kijiji – so wie man auch im kleinsten kostenlosen Anzeigenblättchen in der Provinz diskrete professionelle Sexangebote findet.
Vielleicht wäre das für mich sogar ein Zukunftsmarkt: die Provinz, denn dort ist das Angebot nicht so groß. Andererseits ödet man sich da womöglich zu Tode in Zeiten wachsender Mobilität. Sehr viele meiner Kunden kommen, um ihre Sexualität auszuleben, ganz einfach aus ihrem Kaff in die Großstadt gereist. Oder sie bestellen sich jemand aus der nächsten Metropole, der dann eben mit dem Auto anreisen muss. Das Benzingeld stelle ich extra in Rechnung – erst neulich war ich zum Ficken in einem Dorf bei Dresden. Zwei Stunden hin, halbe Stunde Sex, zwei Stunden zurück. In Dresden scheint es nicht allzu viele Escorts mit Kanaken-Appeal zu geben – oder der Kunde hatte die entsprechenden Angebote vor Ort schon »durch«. Gewiss hat man zum Teil Stammkunden, aber das Gros der Kundschaft setzt in der Regel auf Abwechslung. Weshalb man des öfteren den Standort wechseln muss, wenn am Ende des Monats die Kasse stimmen soll.
Wenn zum Beispiel irgendwo in Deutschland eine größere Messe stattfindet, werden in der »Escort-Szene« die Koffer gepackt. Ich schreibe das in Anführungsstrichen, weil es eben keine Escort-Szene gibt. Wir sind in der Regel nicht groß untereinander vernetzt, und es gibt entsprechend auch niemanden, der die Parole ausgibt: »Nächste Woche ist IAA in Frankfurt«. Aber ist einmal IAA – Internationale Automobil-Ausstellung –, klettert die Anzahl derer, die laut Profil in Frankfurt residieren, sprunghaft in die Höhe. Dann gibt’s halt viel zu tun, wer hätte das gedacht?
Mein Eindruck aber ist, dass die meisten von uns unstete Wesen sind, die in den Tag hinein leben und sich treiben lassen – ein Terminkalender oder eine Jahresvorausplanung, das passt nicht so richtig dazu.
Wir sind fahrende Gesellen, eine meist gutaussehende Vagantenschar, die niemandem im normalen Leben auffallen würde, denn wir tragen keine albernen Hüte oder seltsame Handwerkerhosen. Aber ich glaube, dass nicht nur ich, sondern viele meiner Kollegen irgendwann mal ausgezogen sind, um der Schmied des eigenen Glücks zu sein – ohne geregelte Ausbildung, auf der Suche nach einem Leben, das am besten überhaupt ohne Regeln auskommt. Das ist die romantische Seite – das ist der Glamour.
Weniger romantisch ist das Schicksal all dieser ganz jungen Burschen, die oft ganz einfach aus materieller Not und in einem Zustand kompletter Perspektivlosigkeit in das Sexgeschäft kommen: Sie wissen in der Tat nicht, was sie tun. Weniger romantisch wird die ganze Angelegenheit allerdings auch, wenn man irgendwann in seinem Leben begreift, was man da eigentlich tut. Wenn einen die Ahnung überkommt, dass man am Ende vielleicht doch nicht nur das tut, was man möchte.
Geld. Am Ende geht es eben bei diesem Geschäft – wie bei allen anderen Geschäften auch – um Geld. Aber man verkauft eben nicht ein Talent oder eine erlernte Befähigung, sondern seinen Körper. Man verkauft seine Sexualität. Man verkauft etwas eigentlich sehr Intimes. Das ist ganz leicht. Und am Ende wohl doch sehr schwer.
Ich habe früher immer nur darüber gelacht, wenn ich die anderen habe reden hören oder wenn ich Filme im Fernsehen gesehen habe – Mord im Rotlichtviertel. Da war immer dieser sozialkritische Unterton. Da gab es beispielsweise Sozialarbeiterinnen, die versucht haben, völlig verzweifelte, drogenabhängige, kaputte Nutten – in seltensten Fällen mal Stricher – »auf den rechten Weg« zurückzubringen. Und da gab es auf der anderen Seite auch die Moralapostel und Christenmenschen, die »Steine warfen« auf die Huren und Dirnen. Diese Reaktionen kannte ich natürlich auch. Aber ich fand das ziemlich albern damals. Als ich mein erstes Geld in einem Puff für Männer verdient habe, habe ich mich einfach nur über die Kohle gefreut. Später dann, in den Neunzigern, wurde plötzlich ganz anders über Prostitution geredet. Auf einmal wurde sie als ganz normaler Job angesehen, in der Diskussion ging es dann plötzlich um Rentenansprüche. Hätte nur noch gefehlt, dass man plötzlich gewerkschaftlich ausgehandelte Pausenzeiten gehabt hätte.
Mit der Wirklichkeit, unserer Wirklichkeit, vor allem die der Stricherkollegen, hatte und hat das rein gar nichts zu tun. Und mit diesem ganzen langweiligen Quatsch wollte ich nun nichts zu tun haben, aber die Idee, dass ich eben auch nur einen Job mache, meinen Job, die fand ich ganz gut. Jeder macht schließlich etwas – und möchte dafür anerkannt werden. Das ist in meinem Beruf natürlich so eine Sache, aber es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich immer stigmatisiert gefühlt hätte. Das stimmt eben nicht, jedenfalls nicht in meinem Umfeld. Wenn man jung ist und in der Berliner Clubszene unterwegs, dann ist es nicht unbedingt ein Schaden, Escort zu sein. Im Gegenteil, man kann sich damit sogar interessant machen. Die Leute finden das dann irgendwie abgefahren oder schräg oder cool.
Ob der Job, den ich mache, wirklich so cool ist? Sie dürfen dank mir mal durch das Schlüsselloch gucken. Sie sitzen sozusagen auf der Besucherritze und können sich selbst ein Bild machen. Ich nehme Sie mit in schicke Münchener Wohnungen und Hotels in Frankfurt am Main. Wir fahren zu brandenburgischen Seen und schlagen uns die Nächte in Berlin um die Ohren. Und dann können Sie überlegen, ob das ein Job für Sie wäre – oder ob das alles wirklich so weit weg von Ihnen ist, wie Sie vielleicht denken. Vielleicht gibt es ja auch bei Ihnen stille Augenblicke, in denen Sie sich fragen, warum Sie in diesem Moment eigentlich gerade an diesem Punkt angekommen sind, wie es überhaupt dazu kam – und Sie auch nicht so genau wissen, wie man da nun wieder rauskommen soll.
Am Ende sitzen wir sowieso alle in einem Boot. Wir alle müssen funktionieren – und um funktionieren zu können, müssen wir im Rahmen unserer zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten versuchen, unsere menschlichen Grundbedürfnisse so effizient wie möglich zu bedienen. Schlaf, häufig am unteren Ende des Minimums, aber doch ausreichend, um unsere Funktionsfähigkeit herzustellen. Nahrung in exakter Dosierung und Qualität, die einen Körper am Leben erhält, der weder in den Verdacht der Fettleibigkeit noch jenen der Essstörung gerät. Dann noch ein wenig Liebe, Glück und Geborgenheit obendrauf, vom Sinn des Lebens an sich jetzt mal ganz abgesehen. Und natürlich: Sex, der nicht nur ein banales Grundbedürfnis ist, sondern ein zentraler menschlicher Antrieb. Haben Sie Sex in einer Qualität, Dauer und Häufigkeit, die Sie als befriedigend bezeichnen würden? Haben Sie überhaupt Sex? Haben Sie Zeit für Sex?
Und das Wichtigste, ja, das Wichtigste überhaupt hätte ich jetzt beinahe vergessen: Fast alles, beinahe unser gesamtes Leben und Überleben, das alles hängt am Ende vom Geld ab. Sie gehen ja bestimmt auch nicht bloß zum Spaß arbeiten, oder?