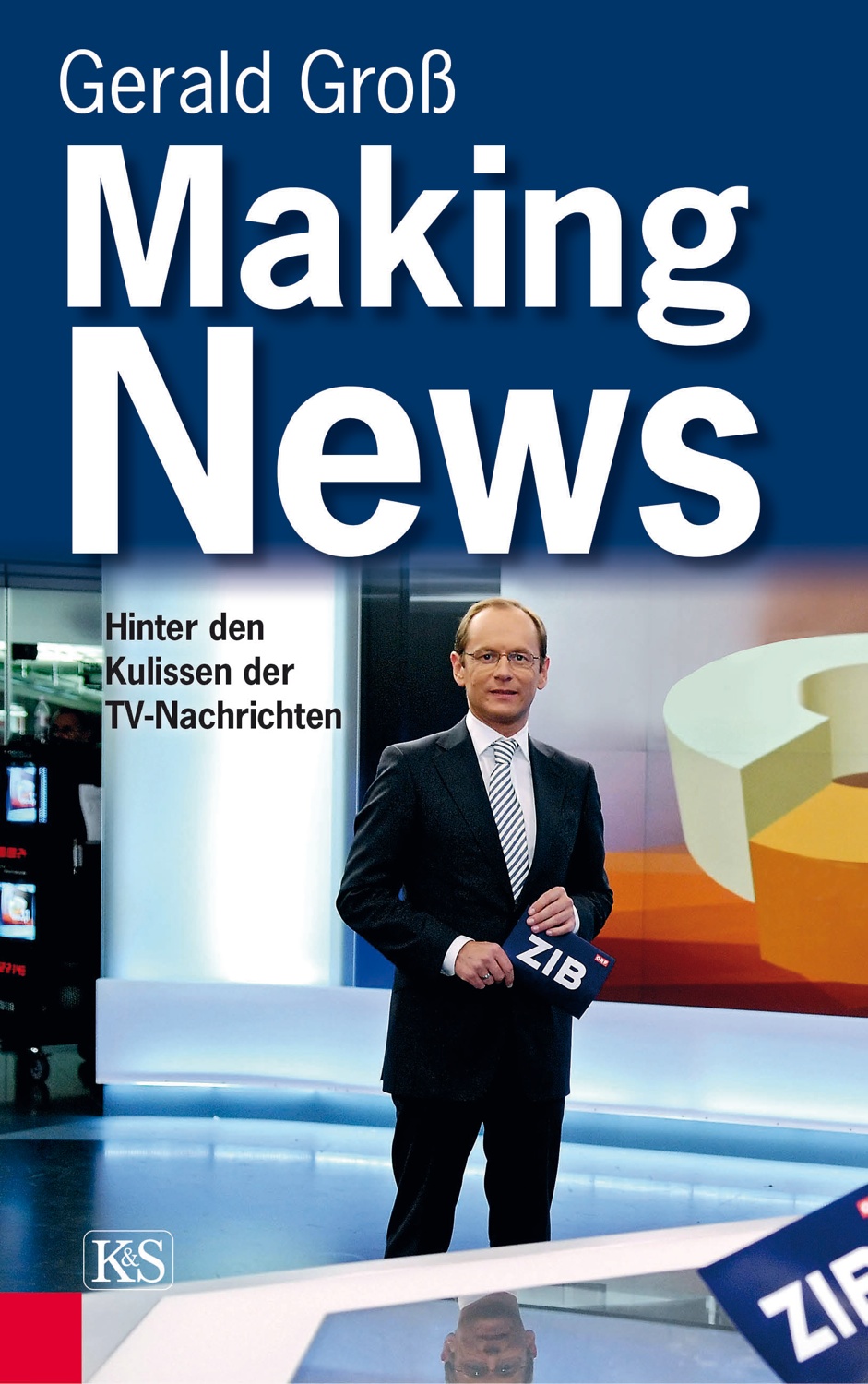
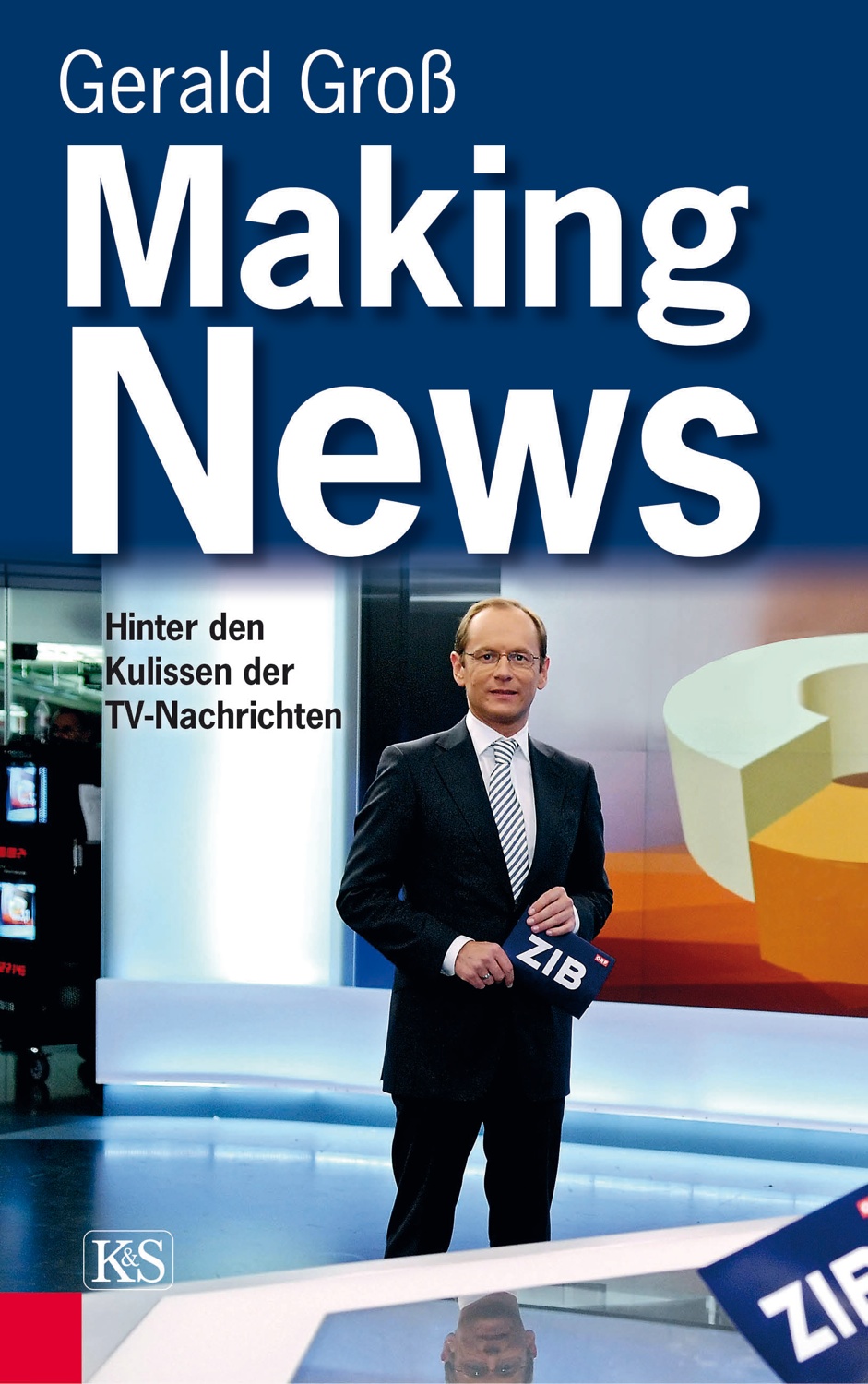
www.kremayr-scheriau.at
ISBN 978-3-218-00899-0
Copyright © 2013 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co KG, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlaggestaltung: Kurt Hamtil, Wien
unter Verwendung eines Fotos von Ali Schaffler/First Look/picturedesk.com
Typografische Gestaltung, Satz: Sophie Gudenus
Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien
„Noch eine Minute …“
Anstelle eines Vorwortes
Vom richtigen Dreh-Moment
Die Autocue und ihre Tücken
Wenn Sekunden zu Stunden werden
Der Umgang mit Pannen
Bewundert, beneidet, angefeindet
Wie man TV-Experte wird und bleibt
Autostoppen oder Assessment Center
Wie man seinen Traumjob beim Fernsehen findet
Wenn das Abenteuer Pause macht
Warum Korrespondenten niemals fad ist, auch wenn in ihrem Land nichts los ist
Wenn Prada-Schuhe die Nation bewegen
Von geborgten Sakkos, falschen Brillen und Shapewear für Moderatoren
Geplante Sondersendungen und außergewöhnliche Routinesendungen
Warum zu guter Letzt immer noch das Leben Regie führt
Volles Gehalt für 20 Minuten
Was Moderatoren tun, wenn sie nicht auf Sendung sind
Abgeschminkt
Anstelle eines Nachwortes
Dank und Anmerkungen
Für Sabine und die ersten 25 Jahre
Arbeiten beim Fernsehen heißt leben mit dem Countdown. Vor allem im Tagesgeschäft der Nachrichten ist man ständig mit Deadlines konfrontiert, die es einzuhalten gilt, mit Fristen, die man nicht überschreiten darf, mit Terminen, an die man sich gefälligst zu halten hat, um nicht Sand ins fein getunte Getriebe zu schütten und im schlimmsten Fall die gesamte Maschinerie zum Absturz zu bringen.
Die letzten Minuten vor Beginn der „Zeit im Bild“ gehören, wie man sich leicht vorstellen kann, zu den besonders „heißen“. Alltag im Newsroom: Noch immer sind nicht alle Beiträge für die Sendung auf dem Server. Die Bildleitung zur zugeschalteten Kollegin in Paris ist zusammengebrochen. Jemand hat nachträglich einen Moderationstext im Redaktionssystem geändert und jetzt muss die Autocue einem Reload unterzogen werden. In die Aufmacher-Story hat sich ein Fehler eingeschlichen, daher muss sie neu synchronisiert werden – leider ist der Autor gerade unauffindbar. Und im Studio ist ausgerechnet jetzt eine Leuchte ausgefallen. Am Regieplatz des ORF-Newsrooms, der dem eigentlichen Studio angeschlossenen, aber räumlich getrennten Kommandobrücke der „Zeit im Bild“, herrscht in solchen Momenten eine Art Titanic-Stimmung. Dafür sorgen mehrere Sekretärinnen, die hektisch aktualisierte Sendelisten an die Anwesenden verteilen, ein Mitarbeiter der Monitoring-Unit, der der Chefin vom Dienst wortreich neues Bildmaterial aus einem Krisengebiet offeriert (vergeblich, denn die redet ihrerseits gerade via Intercom auf den Kollegen im Parlamentsstudio ein, er möge endlich seinen längst überfälligen Beitrag überspielen), der junge Autocue-Assistent, der mit hochrotem Kopf wen auch immer um Freigabe der letzten noch ausständigen Moderationstexte anfleht, die Kollegin aus Paris, die man zwar noch immer nicht sehen kann, deren insistierende, im Fünf-Sekunden-Takt quer durch Europa gefunkte Frage „Hallo Wien, könnt ihr mich hören?“ aber nicht zu übertönen ist und von Mal zu Mal verzweifelter klingt. Und schließlich der Regisseur, der mit knappen, aber lautstarken Kommandos die Kameraleute im Studio dirigiert und in ihre endgültigen Positionen bringt.
Ebendort haben meine Kollegin Ingrid Thurnher und ich längst unsere angestammten Plätze eingenommen. Wir haben den Ablauf der Info-Grafik vor der Vidi-Wall geprobt und einmal die Headlines in Bild und Ton durchgespielt. Die Maskenbildnerin legt gerade letzte Hand an unsere mit hitzebeständiger Fettschminke und jeder Menge Puder bedeckten Gesichter und versprüht eine gewaltige Wolke klebrigen Haarsprays über unseren Köpfen. Der mit Bürste und Fusselroller bewaffnete Kollege von der Ausstattung befreit uns von den letzten Staubatomen auf unserer Kleidung, zupft Blusenkragen und Krawattenknoten zurecht, als plötzlich überlebensgroß die Kollegin aus Paris in der Vidi-Wall erscheint – das Handy mit der rechten Hand ans Ohr gepresst, mit den Fingern der linken eine brennende Zigarette malträtierend: „Hallo Wien, könnt ihr mich hören?“ Diesmal schickt sie noch ein deutlich zu vernehmendes „Merde“ nach, ehe sich nach einem Blick in ihren Kontrollmonitor ihr Gesichtsausdruck entspannt: „Na endlich, die Leitung steht!“ Schnell und routinemäßig klären wir zur Sicherheit die ohnedies bereits im Lauf des Nachmittags telefonisch vereinbarten Fragen zu Nicolas Sarkozys Wahlchancen und tauschen noch Informationen zum Wetter in Wien und Paris aus, ehe über die Studiolautsprecher die strenge Stimme des Regisseurs ertönt: „Noch eine Minute …“
Es ist kaum zu glauben: Eine schlichte Zeitansage, und plötzlich könnte man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören, so ruhig ist es mit einem Mal im Studio geworden. Tatsächlich ist die letzte Minute vor Sendungsbeginn um 19.30 Uhr die stillste im Tagesablauf, beinahe meditativ, in jedem Fall konzentriert (zumindest im Studio selbst, denn am Regieplatz hält die Hektik unvermindert an). Ich bin dabei, meine Moderationskarten ein letztes Mal zu ordnen und bleibe an meinem Überleitungstext zum Wetter hängen: „Über die herbstlichen Aussichten gleich mehr von Christa Kummer!“ Ein wenig fad, denke ich und formuliere auch schon laut die gereimte Alternative: „Der Summer, der is’ ummer, sagt uns gleich die Christa Kummer!“ Ein Blick zu meiner links von mir sitzenden Kollegin zeigt mir, dass ich einen folgenschweren Fehler begangen habe. Ihr Gesicht ist unter der dicken Schminke bereits leicht gerötet. Ihre Lippen sind fest aufeinandergepresst, während sich ihre Wangen wölben. Sekunden später entweicht die darunter gestaute Luft mit einem lauten Prusten. Das darauf folgende schallende Gelächter wird von einem stakkatohaften Glucksen abgelöst, das seinerseits nahtlos in einen heftigen Hustenanfall übergeht. Noch dreißig Sekunden, denke ich und sehe in die schreckgeweiteten Augen der Maskenbildnerin, die mit einer Kleenex-Schachtel angerückt ist und versucht zu retten, was zu retten ist. Der Lachanfall meiner Kollegin hat auch bei mir einen Schweißausbruch ausgelöst. Auch ich bin dankbar für das Kleenex. „Noch zehn Sekunden!“ Das ist jetzt die letzte Zeitansage aus dem Regieraum. Aus dem Augenwinkel heraus sehe ich, wie meine Kollegin noch immer gegen den Lachkrampf ankämpft, und dann erklingt auch schon die vertraute Signation. Abwechselnd lesen wir die Headlines aus dem Off, fehlerfrei, wenn auch ein wenig angestrengter als sonst. Dann die Begrüßung im Doppel, die erste Moderation „gehört“ Ingrid Thurnher. Ich wage nicht mich zu bewegen, verziehe keine Miene. Ich weiß, dass die kleinste Regung unkontrollierbare Folgen haben könnte, aber ihre Professionalität siegt. Knapp war es trotzdem …
Die Arbeit mit einer echten „Lachwurzn“ macht Spaß, aber manchmal ist sie eben auch ein Risiko. Dabei kennt gerade Ingrid Thurnher auch die andere Seite: Am 12. Juni 2001 war sie es, die am Todestag des legendären ZIB2-Moderators Robert Hochner die Gedenksendung für ihn moderieren musste. Durchgehend mit feuchten Augen und beschlagener Stimme. Als sie schließlich am Ende der Sendung eine weiße Rose für den allzu früh verstorbenen Kollegen auf dem ZIB-Tisch niederlegte, brach es aus ihr heraus, und die Tränen waren nicht mehr zu halten. Aber damals weinten wohl eine dreiviertel Million Österreicherinnen und Österreicher mit ihr. Fernsehen ist und bleibt ein emotionales Medium. Selbst dort, wo es „nur“ informieren will, löst es beim Zuschauer Gefühle aus – Freude, Trauer, Ekel, Angst, Mitleid, Ärger, Zorn … Genau das hat es wohl über die Jahrzehnte so erfolgreich gemacht.
In diesem Buch geht es nicht zuletzt um die Emotionen hinter der oft glatten und perfekten Fassade der TV-News. Es soll zeigen, wie TV-Nachrichten entstehen, nach welchen Kriterien sie ausgewählt werden, wie Entscheidungen zustande kommen und wer sie trifft. Aber es geht auch um die Macher und ihre Macken, um die Frauen und Männer vor und hinter den Kameras, die oft unter widrigen Umständen Sendungen aus dem Boden stampfen müssen. Es geht um die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze des TV-Journalismus und zeigt, wie oft auch bei bester Planung der Zufall Regie führt.
Als Grundlage für dieses Buch diente mir das eigene Erleben aus mehr als zwanzig Dienstjahren in unterschiedlichen Funktionen und an unterschiedlichen Orten, aber immer im Aktuellen Dienst des ORF. Darüber hinaus habe ich bei ehemaligen Kolleginnen und Kollegen recherchiert und sie nach ihren Erlebnissen und Erfahrungen befragt. Es ist meine erklärte Absicht, die Leserinnen und Leser ausgiebig hinter die Kulissen blicken zu lassen. Und dafür eignen sich Insider-Storys allemal am besten. Wenn es zusätzlich auch noch gelingen sollte, Fakten zu vermitteln und Zusammenhänge transparent zu machen, hätte ich mein Ziel erreicht: Dass Sie wissen, was im Newsroom los ist, wenn draußen in der Welt was los ist.
Hand aufs Herz – wer kennt schon Jess Oppenheimer? Dabei müsste sein Foto zum ehrenden Angedenken auf dem Schreibtisch einer jeden Fernsehmoderatorin und eines jeden Fernsehmoderators stehen. Denn Jess Oppenheimer ist der Erfinder des Teleprompters, und ohne den geht im Fernsehen ganz allgemein fast nichts und bei den Nachrichten gar nichts. Mit dem News-Geschäft hatte der 1913 in San Francisco geborene Autor und Regisseur freilich nie etwas zu tun. Sein Metier war die Unterhaltung – zunächst im Radio, dann im Fernsehen. In den fünfziger Jahren war er Produzent und Mastermind der legendären CBS-Sitcom „I love Lucy“, und die regte ihn auch zur wichtigsten seiner zahlreichen Erfindungen für Radio, Film und Fernsehen an. Oppenheimer hielt tatsächlich 18 Patente, darunter eben auch jenes für den „in-the-lens-teleprompter“, der seinen Siegeszug im Fernsehen ganz genau am 14. Dezember 1953 antrat. Damals wurde er zum ersten Mal von den beiden Schauspielern Lucille Ball und Desi Arnaz verwendet – und zwar für eine Philip-Morris-Zigarettenwerbung, die an jenem Tag in „I love Lucy“ ausgestrahlt wurde. Zeit war im Fernsehen wohl schon damals Geld, und Schauspieler mit schlechtem Gedächtnis waren offenbar der Schrecken der Produzenten, sodass sich Oppenheimers Erfindung vom ersten Tag an lohnte. Freilich war das, was er zum Patent angemeldet und 1955 an die einschlägig aktive Firma „Autocue“ (im Lauf der Zeit ist der Firmenname zum Synonym für das Gerät geworden) in Lizenz verscherbelt hatte, eine rudimentäre Form dessen, was Moderatoren (und wahlkämpfende Politiker in den USA) heute unter diesem Hilfsmittel verstehen. Immerhin überlebte sein vergleichsweise primitives Papierrollensystem bis 1969, dem Jahr, in dem Autocue den ersten „closed-circuit prompter“ (sichtbar nur für die Benützer im Studio, aber nicht für die Zuschauer zuhause) vorstellte. Seither hat sich an der „Karaoke-Maschine für Moderatoren“ nicht allzu viel geändert.
Auch wenn es für viele noch immer nach Magie aussieht, technisch ist das Geheimnis nicht nur längst gelüftet, sondern auch leicht zu durchschauen – im wahrsten Sinn des Wortes. Und hier ist die Bauanleitung: Unter das Kameraobjektiv wird waagrecht (mit dem Bildschirm nach oben) ein Monitor angebracht, der zunächst den Text spiegelverkehrt anzeigt. Die Moderatoren lesen den Text dann von einem vor dem Objektiv montierten (schräg nach unten in Richtung des Textes zeigenden) Einwegspiegel ab, während sie unentwegt direkt in die Kameralinse blicken. Für die Qualität des Bildes stellt der Einwegspiegel kein Problem dar, weil die Kameras diese minimale Beeinträchtigung leicht ausgleichen können. Bleibt noch die Frage, wie der Text selbst in den Teleprompter kommt. Nun, in der Oppenheim-Ära und noch lange danach (ehrlich gesagt, bis in die neunziger Jahre) griff man tatsächlich auf die gute alte Schriftrolle zurück. Das heißt, die Moderationstexte wurden per Schreibmaschine auf A4-Blätter getippt, die dann einfach an den Enden zusammengeklebt und aufgerollt wurden. Die Rolle selbst wurde im Technikraum in ein dafür vorgesehenes Gerät gespannt und dann per Hand von der Moderationssekretärin höchstpersönlich abgerollt. Der Text wurde dabei Zeile für Zeile von einer Kamera abgefilmt und auf die Monitore unter den Objektiven der Kameras übertragen und dann gespiegelt. Man kann sich leicht vorstellen, dass dieses System nicht gerade maximale Flexibilität erlaubte: Wurde die Reihung der Beiträge etwa verändert, mussten ja die entsprechenden Moderationstexte aus der Rolle herausgeschnitten und an der neuen Stelle wieder eingeklebt werden. Wurden im Vorfeld einer Sendung die Berichte mehrmals hin- und hergeschoben, konnte es vorkommen, dass der Klebstreifen an so mancher Nahtstelle bereits mehrere Millimeter dick war, und dann passierte das Unvermeidliche: Die Blätter blieben stecken, der Teleprompter stoppte und der Moderator stockte. Nicht selten passierte es auch, dass Blätter von vornherein falsch zusammengefügt wurden und dann der Moderationstext und der folgende Beitrag genau nichts miteinander zu tun hatten.
Dass sich die Wahrscheinlichkeit für menschliches Versagen potenziert, je mehr Menschen an einem bestimmten Prozess beteiligt sind, ist logisch und gilt natürlich auch (oder erst recht) für das Fernsehen. Manchmal wird dem Versagen freilich nachgeholfen, wie das folgende Beispiel zeigt: Die für das Abrollen der Moderationstexte vorgesehene Maschine wurde in jenen Zeiten im ORF von Technikern gewartet, vorbereitet und eingestellt. Ob es Zuneigung zu einer ganz bestimmten Moderationssekretärin oder das Gegenteil davon war, Boshaftigkeit oder Übermut oder das Begleichen einer alten Rechnung, lässt sich heute nicht mehr klären, aber eines Tages gefiel es dem diensthabenden Kollegen von der Technik, die Maschine so einzustellen, dass die zuvor korrekt eingespannte Rolle verkehrt herum abgespult wurde – der Teleprompter im Retourgang also! Das Entsetzen im Gesicht der Kollegin am Drehknopf und ihr Verzweiflungsschrei müssen den Übeltäter in der Sekunde geläutert haben, denn er schaltete augenblicklich um, und der Text lief wieder in die richtige Richtung. Dem Moderator nützte das freilich wenig. Der hatte seine Schrecksekunde auf Sendung, durfte aber weder schreien noch sein Entsetzen zeigen, sondern musste improvisieren und in der Folge vom Blatt lesen. Das ist im Fernsehen fast immer so: Die Letzten beißen die Hunde, und das sind die, die ihr Gesicht in die Kamera halten.
Heute wird der abzulesende Text von den Moderatoren selbst an ihren Schreibtischen in den Computer getippt, abgespeichert und nach einer entsprechenden Kontrolle durch den Chef vom Dienst freigegeben. Auf vielen Sendern (von Bloomberg bis n-tv) wird der Teleprompter auch von den Moderatoren selbst meist via Fußsteuerung (liebevoll „Gaspedal“ genannt) gesteuert, in den Nachrichtensendungen des ORF machen das noch eigene Sekretärinnen oder Assistenten. Sie regulieren im Regieraum, also für die Moderatoren unsichtbar, mit einem Trackingball (eine Art auf den Kopf gelegte Computermaus) die Geschwindigkeit, je nachdem, ob schneller oder langsamer gelesen wird. Verspricht sich der Moderator, ist es von Vorteil, wenn auch der Text stehen bleibt. Andernfalls ist das Chaos perfekt. Asynchrone „Autocue-Pärchen“ vor und hinter der Kamera sind der Schrecken der Chefs vom Dienst. Schließlich hat der Teleprompter einen nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt: Gleichmäßige Sprechgeschwindigkeit sorgt für einen ausgeglichenen Zeitetat, und das ist bei einer Sendung wie der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit einem derart engen Zeitkorsett (derzeit siebzehn Minuten und keine Sekunde mehr) die halbe Miete. Schließlich muss der Hauptabend pünktlich um 20.15 Uhr beginnen und keine Sekunde später. Läuft etwa auf RTL der gleiche Film wie im ORF, könnte ein früherer Start für Tausende österreichische Zuschauer Grund genug sein, den Streifen bei der Konkurrenz anzuschauen (die meisten von ihnen kommen freilich beim ersten Unterbrecher-Werbeblock wieder zurück).
Stichwort Zeitrechnung: Die in allen ORF-Redaktionen verwendete Textverarbeitung namens RedSys erlaubt die Umrechnung von Wörtern in Sekunden. Das bedeutet, dass für jeden geschriebenen Satz automatisch die dafür benötigte Sprechzeit (bei durchschnittlicher Sprechgeschwindigkeit) ausgewiesen wird. Die von den Moderatoren vor der Sendung geschriebenen Texte werden also auf die Beitragslängen addiert, und daraus ergibt sich die Gesamtlänge der Sendung. Liegt diese über dem Budget von siebzehn Minuten, muss der „Überzug“ (die Sekundenzahl blinkt dann anklagend in grellem Rot ganz oben in der linken Spalte der Sendeliste) gekürzt werden. Bevor ein ganzer Beitrag gestrichen oder in der Sprache der Newsmacher „versenkt“ wird, müssen zuerst meist die Moderationstexte daran glauben. Wird während der Sendung ein Zeit-Überzug aufgebaut, weil sich der Moderator verspricht oder ein Studiogast die vorgegebene Zeit missachtet, bleibt dem als „Fahrdienstleiter“ der Sendung am Regieplatz agierenden Chef vom Dienst oft nur noch der lapidare Befehl „angasen!“ Der ist an den Autocue-Assistenten gerichtet und bedeutet schlicht schnelleres Drehen. Dem Moderator im Studio bleibt dann ebenfalls nichts anderes übrig, als beim Reden einen Zahn zuzulegen. Nach der Sendung spielen sich nach solchen Höllenritten im Newsroom nicht selten emotionale Szenen ab, und oft genug muss der Assistent mit dem schnellen Finger die Suppe auslöffeln. Für den Chef vom Dienst zählt in solchen Fällen meist nur eines: „Hauptsache, wir haben eine Punktlandung hinbekommen!“ Andernfalls hätte ein Konflikt mit der Sendeleitung gedroht. Sie wissen schon, der Hauptabend …
Moderatoren sind freilich nicht die einzigen, die im Umfeld der ORF-News auf den Teleprompter vertrauen. Der prominenteste „Externe“ ist der Bundespräsident. Für seine Fernsehansprachen zum Nationalfeiertag und zu Neujahr rückt regelmäßig eine ansehnliche Crew vom Küniglberg in der Hofburg an: der Ressortleiter Innenpolitik als redaktionell Verantwortlicher, der Betriebswirtschaftliche Leiter (BWL) als Gesamtverantwortlicher für die Aufnahme, der Regisseur, ein Kameramann mit Assistent, ein zusätzlicher Tontechniker, zwei Lichttechniker (in der Hofburg ist es düster) und last but not least der Autocue-Assistent. Für den Außeneinsatz, und das ist jeder Einsatz außerhalb des Studios, auch wenn er sich irgendwo drinnen abspielt, gibt es nämlich einen kleinen mobilen Teleprompter, der nach demselben Prinzip funktioniert wie sein großer Bruder im Studio. Wie es der Teufel will, gab dieser ausgerechnet bei einer Aufzeichnung der präsidentiellen Neujahrsansprache den Geist auf. Genaugenommen blieb nur der Kontrollmonitor für den Assistenten schwarz, aber damit konnte dieser nicht mehr mitlesen und folglich auch nicht mehr in der richtigen Geschwindigkeit Heinz Fischers Text drehen. Dem Ressortleiter, dem Betriebswirtschaftlichen Leiter und dem Regisseur standen die Schweißperlen auf der Stirn. Woher sollte man auf die Schnelle ein Ersatzgerät bekommen? Und dann noch die vielen Termine des Bundespräsidenten, die dessen Sekretär unentwegt auf die Uhr blicken und theatralisch seufzen ließen! Es war der Betriebswirtschaftlichen Leiter, der die rettende, wenn auch unkonventionelle Idee hatte. Der Autocue-Assistent könne doch von demselben vor das Kameraobjektiv montierten Monitor ablesen, von dem auch der Bundespräsident an seinem Schreibtisch ablas, während er staatstragend in die Kamera blickte. Zu diesem Behufe müsse sich der Assistent nur hinter dem Schreibtisch neben dem Bundespräsidenten auf den Boden setzen, um nicht im Bild zu sein. Die Crew war sich zunächst nicht ganz sicher, wie Heinz Fischer den Vorschlag aufnehmen würde. Aber der zeigte sich entspannt, platzierte den Assistenten, einen jungen Studenten, der sein Enkel hätte sein können, lachend zu seinen Füßen, und die Ansprache konnte auf Band gebannt werden. Kein Zuschauer wäre auf die Idee gekommen, dass die ganze Zeit über neben dem vorsichtig seine Worte abwägenden Staatsoberhaupt ein junger Mann auf dem Boden der Präsidentschaftskanzlei saß, der dafür sorgte, dass eben diese Worte auf den Monitor gezaubert wurden.
Übrigens: ein anderes Mal hat der Bundespräsident selbst von einer Panne der ORF-Crew gar nichts mitbekommen. Ebenfalls bei einer Aufzeichnung der Neujahrsansprache verschlief ausgerechnet der Regisseur den Termin. Diesmal wollte es sich der Betriebswirtschaftliche Leiter als Aufnahmeleiter ersparen, abermals eine Peinlichkeit zu beichten und entschloss sich einmal mehr zur Improvisation. Er verließ kurz das Präsidentenbüro, rief am Handy den schlaftrunkenen Regisseur an und ließ sich von diesem erklären, welche Bildeinstellungen in welcher Phase der Ansprache üblich sind. Danach betrat er entschlossen wieder das Präsidentschaftsbüro, flüsterte dem Kameramann etwas ins Ohr und gab danach seine knappen Anweisungen. Mit Unterstützung des ohnedies erprobten Kameramannes war die Aufzeichnung auch dieser Ansprache bald im Kasten. Gut möglich, dass die eine oder andere Zufahrt, Halbtotale oder Totale von der Norm früherer Aufzeichnungen abwich, aufgeregt hat sich darüber jedenfalls niemand. „Fernsehen ist zu siebzig Prozent Organisation und zu dreißig Prozent Improvisation“, sagt Stefan Wöber, wenn man ihn an Anekdoten wie diese erinnert. Bis ich ihn kennenlernte, dachte ich auch, dass Position und Funktion eines Betriebswirtschaftlichen Leiters ein unnötiger Luxus sind. Die Wahrheit ist: Lösungsorientierte und nervenstarke Kollegen wie er ermöglichen den Journalisten erst ihre tägliche Arbeit. Stefan Wöber ist heute übrigens Betriebswirtschaftlicher Leiter in der Unterhaltungsabteilung des ORF. Dort managt er Sendungen wie den „Musikantenstadl“ und vollbringt dabei logistische Meisterleistungen.
Aber zurück zum eigentlichen Thema, dem Teleprompter. Oft wurde ich gefragt, ob man das Lesen mit der oder durch die Autocue lernen muss. Dazu kann ich nur sagen: Wer lesen kann, kann auch Autocue lesen! Und die unerwünschten Augenbewegungen, werden Sie nun einwenden? Tatsächlich ist Lesen zunächst einmal ja nichts anderes, als einen geschriebenen Text von links nach rechts (zumindest in unserem Kulturkreis) mit den Augen zu erfassen und über den kleinen Umweg ins Gehirn in Sprache umzuwandeln. Das damit verbundene zwangsläufige Wandern der Augen von links nach rechts erschüttert freilich den Glauben daran, dass Ingrid Thurnher oder Tarek Leitner ihre Gedanken frei nach Heinrich von Kleist allmählich beim Sprechen verfertigen, nachhaltig. Die Lösung für dieses Problem ist denkbar simpel: Indem man für die Autocue eine relativ große Schrift mit entsprechend großen Abständen zwischen den Buchstaben wählt, gehen sich pro Zeile meist nicht viel mehr als ein bis zwei Wörter aus. Aber wenn man ganz genau hinschaut oder die Augenpartie mit einer Zoom-Funktion vergrößert, erkennt man, dass sich die Pupillen hin und her bewegen.
Mein verstorbener Vater, ein einfacher Mann vom Land, stand dem Fernsehen Zeit seines Lebens skeptisch bis ablehnend gegenüber und verweigerte sogar lange den Kauf eines TV-Gerätes. „Elektrisch zum Narren halten“, lautete seine Umschreibung für die Television, und ganz Unrecht hatte er damit natürlich nicht. Tatsächlich geben sich die Menschen (nicht nur vor dem Fernsehgerät) gerne ihren Illusionen hin, eben auch der, dass Moderatoren innerhalb kurzer Zeit eine beträchtliche Textmenge memorieren oder überhaupt druckreif frei sprechen können. Die Kunst der freien Rede steht tatsächlich seit der Antike hoch im Kurs. „Die Schrift ist das Gift der Rede. Immer wenn Redner nicht einfach informieren, sondern überzeugen wollen, dann müssen sie den Eindruck tunlichst vermeiden, dass sie von etwas Geschriebenem abhängen“, ist etwa der Journalist und Klassische Philologe Johan Schloemann von der „Süddeutschen Zeitung“ überzeugt. „Ein Stück Papier vor der Nase macht den Redner nämlich zum Bürokraten. Das Papier verhindert den freien Augenkontakt zum Publikum, es mindert die persönliche Glaubwürdigkeit.“ Klar ist aber auch: Getrickst wurde schon immer. Für den Kulturwissenschaftler Schloemann liegt es etwa auf der Hand, dass Kanzeln in der Kirche oder Rednerpulte nicht nur die Funktion hatten und haben, „die Bedeutung des Redners architektonisch in Szene zu setzen, sondern sie sollen zugleich das Manuskript verstecken, von dem die Rede abgelesen wird.“
Und warum haben Nadja Bernhard und Co. dann trotzdem gut sichtbar einen Stoß Moderationskarten vor sich auf dem Tisch oder sogar in der Hand (wie Eugen Freund), außer um sich daran festzuhalten? Weil die Autocue, wie oben beschrieben, an einen Computer gekoppelt ist, und weil Computer bekanntlich manchmal abstürzen. Dann empfiehlt es sich unbedingt, die richtige Karte vor sich liegen zu haben und nicht erst suchen zu müssen. Der zweite Grund sind die „zwei Z“ – Zahlen und Zitate, die immer vom Blatt gelesen werden. Hier kommt dann doch der „amtliche Charakter“ des Papiers zum Tragen, der Glaubwürdigkeit verleihen soll, und auf den man bei der ARD-„Tagesschau“ um 20 Uhr sechzig Jahre lang vertraut hat. Hier wurden die Nachrichten bis 2012 noch konsequent alle vom Papier abgelesen. Eine Art Retro-Stil, der die „Tagesschau“ wirklich zu einem Fossil in der internationalen Fernsehlandschaft machte. Die legendäre Dagmar Berghoff bekannte sich bei ihrem Abschied von der Sendung im Jahr 1999 zum altmodischen Verlautbarungsstil: „Der Zuschauer sieht, dass der Sprecher etwas in der Hand hält. Das wirkt doch viel glaubwürdiger.“ Berghoff war übrigens ursprünglich Schauspielerin und – wie Wikipedia vermerkt – die „erste … weibliche Besetzung im Tagesschau-Sprecheramt“. Im Gegensatz dazu vertraut das Anchorman-Prinzip auf die Glaubwürdigkeit von Personen und nicht von Papier, und weil es sich „über die Verfassungspläne von Usbekistan nicht so redet, dass es aus der Seele sprudelt“, wie ZDF-Moderator Wolf von Lojewski einmal bekannte, braucht es eben den Teleprompter.
Bei Interviews ist der Teleprompter hingegen keine Hilfe, und das gilt sowohl für Moderatoren als auch für Interview-Gäste. Seinem Gegenüber in die Augen zu schauen und eine Frage zu stellen oder zu beantworten, schließt logischerweise aus, dass man gleichzeitig in die Kamera schaut. (Manche Politiker tun das trotzdem, wenn sie glauben, etwas besonders Wichtiges zu sagen zu haben.) Ihre Fragen haben Moderatoren daher meist auf einem Zettel vor sich. Mehr als ein Sicherheitsnetz oder, wenn Sie so wollen, ein „Schummler“ ist das aber nicht, denn Interviewfragen abzulesen zeugt nicht gerade von hoher Professionalität (dasselbe gilt vice versa auch für die Antworten), und je nach Gesprächsverlauf werden die gestellten Fragen einmal mehr, einmal weniger mit dem vorbereiteten Katalog zu tun haben. Ein guter Interviewer muss schließlich zuhören, ein- und nachhaken können! Für sogenannte Studiogespräche mit Kollegen aus der Redaktion oder Schaltgespräche zu Korrespondenten und Reportern gilt das natürlich nicht. Diese Interviews werden im Vorfeld bis ins Detail abgesprochen und manchmal sogar vor der Sendung geprobt. Dennoch drohen auch solche „Interviews“ das eine oder andere Mal zu scheitern. Ich selbst habe einmal den Ressortleiter der „Zeit im Bild“-Innenpolitik, Hans Bürger, beinahe zum Schleudern gebracht, weil ich bei einem Studiogespräch in der „Zeit im Bild“ die drei vereinbarten Fragen nichtsahnend durcheinandergebracht und die zweite mit der dritten vertauscht habe, was der Logik im Aufbau der Bürger’schen Analyse ziemlich zuwiderlief. Mein Gesprächspartner blieb cool – und bei seinem vorbereiteten Konzept. Das heißt, auf Frage drei folgte Antwort zwei, und auf die nach hinten gerutschte Frage zwei dann Antwort drei. Das ergab nur bedingt Sinn, aber beschwert hat sich bis dato niemand. Die Zuschauer sind offenbar von Politikerinterviews bereits gewohnt, dass Fragen nicht beantwortet werden.
Mein Nachfolger in der „Zeit im Bild“, Eugen Freund, hat während eines Analyse-Gespräches mit dem Leiter des „Zeit im Bild“-Wirtschaftsressorts, Christoph Varga, die Fragen offenbar gleich ganz vergessen – oder vergessen aufzuschreiben. Während Varga noch die erste Frage beantwortet, wächst plötzlich Freunds Kopf suchend von links ins Bild. Freund nimmt die Brille ab und das auf dem Tisch liegende Manuskript Vargas ins Visier, aus dem er sich offenbar Aufschluss über den weiteren Gesprächsverlauf erhofft. Allerdings vergeblich, denn Freund versucht es noch mehrmals, einmal mit, einmal ohne Brille und Varga bereits gefährlich nahe kommend. Dass er bei diesen Versuchen immer wieder im Bild ist, entgeht ihm. Schließlich erlöst Varga ihn und das Publikum, indem er seine Analyse unterbricht und Freund mit nachsichtigem Lächeln – „Ich denke, Sie haben Ihre Fragen vergessen!“ – sein Manuskript überlässt.
Eugen Freund verdanke ich übrigens die Bekanntschaft mit dem „Bottleprompter“. Das ist die absolute Low-Tech-Variante der Autocue, die sich aber bei Außeneinsätzen, bei sogenannten „Aufsagern“ oder auch bei Live-Einstiegen sehr bewährt hat und nicht zuletzt extrem stromsparend ist. Man druckt einfach seinen Text in einer möglichst großen Schrift auf ein A4-Blatt und klebt dieses dann der Breite nach wie eine Bauchbinde auf eine PET-Mineralwasser-Flasche. Dann braucht man nur noch einen Helfer (meist ist das der Ton-Assistent), der die Flasche waagrecht und möglichst dicht unter das Objektiv der Kamera hält und dabei langsam dreht, sodass der Redakteur bequem den Text ablesen kann. Ob die Flasche voll oder leer ist, macht grundsätzlich keinen Unterschied – es sei denn für den Helfer, der sie halten und gleichmäßig drehen muss … Eine noch einfachere Variante des Teleprompter sind jene großen, mit dicken schwarzen Blockbuchstaben per Hand beschriebenen Kartons in der Größe eines Flipchart-Blattes, die bei Shows und Galas zum Einsatz kommen und politisch völlig unkorrekt zumindest von alten Hasen am Set noch immer „Neger“ genannt werden. Für ihren Einsatz sind zwei Helfer vonnöten: einer, der die Kartons hält und einer, der das jeweils aktuelle Blatt wegnimmt, sobald der Moderator oder die Moderatorin bei der letzten Zeile angekommen ist. Ganz am Anfang waren diese überdimensionalen „Schummler“ mit Kreide beschriebene Schiefertafeln. Aus jener Zeit stammt auch die folgende Anekdote, die ich dem deutschen Fernseh-Urgestein Axel Buchholz verdanke: Bei einer Fernsehaufzeichnung konnte eine Schlagersängerin ihren Text beim Playback-Singen nicht, sodass der entnervte Regisseur schließlich aus dem Regieraum über Lautsprecher das Kommando „Stellt bitte den Neger neben die 2!“ brüllte. Bei dieser Aufzeichnung war ein afrikanischer Student Kabelhelfer, und prompt forderte ihn einer seiner Kollegen auf, sich neben die Kamera mit der Nummer 2 zu stellen. (In jedem Studio sind die Kameras durchnummeriert, weil die Geräte stets die gleichen bleiben, während die, die sie bedienen, häufig wechseln. Wenn der Regisseur seine Kommandos gibt, spricht er die Kameraleute nicht mit deren Namen an, sondern mit den Nummern für das jeweilige Gerät, das sie bedienen.)