Totensommer
Kriminalroman
Aus dem Norwegischen
von Gabriele Haefs und Andreas Brunstermann
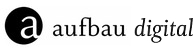
Trude Teige, Jahrgang 1960, war Journalistin und gehört zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen Norwegens.
Andreas Brunstermann übersetzt Romane und Sachbücher aus dem Norwegischen und Englischen. Er lebt in Berlin.
Gabriele Haefs übersetzt aus dem Dänischen, Englischen, Niederländischen und Walisischen, u. a. Werke von Jostein Gaarder, Håkan Nesser und Anne Holt. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, zuletzt 2008 den Sonderpreis für ihr übersetzerisches Gesamtwerk. Sie lebt in Hamburg.
Ein Mord im hohen Norden …
Kasja Coren ist eigentlich Fernsehjournalistin, aber sie hat sich an die Küste von Møre zurückgezogen, um ein Buch zu schreiben. Dann jedoch wird ein Deutscher ermordet, der seit vielen Jahren seinen Urlaub im Ort verbrachte und immer bei der alten Jenny wohnte. Die Trauer der alten Frau scheint weit über die übliche Betroffenheit hinauszugehen. Kasja beginnt zu recherchieren – und sie stößt auf eine unglaubliche Geschichte, die nicht nur mit den Geschehnissen unter deutscher Besatzung, sondern auch mit ihrer eigenen Vergangenheit verknüpft scheint.
Ein ungewöhnlicher Mordfall, dessen Spuren tief in die deutsch-norwegische Geschichte führen.
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Totensommer
Kriminalroman
Aus dem Norwegischen
von Gabriele Haefs und Andreas Brunstermann
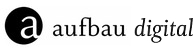
Inhaltsübersicht
Über Trude Teige
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Vier Wochen später
Impressum
Für Fredrik und Syne
Samstag, 15. Juli 2006
Es war dunkler als sonst im Sommer, einige Stunden zuvor war Nebel heraufgezogen. Es half nur wenig, dass er die große Tür zum Meer hin geöffnet hatte, um das Abendlicht einzulassen.
Die Sicht war minimal. Das machte nichts, er wollte an diesem Abend ohnehin nicht hinausfahren und Netze auslegen. Außerdem war am nächsten Tag Sonntag, und da verrichteten die Ortsansässigen niemals solche Arbeiten; jedenfalls fuhren sie nicht hinaus aufs Meer, um Netze einzuholen.
Doch, er kannte die ungeschriebenen Regeln nach all den Jahren hier. Und er wollte die Leute im Dorf nicht provozieren, die hinter seinem Rücken über alte Tage redeten und es nicht richtig fanden, dass er sich verhielt, als wäre er einer von ihnen.
Das Netz hatte ein großes Loch gehabt, als er es zwei Tage zuvor bei Svartskjæret eingeholt hatte. Die Netzflickerei gefiel ihm, auch wenn er das Gefühl hatte, die Technik in jedem Sommer, wenn er herkam, aufs Neue erlernen zu müssen.
Jetzt war nicht mehr viel übrig. Seine Zunge schob er zwischen die Lippen, als er die Nadel durch eine Masche führte, einen Knoten machte und die Nadel zurückschob. Es wurde eine schöne Schlinge in genau der richtigen Größe.
Er hielt das Fischernetz vor die Glühbirne, die von der Decke hing, um besser sehen zu können. Das Licht erhellte nur die Stelle, an der er saß, der übrige Raum lag im Dunkeln. Der Bootsschuppen hatte keine Fenster, und das Holz war mit der Zeit nachgedunkelt. Wände, Decke und Boden schluckten das Licht.
Als er gerade dachte, es sei schon spät, er müsse jetzt aufhören, hörte er, dass die Tür zum Bootsschuppen geöffnet wurde. Er kappte den Faden mit dem kleinen Messer, das an seinem Finger befestigt war, richtete sich langsam auf und ließ das Netz in die Netzbütte fallen.
Ihm blieb keine Zeit sich umzudrehen und zu sehen, wer da hinter ihm aus dem Schatten trat.
Sonntag, 16. Juli 2006
Nils Vinjevoll war ein Mann, der noch keiner Fliege etwas zuleide getan hatte. Er mochte Streitigkeiten und Konflikte nicht, solchen Dingen wich er konsequent aus. Ein Ehrenmann, hieß es über ihn.
Im kommenden Jahr würde er fünfzig werden, und in letzter Zeit hatte er sich immer häufiger die Frage gestellt: War das nun alles?
Nicht, dass es ihm nicht gutging. Im Gegenteil. Die Arbeit auf der Bohrinsel ließ ihm viel Freizeit und bescherte ihm guten Verdienst. Er wohnte mit seiner Mutter in einem großen, gepflegten Haus.
Er war nicht unglücklich, aber er war auch nicht glücklich.
Er hatte das Gefühl, dass etwas fehlte.
Ihm fehlte eine Frau. Aber das war es nicht, was ihm so zu schaffen machte. Damit hatte er sich schon vor vielen Jahren abgefunden, aber dennoch saß er nun hier und verspürte eine immer größer werdende Leere.
Er war um sechs Uhr aufgestanden, hatte sich eine Tasse Kaffee gekocht und sich an den Küchentisch gesetzt. Der Meeresnebel hatte die Sommernacht verdüstert, jetzt aber löste er sich auf, der letzte Rest hing noch über dem Fjord, ein dünner Schleier, der sich wie ein Seidenband zwischen den Inseln dahinwand.
Er fuhr sich mit der Hand über den Bauch. Er versuchte, weniger zu essen, aber das war schwer. Das musste man ihr lassen, seiner Mutter, sie war eine gute Köchin, tischte immer wieder Leckerbissen auf, wenn sie abends vor dem Fernseher saßen.
Sein Vater war mit nur fünfundfünfzig Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Vielleicht lag es in seinen Genen – dass das wirklich alles gewesen war?
Er fühlte sich elendig schlecht in Form, er hatte versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, aber ohne Zigaretten wurde alles so traurig. Vielleicht sollte er mit Sport anfangen? Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Seine Mutter würde glauben, dass er den Verstand verloren habe. Die Nachbarn würden nur noch glotzen, wenn er vorbeigejoggt käme.
Aber warum sollte er sich darum kümmern, was andere meinten. War er nicht ein anderer geworden als der, der er sein wollte, gezwungen zu einer Art Konformität?
Warum mache ich nicht das, was ich will?
Während er auf die vertraute Landschaft hinausblickte, hatte er das Gefühl, eine Art Anfall zu erleiden, eine tollkühne Lust, aufzubegehren, sich gegen das Leben zur Wehr zu setzen, das er lebte. Gegen sich selbst.
Er wartete darauf, dass der Anfall vorüberging, tunkte ein Stück Zucker in den Kaffee und saugte so energisch daran, dass es sich auflöste.
Aber dann stand er auf und ging mit ungewohnter Entschlossenheit ins Badezimmer, um Sommershorts und ein T-Shirt anzuziehen. Er lief in den Keller, wühlte eine ganze Weile herum, dann fand er ein Paar alte Turnschuhe, die er bei der Gartenarbeit getragen hatte. Er lief vor der Garage eine Weile auf der Stelle, das hatte er bei Sprintern im Fernsehen gesehen, ehe sie an die Startblöcke traten. Sein großer Schäferhund, der auf dem Hofplatz an einer Laufleine stand, legte den Kopf schräg und sah ihn an.
Aber als er mit kurzen Trippelschritten auf das weißgestrichene Tor zulief, verließ ihn sein Mut. Er blieb unschlüssig stehen und kam sich vor wie ein Idiot.
Der Anfall war vorüber.
Nein. Er wollte das nicht geschehen lassen. Einige Minuten lang hatte er doch eine ungewohnte Freude verspürt.
Er machte auf dem Absatz kehrt, ging in den Schuppen neben der Garage und holte ein altes Fahrrad. Mit raschen Bewegungen, als fürchte er einen Meinungsumschwung, öffnete er das Tor, stieg auf das Rad, fuhr um die Kurve, bog dann in Richtung Hafengelände ab und fuhr den Weg hinab zu den Bootsschuppen. Dort stellte er das Rad ab und joggte mit kleinen Schritten hinaus auf die Landzunge. Er atmete schwer und keuchend, aber wieder verspürte er diese unbekannte Freude. Ermutigt von diesem Gefühl, legte er alle Kleider ab, bis auf die Unterhose, und sah sich dabei über die Schulter um. Kein Mensch zu sehen, nur einige Schafe. Er watete ins Meer hinaus, atmete tief durch, ließ sich vornüberfallen und tauchte unter.
Als er wieder an die Oberfläche kam, entdeckte er es: Ein kleines gelbes Boot trieb langsam auf ihn zu, kein Motorengeräusch war zu hören.
War da jemand zum Angeln draußen? An einem Sonntag? Er schwamm zum Ufer, lief an Land, packte seine Kleider und suchte eilends Zuflucht hinter einem Felsbrocken. Beim Anziehen schaute er zu dem Boot hinüber.
Kein Lebenszeichen zu erkennen.
Eine große, fette Mantelmöwe hob weiter draußen auf der Landzunge ab und flog auf das gelbe Boot zu. Vinjevoll schaute dem Vogel hinterher. Der drehte mit langsamen, kräftigen Flügelschlägen einige Kreise über dem Boot und schrie dabei heiser.
Vinjevoll blieb eine Weile stehen, wartete darauf, dass das Boot an Land trieb. Als das jedoch nicht passierte, sondern das Boot wieder hinausgetrieben wurde, ging er über den Weg zurück und fuhr dann nach Hause. Seine Mutter war noch nicht aufgestanden. Er zog den Overall an, den er immer beim Angeln trug, lief zurück zum Bootshaus, stieg in sein Boot und steckte sich eine Zigarette an, ehe er den Motor anwarf.
Nils Vinjevoll schirmte seine Augen mit der Hand gegen die Sonne ab, als er sich dem Boot näherte. Das offene gelbe Boot mit dem Außenbordmotor wiegte sich leise in den Wellen eines großen Fischkutters, der weiter draußen im Fjord vorüberfuhr.
Nils Vinjevoll glaubte, im Boot etwas zu erkennen, er hatte eigentlich keine Lust, jemanden zu überraschen, hielt es aber für besser, doch nachzusehen.
Langsam glitt er an das gelbe Boot heran, wartete ein wenig, um zu sehen, ob jemand darin den Kopf hob, aber nichts passierte, deshalb lief er an Deck, beugte sich vor und griff nach dem kleinen Motorboot, schaute über die Reling. Die beiden Boote stießen dermaßen zusammen, dass ihm die Zigarette aus dem Mund fiel. Die stieß ein wütendes Zischen aus, als sie den Wasserspiegel traf.
*
Polizeikommissar Kjell Nistad überlegte gerade, ob die Vorhänge in der Küche neu waren, als die Morgenstille vom Klingeln seines Mobiltelefons zerrissen wurde. Er war nicht sicher, aber er glaubte eigentlich, die Küchenvorhänge seien gemustert gewesen. Diese hier waren einfarbig, weiß. Er kam da nicht mehr mit, dauernd wurde irgendetwas ausgewechselt.
Er griff mit resignierter Miene nach seinem Diensttelefon. Es war die Operationszentrale in Ålesund. Sie hatten einen Mann aus seinem Dienstbezirk in der Leitung. Ob er das Gespräch annehmen könne.
Er schluckte den letzten Bissen hinunter, den er noch im Mund hatte, und dachte: Bleibt mir denn etwas anderes übrig?
Er hatte diese Wochenendschichten mit häuslichen Streitereien und Schlägereien im Suff, um die er sich kümmern musste, so satt, aber sie hatten so wenige Leute, dass es ihm nicht erspart blieb. Diese blöden Politiker, die in Oslo saßen und keine Ahnung hatten, wie es hier im Bezirk aussah, im wirklichen Leben.
Er warf einen Blick auf die Küchenuhr. Fünf nach halb acht. Verdammt! Was konnte das denn sein, um diese Zeit an einem Sonntagmorgen?
Es war Nils Vinjevoll. Nistad kannte ihn gut, sie kamen aus demselben Dorf. Vinjevolls Stimme war außer sich. »Es geht um Gert, er ist tot.«
»Tot? Wer ist tot?«
»Gert, sag ich doch! Er ist völlig kalt.«
Nistad bat ihn, sich zu beruhigen. »Hol jetzt mal tief Luft und erzähl alles von Anfang an.«
Während Vinjevoll berichtete, erhob sich Kjell Nistad langsam und mit verblüfftem Gesicht vom Tisch, und als er auflegte, biss er in sein Brot und spülte den Bissen dann mit einem Schluck Kaffee hinunter. Er lief hinaus auf den Gang, nahm die schwarze Uniformjacke aus dem Schrank und streifte sie über. Er zog den Bauch ein und musterte sein Spiegelbild mit ernster Miene, während er die Dienstmütze aufsetzte.
Kajsa Coren stand am Wohnzimmerfenster und schaute den Kindern hinterher, als die über den alten Karrenweg zum Wasser hinuntergingen, zusammen mit den Nachbarskindern. Anders war elf und Thea sieben.
Sie wollten ihr Morgenbad nehmen, sie durften vom Anleger springen, weil der Vater eines der anderen Kinder dabei war. Hier war es viel kälter als im Meer zu Hause in Asker, aber den Kindern war es egal. Als Kind hatte Kajsa das Wasser hier oben auch nicht kalt gefunden, sie hatten den ganzen Sommer hindurch im Meer gebadet, egal, wie das Wetter war. So erinnerte sie sich an die Sommer in ihrer Kindheit und später, als sie hier bei Tante Agnes gewohnt hatte.
Ein Auto kam über die Brücke von der Nachbarinsel, fuhr am Strand entlang, wie sie das nannten, auch wenn es gar kein Strand war, sondern nur ein steiniger Streifen auf der einen und steile Felsen auf der anderen Seite. Kajsa beugte sich vor und schob die Vorhänge zur Seite. Es war ein Streifenwagen. Der bog bei den ersten Häusern ab, fuhr in den Hamneveg und dann weiter am Wasser entlang.
Kajsas Blick wanderte zurück zu den Kindern. Sie sah, dass Anders sich umgedreht hatte und dem näherkommenden Auto entgegensah. Ihr erster Gedanke war, zu ihm zu laufen, ihn zu beruhigen, zu sagen, ein Streifenwagen müsse nicht bedeuten, dass etwas Gefährliches passiert sei. Aber dann ging Anders weiter.
Hinter ihnen lag ein schweres Jahr.
An so vielen Morgen hatte sie mit schwerem Herzen hier gestanden und gedacht: Ob Anders heute in die Schule geht?
Die Diagnose war nicht schwer zu stellen gewesen. Er war traumatisiert, nachdem er und sie ein Jahr zuvor mitten in die dramatische Aufklärung von Patientenmorden in dem Pflegeheim in Asker geraten waren, in dem Kajsas Mutter lebte.
Kajsa hatte sich von ihrer Arbeit beurlauben lassen, um bei Anders zu Hause sein zu können. Nach und nach war es dann besser geworden, im letzten Monat vor den Ferien war er jeden Tag in die Schule gegangen.
Und zu allem Überfluss hatte sie sich von Aksel scheiden lassen, dem Vater der Kinder. Sie war ausgezogen, aber es war eine Erleichterung für sie gewesen.
Ihr neuer Lebensgefährte, Karsten, hätte eigentlich mit ihnen zusammen vor einer Woche herkommen sollen. Aber er hatte soeben eine neue Stelle bei der Kripo angetreten und musste in Zusammenhang mit einem Mordfall nach Tromsø.
Das Haus, das Kajsa sechs Jahre zuvor von ihrer Tante geerbt hatte, war das ehemalige Altenteil des Hofes. Sie hatte hier gewohnt, bis sie zehn Jahre alt gewesen war, dann war ihre Familie nach Asker gezogen. Das Haus war Anfang der zwanziger Jahre gebaut worden und musste dringend renoviert werden. Kajsa hatte es nicht über sich gebracht, etwas zu unternehmen, sie hatte es einfach vermietet. Als Mutter kleiner Kinder und politische Journalistin war sie vollauf beschäftigt gewesen. Außerdem war es nach dem Tod ihres Vaters schwer für sie gewesen, hier zu sein. Die wenigen Besuche bei ihrer Tante hatten die vielen Erinnerungen, die Trauer wieder frisch und greifbar gemacht: Sie sah ihn so lebendig vor sich, wie er durch die Berge lief, zum Fischen im Boot saß, wie er Heu auf Reuter hängte, im Bootsschuppen Köder an den Leinen befestigte oder mit einem Buch unter der großen Leselampe saß, in dem großen Lehnstuhl, der noch immer im Wohnzimmer stand.
Karsten war außer sich vor Begeisterung gewesen, als sie hergefahren waren, um zu überlegen, was sie mit dem Haus machen sollten. Er hatte die Wohnzimmertür geöffnet, war auf die Veranda getreten und hatte die Arme ausgebreitet: »So etwas haben zu können!«, hatte er gesagt. »Wir werden es renovieren. Behalten, was wir behalten können, modernisieren, so ein bisschen wie … Shabby Chic?«
Kajsa sah einen Mann in Polizeiuniform. War das nicht Kjell Nistad? Sie holte das Fernglas. Doch, sicher, das war er. Sie erkannte ihn am Gang, als er einen Mann begrüßte und mit diesem zusammen zu einem offenen gelben Boot am Anleger ging. Sie kannte ihn von früher, als sie hier gewohnt hatte, auch wenn er einige Jahre älter war als sie. Sie war ihm auch später häufig begegnet, im Sommer, wenn sie hier Ferien gemacht hatte, aber nun hatte sie ihn lange nicht mehr gesehen. Seine Haltung war unverändert: Er war groß und stand ein wenig O-beinig, so, wie er es immer getan hatte, die Hände auf die Hüften gestützt.
Kajsa erkannte auch den Mann, mit dem er sprach: Es war Nils Vinjevoll, der Lokalhistoriker. Sie hatte vor, ihn bald einmal zu besuchen.
Sie arbeitete an einem Buchprojekt, an das sie schon seit mehreren Jahren dachte, zu dem ihr aber immer die Zeit gefehlt hatte: ein Buch über Frauen an der Küste von Sunnmøre während des Krieges. In diesem Sommer hier oben wollte sie Interviews führen und schreiben.
Kajsa biss in einen Apfel. Es würde wohl ein heißer Tag werden. Der Nebel, der am Vorabend vom Meer heraufgezogen war, hatte sich verzogen. Das Thermometer zeigte zwanzig Grad im Schatten an. Sie setzte sich auf Tante Agnes’ alte Bank, lehnte den Kopf an die Wand und schloss die Augen. Dann hörte sie jemanden rufen.
Sie sah Jenny vom Nachbarhof den Weg hinunterlaufen, gefolgt von Margrethe, der Schwester, die aus den USA zu Besuch gekommen war.
Jenny war um die achtzig, aber außergewöhnlich rüstig. Margrethe, die fast zwanzig Jahre jünger war, holte sie ein, und Arm in Arm eilten sie weiter auf den Hafen zu.
Kajsa erhob sich und trat ans Geländer, folgte ihnen mit Blicken.
Dann fiel ihr auf, dass auch Robert Brekke, Jennys und Margrethes Neffe, aus seinem Haus beim Campingplatz gelaufen kam. Seine Mutter Borghild stand auf der Treppe und schaute ihm hinterher.
Etwas musste geschehen sein.
Kajsa ging die Treppe hinunter und lief hinter den anderen her.
Margrethe stützte Jenny auf dem Weg zu einigen Fischkästen, als Kajsa sie erreichte. Jenny ließ sich schwer auf einen Kasten sinken. Sie weinte lautlos.
Kajsa begrüßte Kjell Nistad und fragte, was geschehen sei.
Zur Antwort nickte er zu dem gelben Boot hinüber, das weiter draußen am Kai vertäut war.
»Was ist damit?«, fragte Kajsa und reckte den Hals. Mit einiger Mühe konnte sie den Bug sehen.
»Gert«, sagte er, als ob das alles erklärte.
»Gert?«
»Ja.«
Nistad nickte mehrmals und kratzte sich an der Wange.
Nils Vinjevoll streckte die Hand aus und begrüßte Kajsa. »Ich habe ihn im Boot gefunden, das trieb vor der Landzunge«, sagte er und zeigte hinüber.
»Ja, das ist Boot Nummer drei, Gert nimmt das immer«, sagte Robert Brekke.
Kajsa schaute zum Boot hinüber, auf das eine große Drei gemalt war.
»Und Gert liegt drinnen«, fügte Brekke hinzu. »Gert Benedict.«
Nistad richtete sich auf und stemmte die Hände in die Seiten. »Ja, das stimmt«, sagte er und nickte.
»Aber wie …?«
»Das lässt sich noch nicht sagen«, sagte Nistad.
Kajsa musterte Jenny. Die atmete schwer, gab aber keinen Laut von sich. Sie wischte sich die Augen mit einem Taschentuch ab.
Kajsa wusste, wer Gert Benedict war, ein älterer deutscher Tourist, der jeden Sommer kam und sich bei Jenny einmietete.
»Ich wusste, dass etwas nicht stimmt«, flüsterte Jenny.
»Wie denn das?«, fragte Nistad.
Margrethe erklärte, Jenny habe das Boot erkannt, das Gert immer benutzte. Es war das einzige gelbe Boot, das Robert vermietete. Als sie sah, dass Nils Vinjevoll es im Schlepp hatte, hatte sie nachgesehen, ob Gert zu Hause war. Er hatte am Vorabend im Bootsschuppen etwas in Ordnung bringen wollen. Und Jenny und Margrethe waren schlafen gegangen, ehe er zurückgekommen war.
»Er war nicht da, und sein Bett war auch unbenutzt«, sagte Margrethe und warf ihrer Schwester einen besorgten Blick zu. »Komm, wir gehen nach Hause«, sagte sie dann und half Jenny beim Aufstehen.
Kajsa fasste schnell Jennys anderen Arm. Sie sah, dass Borghild noch immer auf der Treppe ihres Hauses beim Campingplatz stand. Als sie näherkamen, ging Borghild ins Haus. Warum kam sie ihnen nicht entgegen? Sie war doch Jennys und Margrethes Schwester, wollte sie denn nicht wissen, was geschehen war? Kajsa wusste von Tante Agnes, dass die Harmonie in der Familie nicht gerade groß war, aber dass es so schlimm stand?
»Ich wusste, dass etwas passieren würde«, flüsterte Jenny mehrmals vor sich hin, als sie den Weg hochgingen.
9. April 1940
Die fünfzehn Jahre alte Jenny saß auf der Treppe und spielte mit ihrer Katze, als sie ihre beste Freundin Ada, über die Wiese laufen sah, wo die Kühe grasten.
Dass sie sich das traute, wo doch der Stier draußen war!
Die Kühe hoben die Köpfe, kauten langsam, der Stier glotzte sie an. Jenny lächelte. Der dachte sicher, dass es keinen Sinn hatte, sie zu beachten, denn niemand konnte so schnell laufen wie Ada.
Ada schwenkte die Arme und rief aufgeregt: »Jetzt ist …« Sie blieb vor Jenny stehen und rang um Atem. »Jetzt ist Krieg!«
»Krieg?«
Jenny sah sie verständnislos an.
»Ja, in Norwegen ist Krieg.«
»Woher weißt du das?«
»Von meinem Vater, der hat das im Radio gehört.«
In diesem Moment trat Jennys Vater in die Tür: »Was ist denn los?«
»Ada sagt, wir haben Krieg«, sagte Jenny.
Der Vater stürzte ins Haus und holte eine Jacke. In der Tür stieß er auf Jennys Mutter. »Was ist los?«, rief sie ihm hinterher und trocknete sich die Hände an der Schürze ab.
»Die Deutschen kommen!«, antwortete er, rannte an ihr vorbei und lief in die Richtung davon, aus der Ada gekommen war.
»Gott soll uns schützen«, sagte die Mutter und ging ins Haus.
»Ist das nicht spannend?«, flüsterte Ada.
Jenny sah sie überrascht an. »Das ist nicht spannend, das ist gefährlich.«
»Glaubst du, die Deutschen kommen auch hierher? Auf diese langweilige Insel? Aber was können die hier wollen?«
Kjell Nistad setzte sich auf einen Haufen Fischernetze auf dem Kai und zog das Mobiltelefon aus der Tasche. Er schlug sich leicht mit der Faust auf den Brustkasten und schluckte energisch. Sein Magen war nicht in Ordnung, er brannte.
Als junger Polizist hatte er davon geträumt, nur noch als Kriminaltechniker sein Geld zu verdienen. Er hatte nach der Polizeischule eine Zeitlang in Oslo gearbeitet. Es war eine schöne Zeit gewesen, und er hatte sich eine Karriere bei der Kripo vorgestellt. Er hätte ein guter Ermittler werden können.
Aber dann hatte er sich in Gunn-Berit verliebt. Als sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählte, stand er zu seiner Verantwortung, obwohl er durchaus noch nicht bereit für Frau und Kind war. Er ging zurück an seinen Heimatort und sie heirateten. Er deutete an, sie könnten auch in Oslo wohnen, aber da stieß er auf taube Ohren. Gunn-Berit wollte unbedingt in Losvika leben.
Was war er jung und dumm gewesen, er hatte sich doch immer fortgesehnt. Jetzt saß er hier, verheiratet mit einer Frau, die zur Fremden geworden war, sie interessierte sich nur dafür, wie alles aussah, renovierte und kaufte neue Sachen für das Haus. Es war wie ein Puppenhaus, und das ganze Jahr hindurch wimmelte es dort von Handwerkern, fand er. Und wenn alles fertig war und so aussah, wie sie sich das gewünscht hatte, vergingen nur wenige Tage, dann musste sie zum Arzt und sich neue Pillen verschreiben lassen.
Sie schien nur glücklich zu sein, wenn sie Geld ausgeben konnte, und wenn er nun merkte, dass sich bei ihr eine Depression ankündigte, gab er ihr die Kreditkarte, damit sie zum Shoppen nach Ålesund fahren konnte.
Jetzt muss ich in einem Mordfall ermitteln, da brauche ich mir wirklich keinen Vorwand auszudenken, um nicht zu Hause bleiben zu müssen, dachte er und wählte die Nummer des Lensmannsbüros.
»Ist er schon identifiziert?«, fragte Eggesbø.
»Ein deutscher Tourist namens Gert Benedict«, antwortete Nistad.
»Ein Ausländer?«
»Er macht schon seit einem Menschenalter hier Urlaub.«
»Ach, verdammt!«
»Da sagst du was Wahres.«
»Todesursache?«
»Schwer zu sagen, er hat stark am Kopf geblutet.«
»Kann er gestürzt sein?«
»Tja, wenn man das wüsste.«
»Na gut. Ruf den Arzt an, danach sagst du beim Bestattungsunternehmen Bescheid. Und du musst Even informieren, wir müssen die nötigen Untersuchungen durchführen, ehe die Leiche abgeholt wird.«
Natürlich wollte der Lensmann Even dabeihaben, als ob Nistad nicht ohne ihn anfangen könnte. Er hatte trotz allem mehr Erfahrung als der neue junge Polizeibeamte, der in Oslo in der Abteilung für Gewaltverbrechen gearbeitet hatte.
20. Juni 1941
»Der ist einfach toll!«, rief Ada begeistert.
»Aber Ada, das ist doch ein Deutscher!«
Ada schnaubte über Jennys Einwand. »Pah, das ist mir doch schnurz.«
»Irgendwann kommt das raus, die Leute kriegen so was immer mit.«
»Die Leute können mir doch im Mondschein begegnen«, sagte Ada wütend. »In diesem Dorf wimmelt es nur so von Leuten, die sich in Dinge einmischen, die sie nichts angehen.«
»Aber das ist gefährlich«, beharrte Jenny.
»Für wen denn?«
»Für deinen Vater, zum Beispiel. Und meinen Vater, und alle, die Widerstandsarbeit leisten, die nach England fahren, die …«
»Ich sag Helmut doch nichts davon, das kannst du dir ja wohl denken«, fiel Ada ihr ins Wort. »Wofür hältst du mich eigentlich?« Sie sah Jenny empört an. »Wenn du das so siehst, dann mach doch, was du willst.«
»Was soll ich denn sagen?«, fragte Jenny. »Willst du so ein Deutschenmädchen sein?«
»Ich bin ja wohl kein Deutschenmädchen.«
Ada sah Jenny trotzig an. »Das sind doch die, die … die sich anbieten. Und das tu ich nicht.«
»Das sagen die Deutschenmädchen sicher auch.«
»Ist doch egal. Ich hab noch nie für jemanden so empfunden. Helmut ist lieb, er ist ein guter Mensch.«
»Du kannst keinen deutschen Freund haben, Ada.«
»Doch, kann ich wohl.« Sie warf gereizt den Kopf in den Nacken. Die langen blonden Haare flatterten wie ein dünner Vorhang. »Außerdem ist der Krieg bald vorbei, und dann wird alles anders.«
»Woher hast du das denn?«
»Das sagt Helmut.«
»Na gut, dann musst du die Folgen selbst tragen«, sagte Jenny.
Ada stand auf. »Von mir aus.«
»Geh doch nicht …«
»Doch, du hast ja gesagt, was du sagen wolltest. Du willst immer so vorbildlich sein.«
»Ich?«
»Ja, und langweilig. Mein Güte, du bist vielleicht langweilig.«
»Ich finde, du bist ungerecht.«
»Du wirst dir einen langweiligen Mann suchen und dich für den Rest deines Lebens langweilen, du wirst dich zu Tode langweilen«, sagte Ada, kehrte Jenny den Rücken zu und verschwand mit langen, wütenden Schritten.
Jenny blieb stehen und schaute ihr hinterher. Typisch Ada! So impulsiv und gedankenlos. Deshalb bekam sie immer wieder Probleme. Aber zugleich besaß sie die merkwürdige Fähigkeit, sich auch wieder hinauszuwinden. Alle schienen ihr am Ende nachgeben zu müssen, egal, wie sie sich auch benahm. Alle mochten Ada. Hübsch war sie noch dazu. Und bezaubernd, voller Lachen und Leben. Jenny wäre auch gern so gewesen, nicht so schüchtern und still.
Sie stand auf und ging über den Weg vorbei an der Scheune und ein Stück den Hang hinauf zu dem riesigen Findling, der dort lag.
Eine milde Brise wehte, die Luft hatte die Hitze des Sommers verloren, aber ein warmer Hauch streichelte Jennys Gesicht, als sie nach Norden schaute, zu den anderen Inseln von Sunnmøre.
Sie kletterte gern auf den Findling, spürte das Moos unter den Händen, war ganz allein, ungestört. Sie ließ ihren Blick über die Landschaft gleiten, die Inseln, das Meer und die Berge. Unter ihr lag das Dorf, geformt wie ein Hufeisen, ein natürlicher und guter Hafen. Hinter ihr ragte das Losvikfjell auf, und dahinter fiel der Felshang zum Atlantik ab. Dort gab es nichts mehr, nur die Fischgründe, und weiter im Westen: Shetland, England, die Färöer-Inseln.
Der Gedanke an Ada ließ ihr keine Ruhe. Sie kannte Ada, die würde tun, was sie wollte, es brachte nichts, ihr zuzureden.
Jenny mochte keinen Streit. Ada würde sicher lange sauer auf sie sein. Aber früher oder später würden alle wissen, dass sie sich in einen Deutschen verliebt hatte. Es wäre nur zu ihrem Besten, einen Bogen um diesen Helmut zu machen, der »übrigens kein Deutscher ist, sondern Österreicher« wie Ada gesagt hatte.
Aber jedenfalls war er ein Feind.
Es war sonntäglich still, keine Boote waren auf der See, die spiegelglatt dalag und das Sonnenlicht wiedergab, tausend kleine Sterne tanzten an der Oberfläche. Kinder spielten unten am Strand, ihre Rufe und ihr Lachen waren sogar hier oben zu hören. Jenny sah Lina, die Nachbarin, die auf die Treppe vor ihrem Haus trat. Lina schaute die Straße entlang, als ob sie jemanden erwartete. Vielleicht würden Deutsche zum Essen kommen? Lina war »deutschfreundlich«, wie es im Dorf hieß, und sie traf sich mit dem deutschen Leutnant. Sie war eine Witwe mit zwei Kindern, einem halbwüchsigen Jungen und einem jüngeren Mädchen.
Jenny sah zu Lars hinüber, ihrem großen Bruder. Er reparierte hinter der Scheune sein Fahrrad. Sie wusste, warum er dort stand, die Mutter sollte ihn nicht sehen. Sie durften solche Arbeiten nicht am Sonntag verrichten. Schließlich sollten sie Gottes gedenken.
Mehrere Jungen, die sie kannte, die etwas älter waren als sie, waren nach England geflohen. Sie wusste, dass auch Lars und ihr Vater mit diesem Gedanken spielten, sie hatte sie darüber diskutieren hören.
In Adas Augen hatte ein überraschendes Leuchten gelegen, als sie von diesem Helmut erzählt hatte. Ein Ausdruck, den Jenny dort noch nie gesehen hatte, gemischt mit einem erwachsenen Ernst, der Ada überhaupt nicht ähnlich sah. War es wohl so, wenn man verliebt war?
Jenny schaute zu Adas Haus hinüber: Ada und ihr älterer Bruder Gunnar saßen auf der Bank neben der Treppe.
Beim Gedanken an Gunnar verspürte Jenny einen Stich. Er glaubte, sie sei seine Freundin. Das war eigentlich kein Wunder, er hatte eines Abends ihre Hand genommen und sie mit solchen lieben, flehenden Augen angesehen. Sie hatte es nicht übers Herz gebracht, ihre Hand zurückzuziehen, und später, als er ihr den Arm um die Schulter gelegt und sie an sich gedrückt hatte, war es zu spät gewesen, ihn abzuweisen. Gunnar sah gut aus, groß, blond, ein bedächtiger Junge, der nicht viel sagte, einer, der sich nicht dauernd aufspielen musste. Viele schwärmten für ihn, und sie musste ja auch zugeben, dass sie es spannend fand, dass er nun gerade sie mochte.
Im tiefsten Herzen aber beneidete Jenny Ada. Sie selbst war noch nie verliebt gewesen.
»In der Gemeinde Vestøy in Sunnmøre wurde ein Deutscher tot aufgefunden«, sagte die Nachrichtensprecherin. »Die Polizei spricht von einem verdächtigen Todesfall, hat aber bisher noch keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben.«
Kajsa saß am Küchentisch und aß mit Anders und Thea zu Mittag. Im Hintergrund liefen die Nachrichten. Sie schaute zu Anders hinüber und sah, dass er mit dem Butterbrot in der Hand ganz still dasaß und lauschte. Dann schaute er sie an. »Ist der Mann ermordet worden?«, fragte er.
Kajsa stand auf und schaltete das Radio aus. »Ich weiß nicht«, sagte sie.
In diesem Moment klopfte es an der Tür. Da stand Margrethe.
»Jenny würde gern mit dir sprechen«, sagte sie.
Margrethe hatte Ähnlichkeit mit ihrer Schwester: groß, schlank, braune Augen.
»Wie geht es ihr?«
»Sie … sie ist total erschüttert.« Margrethe sprach mit einem leichten amerikanischen Akzent, nachdem sie den größten Teil ihres Lebens in den USA verbracht hatte.
»Kein Wunder«, sagte Kajsa. »Wie viele Sommer kam Gert jetzt schon her?«
»Jedenfalls seit Jahrzehnten.«
»Da war er doch wie einer von hier, was?«
»Ja …«, Margrethe zögerte, »… auch wenn nicht alle den Krieg vergessen haben.«
»Wirklich? Aber Jenny war das egal?«
»Ja, die ist über so etwas erhaben, obwohl ihr Bruder im Krieg umgekommen ist.«
Sie gingen hinaus und folgten dem Weg durch den Garten und über die Wiese zwischen Jennys und Agnes’ Haus. »Lars ist im Jahr vor meiner Geburt gestorben.«
»Das muss für deine Eltern und deine Schwestern doch schwer gewesen sein?«
»Ja. Für meine Mutter besonders, sie ist nie darüber hinweggekommen. Ich glaube, es war auch schwer für sie, ein Kind zu bekommen, nachdem sie gerade eins verloren hatte.«
Margrethe öffnete das Tor, ließ Kajsa vorbei und schloss es hinter ihnen, ehe sie weitersprach: »Sie hat eine Tochter bekommen, die sie sich vielleicht gar nicht gewünscht hatte, und ihren einzigen Sohn verloren.«
»Sich nicht gewünscht?«
»Ja, ich habe mir oft überlegt, warum ich das so empfunden habe«, sagte Margrethe und blieb vor Jennys Haustür stehen. »Als Erwachsene habe ich gedacht, der Schmerz über den Verlust eines Kindes hat dazu geführt, dass die Liebesfähigkeit meiner Mutter … wie soll ich sagen … auf irgendeine Weise beeinträchtigt wurde«, sagte sie und ging ins Haus.
Jenny saß am Küchentisch.
»Ich würde gern mit Kajsa allein sprechen, bitte«, sagte sie zu Margrethe.
Margrethe ging hinaus, und Jenny drehte sich mit ernster Miene zu Kajsa um. Sie zupfte mit den Fingernägeln am Spitzenrand der Tischdecke.
»Ich … das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich würde dich gern um etwas bitten. Um einen Gefallen.«
»Ach«, sagte Kajsa abwartend.
»Ja, du musst wissen, ich habe mir überlegt, dass … na ja … ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Agnes hat immer so gut von dir gesprochen. Und du hast ja mit so vielem Erfahrung, du bist Journalistin, du weißt, was man zu tun hat, und du bist daran gewöhnt, für dich zu behalten, was du weißt. Das können nicht viele. Jedenfalls nicht hier im Dorf.«
Kajsa nickte.
»Es ist so, dass ich … ich möchte, dass jemand weiß, falls …«, Jenny holte tief Luft, »falls mir etwas zustößt.«
»Das darfst du nicht sagen«, sagte Kajsa, erschrocken von dem Ernst in Jennys Stimme. »Dir wird doch nichts zustoßen, wie kommst du denn auf so was?«
»Nein, aber falls doch, dann muss jemand … jemand muss das wissen.«
»Was denn wissen?«
Jenny gab keine Antwort. »Ich habe im Keller einen Safe, da, wo die Gefriertruhe steht. Der Schlüssel hängt in dem alten Schrank oben im Gang zum Dachboden«, sagte sie dann.
»Aber Margrethe kann doch …«, begann Kajsa.
»Ich werde mit Margrethe sprechen«, fiel Jenny ihr ins Wort. »Aber nicht jetzt, das ist es ja gerade, ich bringe es nicht über mich, mit ihr zu sprechen, ich brauche ein bisschen Zeit für mich selbst, jetzt, wo … Gert …« Sie verstummte und schluckte, dann fügte sie mit leiser Stimme hinzu: »Deshalb wollte ich dich bitten, für mich so eine Art Rückversicherung zu sein.«
Sie beugte sich zu Kajsa vor: »Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich gerade dich darum bitte. Das Buch, das du schreibst. Es geht um etwas, das … das dir nutzen kann.«
»Über den Krieg?«
»Ja. Das auch.« Jenny erhob sich. »Du wirst das noch begreifen.«
»Aber was …«
»Und an keinen Menschen ein Wort, auch nicht an die Polizei. Es ist etwas, das Fremde nicht sehen sollen«, unterbrach Jenny sie in einem Tonfall, der nicht zu Widerspruch einlud. Schwerfällig erhob sie sich. Das sah ihr nicht ähnlich, sonst war sie so lebhaft. Sie ging zum Spülbecken, füllte den Kaffeekessel mit Wasser und drehte sich dann wieder zu Kajsa um. »Wie geht es übrigens mit dem Buch?«
Sie stellte den Kessel auf die Kochplatte und wartete darauf, dass das Wasser kochte.
Kajsa erzählte, sie habe beschlossen, sich auf die Rolle der Frauen in der Shetlandfahrt zu begrenzen. Jenny hielt das für eine gute Idee.
»Die Zeit ist jetzt reif«, sagte sie.
Kajsa staunte über diese Bemerkung. »Wieso denn?«
»Ein jeglich Ding hat seine Zeit«, antwortete Jenny. »Eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Schweigen. Eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen.«
»Ich verstehe das nicht ganz«, sagte Kajsa vorsichtig.
»Es gibt so viel Unausgesprochenes, das führt zu nichts Gutem.«
»Nicht?«
Aber Jenny sagte nicht mehr, und Kajsa erzählte, dass sie im Zusammenhang mit ihrem Buch auch mit Borghild sprechen wollte. »Sie hat sicher viel über den Krieg zu erzählen.«
Jennys Gesicht war plötzlich nicht mehr so weich. »Ja«, sagte sie. »Red du nur mit Borghild.«
»Ihr habt nicht besonders viel Kontakt miteinander?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Wegen dieser Lügen …« Sie seufzte.
»Ist es wegen …«, begann Kajsa.
»Ich kann jetzt wirklich nicht über Borghild sprechen.«
Jenny gab Kaffee in die Kanne, dann öffnete sie die Küchentür zum Hofplatz hinter dem Haus und rief Margrethe. Danach setzte sie sich wieder an den Tisch, schob den Vorhang ein wenig zur Seite und schaute aus dem Fenster, aber ihr Blick wirkte in sich gekehrt. Kajsa betrachtete die alte Hand, die auf einem zusammengefalteten Blatt Papier auf dem Tisch lag. Hände, welche die Arbeit gewohnt waren, dachte Kajsa. Die Haut war dünn, fast durchsichtig, mit braunen Pigmentflecken und dunklen Adern. Sie trug am Mittelfinger einen schönen Ring, aber keinen Trauring.
Jenny faltete das Blatt auseinander und reichte es Margrethe, als sie hereinkam.
»Das hat Gert geschrieben«, sagte sie. »Falls ihm etwas zustieße, ehe wir heiraten könnten. Er möchte hier begraben werden.«
»Du musst mit Dieter sprechen, wenn er herkommt«, sagte Margrethe und las, was auf dem Blatt stand.
Kajsa erinnerte sich an Gert Benedicts Sohn, den sie in ihrer Kindheit gekannt hatte.
»Ich weiß nicht, wie man so was in die Wege leitet«, sagte jetzt Jenny. »Er war ja kein norwegischer Staatsbürger und …«
»Das findet sich schon«, fiel Margrethe ihr ins Wort und streichelte ihre Hand. »Dieter und ich werden dir helfen.«
»Ja, das geht sicher gut. Dieter wird es verstehen. Er ist wie sein Vater.«
Ihr Blick wanderte wieder aus dem Fenster. Ein kleines, wehmütiges Lächeln huschte über ihr Gesicht, als denke sie an etwas, das traurig und schön zugleich war.
»Als wir zusammen vom Wasser hochgekommen sind, hast du gesagt, du hast gewusst, dass etwas passieren würde«, sagte Kajsa und sah Jenny fragend an. »Was hast du damit gemeint?«
»Das habe ich gesagt?«
Jennys Stimme klang jetzt nach unterdrücktem Weinen. »Ich kann nicht darüber sprechen. Nicht jetzt. Später.«
»Du bist sicher, dass er ermordet worden ist?«
Kjell Nistad schaute fragend zu seinem jüngeren Kollegen hinüber. Even Runde ging neben dem gelben Boot der Marke Rana am Kai hin und her und betätigte eifrig den Auslöser seiner Kamera. Als er fertig war, zog er eine Papiertüte heraus und schob die Hand des Toten hinein, dann befestigte er die Tüte mit Klebeband.
Nistad ärgerte sich grenzenlos, als er keine Antwort bekam. Der andere müsste ihm mehr Respekt erweisen, Nistad besaß trotz allem fünfzehn Jahre mehr Erfahrung. »Hörst du nicht, dass ich mit dir rede?«, fragte er übellaunig.
»Wir müssen eventuelles DNA-Material sichern«, sagte Even Runde gelassen und zog eine größere Papiertüte hervor, um sie über den Kopf des Opfers zu stülpen.
Even gab den Mitarbeitern des Bestattungsunternehmens, die mit der Bahre am Anleger standen, ein Zeichen, damit sie den Toten holten. Dann trat er neben Nistad. »Ich glaube nicht, dass er hier gestorben ist«, sagte er.
»Ach, nein? Es sieht doch so aus, als ob er vom Anleger ins Boot gefallen ist und sich den Kopf eingeschlagen hat.«
»Tja, wir werden wohl das Boot untersuchen müssen und hören, was die Pathologie sagt.«
Even ging und kam zurück mit einer großen Plane und einem Seil. Sie hoben das Boot auf einen Lastwagen, und dann wurde es zu weiteren Untersuchungen ins Gewerbegebiet gefahren.
Eine Stunde später saßen Even Runde und Kjell Nistad im Büro von Lensmann Ole-Jakob Eggesbø.
»Warum meinst du, dass Benedict nicht im Boot gestorben ist?«, fragte Eggesbø und sah Even fragend an.
Even beugte sich vor und legte einige Bilder auf den Tisch. »Der Mann, der ihn gefunden hat …«, begann er, aber nun schaltete sich Nistad ein.
»Der heißt Nils Vinjevoll.«
»Ja, also … Vinjevoll sagt, dass er den Toten nicht angefasst hat, er habe nur nach dem Puls gefühlt und festgestellt, dass Benedict ganz kalt war«, sagte Even. »Seht mal.« Er zeigte auf die Bilder. »Er liegt genau so da, wie er gefunden wurde, auf dem Rücken, teilweise unter der einen Ruderbank und mit Blut in den Haaren und im Gesicht und am Hals. Viel Blut. Nehmen wir an, er sei gefallen, zum Beispiel von dem Steg, wo das Boot meistens liegt. Dann stimmt hier etwas nicht.«
Eggesbø musterte die Bilder sorgfältig. »Schon seltsam, dass er unter der Ruderbank liegt, wenn er ins Boot gefallen ist. Aber er kann natürlich noch gelebt und sich bewegt haben, er muss ja nicht gleich tot gewesen sein.«
Er hob ein anderes Foto hoch. »Aber wo hat er sich den Kopf angestoßen?«
»Genau«, wiederholte Nistad. »Wo hat er sich den Kopf angestoßen?«
Er sah, dass Even ein wenig lächelte, redete aber unbeirrt weiter. »Wie du siehst, hat er hier eine Wunde, an der Schläfe.« Er zeigte darauf. »Er muss doch mit dem Kopf auf etwas geprallt sein, wenn er gefallen ist. Allerdings gibt es davon keine Spur.«
»Was meinst du?«
Eggesbøs Blick wanderte von Nistad zu Even.
»Doch … das ist schon richtig. Aber was mich zum Stutzen gebracht hat, waren vor allem die Blutspuren.«
Even zeigte auf das Blut unten im Boot. »Das Blut kann bedeuten, dass er noch lebte, dass sein Herz noch schlug.«
»Ach?«
»Und wenn er noch am Leben war, als er gefallen ist, dann kann er sich selbst in diese Position gebracht haben, wie du gesagt hast.«
»Aber?«
»Dann müsste es im Boot mehr Blut geben, und wenn er bei Bewusstsein war, hätte er sich vermutlich an den Kopf gefasst, und das Blut an seinen Händen hätte Abdrücke hinterlassen.«
»Überzeugend!«, sagte Eggesbø. »Und was glaubst du nun?«
Even zeigte auf einige Blutstropfen an der einen Seite des Bootes. »Die sehen aus, als ob sie von der Leiche getropft seien.«
»Und was bedeutet das?«, fragte Nistad ungeduldig.
»Dass er anderswo verletzt und dann ins Boot gelegt worden ist.«
3. Oktober 1941
Jenny saß mit ihrer Mutter und Borghild in der Küche, aber die Wohnzimmertür war angelehnt, und sie konnten hören, was dort drinnen gesagt wurde. Der deutsche Leutnant war zu Besuch gekommen. Er wollte mit dem Vater vereinbaren, dass der Monshof die Deutschen mit Eiern versorgte. Der Vater weigerte sich, aber die Deutschen ließen keinen Widerspruch gelten.
Der Leutnant, er hieß Zielke und sprach gut Norwegisch, sagte, einer seiner Soldaten werde jeden Montag und Freitag Eier holen.
Dann stand er plötzlich in der Küchentür und bat um ein Glas Wasser.
Die Mutter sah ihn nicht an, stand nicht auf, machte nur eine Kopfbewegung in Jennys Richtung, und Jenny sprang auf und füllte ein Glas. Als sie es ihm reichte – wobei sie ihn ganz bewusst nicht ansah –, begegnete sie dem Blick des jungen Soldaten, der den Leutnant begleitete. Ein zaghaftes Lächeln huschte über dessen Gesicht. Jenny schlug die Augen nieder und wartete, während der Leutnant trank.
»Danke«, sagte er und reichte ihr das leere Glas. Dann schlug er die Hacken zusammen und sagte: »Heil og Sæl«, den norwegischen Nazigruß, und ließ den Hitlergruß folgen. Doch in der Tür blieb er plötzlich stehen und drehte sich um. »Gerhart wird die Eier holen, er nimmt die ersten gleich mit.«
»Jenny, dann geh du sie holen«, sagte der Vater und setzte sich an den Küchentisch.
Jenny spürte, wie ihr Herz loshämmerte, als sie, dicht gefolgt von dem Soldaten, zum Hühnerstall ging.
Der Soldat wollte reden, er fragte nach ihrem Namen, nach ihrem Alter, aber sie antwortete nur kurz, sah ihn nicht an. Er steckte sich eine Zigarette an, blieb in der Tür stehen und sah ihr zu, während sie Eier in einen Korb legte. Sie versuchte, nicht an das Radio zu denken, das in einem Kasten unter dem Fenster versteckt war, und hoffte, dass der Soldat ihr Erröten nicht bemerkte.
»Viel Dank«, sagte er auf Norwegisch, als sie ihm den Korb reichte.
Das war komisch, wie er redete. »Viel Dank.«
Als er die Eier nahm, schien er noch mehr sagen zu wollen, aber dann drehte er sich um und ging hinaus.
Er tat ihr fast leid. Die Gestalt, die langsam durch das Tor ging, lief gebeugt und hatte etwas Resigniertes.
Eine kleine Glocke bimmelte fröhlich los, als Kajsa am Montagmorgen die Tür zum Laden öffnete. Es war ein Geräusch aus einer vergangenen Zeit. Sie konnte fast nicht glauben, dass die Glocke noch immer dort hing.
»Hallo, Kajsa!«, rief Else von der Kasse her. Sie gab gerade die Waren einer großen, kräftigen Frau ein, die Kajsa unbekannt war.
Kajsa war am Freitag im Laden gewesen, aber Else eben nicht. Kajsa freute sich auf das Wiedersehen mit ihrer besten Freundin aus den Kindertagen in Losvika. Kajsa wusste, dass Else nach dem Tod ihres Vaters den Laden übernommen hatte. Der gehörte jetzt zu Spar, aber obwohl sich die Einrichtung geändert hatte, stand vieles noch am selben Platz wie früher.
Kajsa war oft nach der Schule mit Else hier gewesen. Sie hatten geholfen, die Waren in die Regale zu stellen, und hatten Trauben essen dürfen, die nicht mehr verkauft werden konnten.
Die große Frau bezahlte, und Else kam hinter der Kasse hervor und umarmte Kajsa. Sie waren einander viele Jahre nicht mehr begegnet, und Kajsa stellte fest, dass sich Else mehr verändert hatte als der Laden. Wenn sie ihr unerwartet begegnet wäre, hätte sie sie wohl kaum wiedererkannt. Die wilden blonden Locken waren verschwunden, die Haare zu einer kurzen, maskulinen Frisur geschnitten. In Kajsas Erinnerung hatte Else gern Kleider getragen, jetzt trug sie eine weite beige Pilotenhose mit großen aufgenähten Taschen und einen braunen Strickpullover. Aber Lächeln und Körpersprache waren so wie in ihrer Erinnerung: energisch, herzlich.
»Ich muss dir Ulrike vorstellen«, sagte sie und zog Kajsa zu der Kundin hinüber. »Ulrike wohnt auf dem Campingplatz. Sie kommt aus Österreich.«
Else stellte die beiden einander vor. Kajsa gab Ulrike die Hand und fragte, wie es ihr hier gefalle.
Die andere lächelte und nickte. »I love it!«, antwortete sie enthusiastisch. »Aber was da geschehen ist, ist ja entsetzlich«, fügte sie hinzu.
Sie redeten noch eine Weile über Gert Benedict. Ulrike Müller wusste, wer er war, sie war ihm kurz begegnet.
»Du hast doch noch Zeit für eine Tasse Kaffee?«, fragte Else, als Ulrike gegangen war.
Kajsa lächelte: »Gern.«