

Buch
Als Jack Angelas Hilferuf bekommt, weiß er, dass etwas absolut schiefgegangen sein muss. Warum sonst sollte sich seine ehemalige Mentorin nach etlichen Jahren wieder bei ihm melden? Der Überfall auf ein Schmugglerschiff, den Angela organisiert hat, ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Eigentlich wollte sie wertvolle Edelsteine erbeuten, aber daraus wurde nichts. Nicht nur steht sie jetzt ohne Beute da, auch ihr Team existiert nicht mehr. Zwei ihrer Leute wurden bei der Aktion getötet, nur einer hat überlebt. Und der ist auf der Flucht. An Bord wartete nämlich ein weitaus größerer Schatz als erwartet auf das Überfallkommando. Einer von ihnen konnte nicht widerstehen und verwarf den detailliert geplanten Coup kurzerhand, um dann seinen eigenen Plan zu verfolgen: Zuerst beseitigte er alle Zeugen und floh dann mit dem Diebesgut. Weit kam er allerdings nicht. Angela bekommt kurz darauf seinen fein abgetrennten Kopf serviert, zusammen mit der unmissverständlichen Nachricht, das Gestohlene innerhalb von 24 Stunden wieder zurückzugeben. Jack weiß, dass er Angela noch einiges schuldig ist, deshalb zögert er auch keine Sekunde und eilt nach Macau, wo Angela bereits in tödlicher Gefahr schwebt …
Weitere Informationen zu Roger Hobbs sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Roger Hobbs
KILLING
GAMES
Thriller
Ins Deutsche übertragen
von Rainer Schmidt
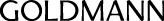
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»Vanishing Games« bei Alfred A. Knopf, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage April 2016
Copyright © 2015 by Roger Hobbs
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: arcangel/Johnny JetstreamImages
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-17441-5
V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz





Für Nat und Gary
PROLOG
Südchinesisches Meer
Ein paar Stunden, bevor der Morgen zu seinem letzten Auftrag anbrach, legte Sabo Park sich bäuchlings neben das Gewehr in den Bug seines Fischerbootes, schob sich in eine bequeme Schussposition und nahm die Kappe vom Objektiv seines Nachtsicht-Zielfernrohrs. Er kontrollierte kurz die Visiervorrichtung, zog dann ein Paar weiße Ohrhörer hervor, setzte sie ein und drückte auf den PLAY-Button an seinem iPod. Das einzige Stück auf der Playlist war Nina Simones Sinnerman, und es dauerte zehn Minuten und zwanzig Sekunden.
Wenn es zu Ende wäre, würde Sabo so viele Leute umbringen, wie er konnte.
Es ging um Folgendes: Im Südchinesischen Meer trieben sich mehr Schmuggler herum als irgendwo sonst in der Welt. Es verbindet Häfen in China, den Philippinen, Malaysia, Taiwan und Vietnam miteinander. Durch diese kleine Pfütze läuft mehr Ladung als anderswo in der Region. Das meiste ist natürlich legal, aber nicht alles. Jedes illegale Produkt, das den Verkauf lohnt, kommt hier durch. Menschenhändler in Kambodscha stopfen alte Frachtcontainer mit Kindern voll, stellen zwei Kanister Kaloriendrinks und einen Fäkalieneimer hinein und verschiffen sie en gros nach China, um sie dort als Sklaven zu verkaufen. In Vietnam schicken die Kartelle ganze Flotten los, bis oben hin beladen mit Dope aus dem Goldenen Dreieck. Jeden Tag verlassen Schnellboote mit gefälschten Luxusgütern den Hafen von Hongkong, und Fischereischiffe bringen illegal gejagtes Walfleisch nach Norden zu den hungrigen Japanern. Russland liefert Waffen, aus Thailand kommt Meth, aus Korea Falschgeld und aus Shanghai schwarz gebrannter Alkohol. Das Südchinesische Meer ist, wie man es auch sehen mag, das Epizentrum des illegalen Schiffsverkehrs dieser Welt.
Und wo es illegalen Schiffsverkehr gibt, da gibt es auch Piraten.
Wer an Piraten denkt, hat normalerweise nicht einen Mann wie Sabo Park vor Augen. Moderne Piraten sind somalische Kids mit Kalaschnikows, zugedröhnt mit Khat, und keine dürren Koreaner mit einem Hang zur Seekrankheit. Sabo sah eher aus wie ein Fashion Model, nicht wie ein abgehärteter Verbrecher. Er war fast zwei Meter groß und trug eine Windjacke von Hugo Boss, ein blaues Eton-Hemd mit Nadelstreifen, eine enge Jeans und ein Paar Zwölfhundert-Dollar-Designerstiefel, die noch niemals Schlamm gesehen hatten. Er hatte eine Rolex Daytona und einen iPod mit vierzehnkarätiger Goldauflage. Nur die Skimaske aus dicker Baumwolle und die Latexhandschuhe verrieten, was er wirklich war.
Sabo Park war ein bewaffneter Räuber.
Aber heute Nacht würde er nicht irgendetwas X-Beliebiges stehlen. Er hatte es auf etwas abgesehen, das klein genug war, um in seine hohle Hand zu passen, und wertvoll genug, um einen ganzen Container mit Heroin aus dem Goldenen Dreieck zu kaufen. Im Laufe der Jahre hatten Tausende Männer wie er um ein solches Objekt gekämpft und waren dafür gestorben. Was Sabo stehlen wollte, war dem Gewicht nach eine der wertvollsten Substanzen der Welt.
Heute Nacht würde Sabo einen blauen Saphir stehlen.
Man muss wissen, dass mehr als die Hälfte aller blauen Saphire auf der Welt zu irgendeinem Zeitpunkt geschmuggelt werden, denn die besten kommen aus einem kleinen Land namens Burma. Genauer gesagt, aus der Stadt Mogok in der Region Mandalay. Das Problem ist, Burma gibt es nicht mehr. Das Land nennt sich jetzt Myanmar, und ein paar Jahrzehnte lang wurde es von einer Militärjunta regiert, die es in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Noch immer schickten die Bosse des Landes Leute in die Gruben, um Saphire zu fördern, aber jeder Stein, den sie herausholten, sollte auf direktem Weg an einen staatlich anerkannten Edelsteinhändler geliefert werden, der den Verkaufspreis um ein paar tausend Prozent heraufsetzte und den Gewinn an das Regime weiterreichte. Für manche Leute war diese Preiserhöhung inakzeptabel. Auch heute, da Myanmar sich mit winzigen Schritten auf eine demokratische Verfassung zubewegt, gibt es diese Preiserhöhung noch. Und so gibt es auch die Schmuggler. Eine Menge Schmuggler sogar. Und schlimmer noch, die unabhängigen Drogenarmeen, die den Norden beherrschen, steigen jetzt auch in dieses Geschäft ein, um neben den Profiten aus dem Rauschgifthandel weitere Finanzmittel für ihren endlosen Bürgerkrieg einzunehmen. Steine im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar verlassen jedes Jahr illegal das Land, Jahr für Jahr, regelmäßig wie ein Uhrwerk.
Es gibt zwei große Schmuggelrouten – die billige und die gute. Erstere ist für minderwertige Steine, und sie ist länger. Als Erstes muss ein Minenarbeiter den Stein vor der Nase seines militärischen Aufsehers hinausbringen. Das kann schon ziemlich schwierig sein. Die Arbeiter sind oft Kinder, manchmal gerade sieben Jahre alt. Achtzehn Stunden am Tag, in sengender Hitze oder eisiger Kälte, durchsieben sie Kies und Cholerawasser mit bloßen Händen nach den winzigen farbigen Steinen, von denen jeder einzelne mehr wert ist als ihr ganzes Dorf. Wenn sie einen finden, müssen sie ihn verstecken, denn sonst wird er ihnen weggenommen. Man sollte annehmen, es gibt viele Möglichkeiten, einen Stein zu verstecken, aber die Aufseher kennen sie fast alle. Es gibt nur eine Methode, die wirklich funktioniert. Bevor jemand etwas bemerkt, muss der Minenarbeiter den schlammigen Steinbrocken in den Mund stecken und das Mistding in einem Stück verschlucken. Keine einfache Sache. Ein Saphir hat einen Härtegrad von 9 auf der Mohs-Skala, und damit ist er kaum weicher als ein Diamant. Wenn der Stein eine scharfe Kante von nur einem Millimeter hat, kann es genauso gefährlich sein wie das Verschlucken einer Rasierklinge. Und das Kind kann ihn nicht einfach später wieder ausspucken. Nein. Dieser Stein muss überall durch. Speiseröhre, Magen, Eingeweide, Dickdarm. Und wenn er schließlich wieder zum Vorschein kommt, muss der Minenarbeiter ihn aus seinem blutigen Kot wühlen, abwaschen und zum Markt bringen.
Dort prüft ein dicker Chinese mit einer Juwelierslupe den Stein und gibt dem Kind ein bisschen Geld. Viel wird es nicht sein, denn der kleine Minenarbeiter ist im Grunde ein Sklave, aber auch ein bisschen Geld kann in den Minen eine große Hilfe sein. Wenn der chinesische Zwischenhändler eine gewisse Anzahl Steine zusammenhat, übergibt er sie an einen thailändischen Drogenhändler im Austausch gegen Heroin. In Myanmar ist Heroin besser als Bargeld. Der Heroinhändler packt die Steine in sein Auto und fährt nach Mae Sai, einer Kleinstadt an der Grenze zu Thailand und Laos. Dort tauscht er die Saphire bei einem Grenzschmuggler gegen eine größere Menge Heroin, und der bringt die Steine, in Reissäcken versteckt, auf einem großen Transportlaster hinüber nach Thailand. Ein Kinderspiel. In Thailand werden die Saphire an seriöse Juwelenhändler verkauft. Der Verkäufer erklärt, sie stammten aus heimischen Minen in Thailand oder Laos, und da sie von minderer Qualität sind, ist diese Lüge plausibel. Die Händler mischen die geschmuggelten mit legalen Steinen und verkaufen sie en gros an Einzelhändler auf der ganzen Welt. Alles Weitere liegt auf der Hand. Zurück auf Los, ein neues Spiel beginnt.
Aber diese Route ist kaum bedeutend. Geld ist hier nicht zu verdienen. Die echten Player interessieren sich nicht für kleine Einkaräter mit milchigem Kern und ohne Farbe. Richtiges Geld bringt der Schmuggel der großen Saphire von Weltklasse – zehn Karat oder mehr, fehlerfrei, klar und von leuchtender Farbe und perfektem Ton. Der Anfang ist der gleiche: Minenarbeiter, Chinese, Heroin. Aber dann kommen die großen Schmugglerringe ins Spiel. Statt in ein Grenzstädtchen wie Mae Sai oder Mae Hong Son zu fahren, kaufen sie die Steine für ein bisschen Kleingeld in Mandalay, verstecken sie im Benzintank oder anderswo in ihrem Fahrzeug und fahren ein paar hundert Kilometer weit in die Hafenstadt Rangun. Zum Teufel – wenn die Ladung umfangreich genug ist, bemühen sie sich gar nicht mehr um Unauffälligkeit. Sie laden die Saphire auf einen gepanzerten, mit einer bewaffneten Einheit gesicherten Konvoi und schießen auf alles, was sich ihnen in den Weg stellt. In Rangun werden die Steine auf einen kleinen Fischkutter oder ein anderes unauffälliges Boot verladen und in internationale Gewässer gebracht. Das ist natürlich der gefährlichste Teil. Die Schmuggler müssen nicht nur an der burmesischen Küstenwache vorbei, die nicht leicht zu bestechen ist, sondern sie müssen auch noch mehr als tausend Kilometer weit um die Spitze von Malaysia herum und durch die piratenverseuchten Gewässer vor Thailand und Vietnam bis in das monsungeplagte Südchinesische Meer fahren. Erst dann erreichen sie Hongkong – die Stadt, in der man alles kaufen kann. Es ist eine gefährliche Reise, aber wenn das Schiff wohlbehalten ankommt, bringt schon eine kleine Handvoll dieser Steine auf dem internationalen Juwelenmarkt ein stattliches Vermögen ein. Wenn man ein Faible für Edelsteine hat, ist das der richtige Ort.
In Hongkong gibt es mehr Juwelengeschäfte pro Quadratmeile als an irgendeinem anderen Ort auf der Welt. New York und Antwerpen sind mickrig dagegen. Kowloon ist das Schlaraffenland der polierten Steine. Die Profite, die hier erzielt werden, sind obszön, und nach oben gibt es keine Grenze. Allen voran für Saphire, so blau wie der Pazifik und so klar wie Glas. Die Händler führen ungeschliffene Rubine, so groß wie ein Hoden und so strahlend wie ein Stern am Abendhimmel. Wer will, kann hier eine diamantenbesetzte Uhr oder ein platinbeschichtetes Handy kaufen. Bei Edelsteinen sind vier Eigenschaften wichtig: der Schliff, das Gewicht in Karat, die Farbe und die Reinheit. Bei einem fünfminütigen Spaziergang auf der Canton Road in Hongkong findet man diese Eigenschaften in allen denkbaren Kombinationen in den Schaufensterauslagen. Ein erfolgreicher Schmuggeltrip kann eine Investition von zwanzigtausend Dollar in einen Millionen-Dollar-Gewinn verwandeln. Ein einzelner Saphir bringt bis zu fünfzehntausend Dollar pro Karat ein, und ein Stein kann fünfzig Karat wiegen. Rechnen Sie selbst. Das ist ein Riesenbatzen Geld.
Und Sabo Park interessierte sich nur fürs große Geld.
Er suchte den Horizont durch sein Zielfernrohr ab, das die ruhige See hellgrün leuchten ließ. In weniger als zehn Minuten würde eine mit Saphiren beladene Schmugglerjacht in Sicht kommen, und er würde da sein, um sie zu kapern. Noch war das Boot nicht in Sicht, aber Sabo wusste, wo es war. Seine Lichter leuchteten über den Horizont wie die eines Autos, das im Nebel über eine Anhöhe herankam. Sabo klopfte am Abzugbügel mit dem Finger den Takt zu seiner Musik.
Noch acht Minuten.
Sabo hob die Hand und gab seiner Crew ein Zeichen. Kein Pirat hatte jemals allein gearbeitet, und er war keine Ausnahme. Für einen Job wie diesen brauchte man zwei Leute und einen Dritten, der nicht mit an Bord war. Diese Person war der Jugmarker – derjenige, der alles plante. In diesem Fall war es eine Frau. Sie hatte die gesamte Recherche übernommen und ihnen gesagt, wann sie wo sein sollten. Ein Jugmarker erledigt den Job selten persönlich. In diesem Fall saß die Frau dreihundert Kilometer weit entfernt mit ihrem Satellitentelefon in ihrer Limousine und wartete. Sie würde den doppelten Anteil erhalten.
Der Mann hinter der Plexiglasscheibe auf der Brücke war Captain. Mangels einer besseren Bezeichnung war er bei diesem Job der Wheelman. Seine Aufgabe war es, ihre Flucht zu planen. Captain war sein einziger Name. Alle nannten ihn so. Er war ein stämmiger, älterer Gentleman und stammte aus Ost-Russland. Sein Gesicht war runzlig wie eine Dörrpflaume. Sabo hatte während der ganzen Bootsfahrt ein flaues Gefühl im Magen, aber Captain hatte Salzwasser in den Adern. Er war einer der besten illegal operierenden Seeleute der Welt. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte er in den achtziger Jahren Flüchtlinge von Shanghai nach Jindo transportiert, aber als diese Route ausgetrocknet war, hatte er sich auf den malaysischen Heroinschmuggel verlegt. Von Bangkok nach Singapur in achtzehn Stunden – die härteste Schmuggelroute in Asien. Zehn Jahre lang hatte er Schnellboote mit dem Stoff gefahren, bis er nach einer Verhaftung auf höherer Ebene plötzlich ohne einen Penny dagestanden hatte. Er war ein geduldiger, freundlicher Mann. Ein Leben in der Kriminalität entsprach nicht seinem Naturell. Niemals ließ er jemanden im Stich, selbst wenn er deshalb eine Fracht verpasste. Er betrachtete sich als Opfer der Armut und der Umstände, und wahrscheinlich hatte er damit recht. Es gibt keine alten Piraten, nur alte Männer.
Unten im Laderaum wartete der Pointman, der das eigentliche Kapern übernehmen würde. Sie nannten ihn Jim Holmes, und er war ein Kiwi, dem die Rückkehr in seine Heimat Neuseeland versperrt war, weil ihn dort eine Haftstrafe von fünfundzwanzig Jahren wegen Bankraubs erwartete. Er hatte eine Hautfarbe wie ein Wattebausch und die Nerven eines kleinen Nagetiers, und er zitterte buchstäblich vor lauter Angst, aber um fair zu sein, muss man sagen, er hatte auch allen Grund dazu. Seine Aufgabe war die einfachste und zugleich die gefährlichste. Wenn Sabo mit dem Schießen fertig wäre, würde Holmes auf die Schmugglerjacht springen, während sie noch Fahrt machte, sie durchsuchen und das Versteck der Saphire ausfindig machen. Doch wer konnte schon wissen, was sich sonst noch an Bord verbarg. Ein raffiniert versteckter Schmuggler mit einer Knarre oder eine einzige mit einer Sprengfalle versehene Luke – und schon war er mausetot. Er zitterte in den Gummistiefeln und hielt die Augen fest geschlossen, und er hielt die 12er Schrotflinte umklammert, als könnte sie ihm aus den Händen rutschen.
Und dann war da noch Sabo Park. Schlank, dunkeläugig, ein Gesicht, das nicht lächelte. Sein langes schwarzes Haar reichte bis auf die Schultern und verdeckte teilweise das Tattoo eines britischen Pfund-Zeichens an seinem Nacken. Zwei lange, tiefe Narben zogen sich über seine Wangenknochen und erweckten den Eindruck einer beständigen Grimasse. Er zeigte keine Angst, nicht weil er besonders abgehärtet oder stark war, sondern weil er diese Regung noch nie im Leben empfunden hatte. Sein Herzschlag war gleichmäßig wie das Ticken einer Schweizer Uhr, und sein Kopf wippte im Takt der Musik.
Sabo war ein Buttonman.
Ein professioneller Killer.
Und das war die ganze Crew. Nur drei Mann. Es klingt überraschend, aber drei Piraten konnten fast jedes Schiff auf See in ihre Gewalt bringen. Selbst ein Tanker von der Größe des Empire State Buildings hat nur zehn bis fünfzehn Mann Besatzung an Bord. Moderne Schiffe brauchen heute keine große Crew mehr. Sie fahren automatisch.
Captain hob die Hand zum Zeichen dafür, dass er Sabos Signal gesehen hatte. Er hatte die Jacht, die auf sie zufuhr, zuvor auf dem Radar beobachtet, aber das tat er jetzt nicht mehr. Er duckte sich unter das Steuerpanel des Fischkutters und legte den Schalter um, und die wenigen Lichter an Bord erloschen. Die Instrumente wurden dunkel. Das Boot war so schwarz wie das Meer darunter. Die Nacht war mondlos. Captain stelzte durch die Dunkelheit und verband nur mithilfe seines Tastsinns eine Autobatterie mit einem weißen, runden elektronischen Gerät auf dem Dach der Kabine – einem Festfrequenz-Störsender für den Fall, dass der Kapitän des Ziels klug genug war, um seine Instrumente im Auge zu behalten. Jetzt war der Fischkutter vollständig unsichtbar, wie ein Loch im Ozean. Bei diesem Nebel würde niemand ihn kommen sehen.
Noch fünf Minuten.
Sabo zog den Verschlusshebel seines Gewehrs zurück und lud es durch. Es war ein H-S Precision 2000, eine zivile Version der von israelischen Scharfschützen bevorzugten Waffe. Mechanisch gesehen war es kaum mehr als ein altmodisches Allzweckgewehr. Kammerverschluss, .308 Winchester, 24-Zoll-Lauf. Seine Version war mattschwarz und hatte etwas mehr als siebentausend Dollar gekostet, einschließlich des Nachtsicht-Zielfernrohrs aus einem amerikanischen Waffengeschäft. Es war mit einem Trio von Vierer-Magazinen ausgestattet; eins saß im Verschlussgehäuse, und zwei weitere waren am Vorderschaft befestigt, wo er sie in Sekundenschnelle erreichen konnte. Er legte die Wange an den Schaft, schloss ein Auge und fing an, auf seinen Herzschlag zu lauschen. Für Sabo gab es nur zwei Dinge auf der Welt, die ihm Freude machten: das Töten und die Musik von Nina Simone. Für ihn war dies ein Augenblick voller Seligkeit.
Er wartete.
Monatelange Arbeit war nötig gewesen, um diesen Augenblick möglich zu machen. Auf der Suche nach der perfekten Abfangposition hatte die Frau, die den Raub geplant hatte – die Jugmarkerin –, über Dutzenden von nautischen Karten und Navigationshandbüchern gebrütet. Sie hatte die Route der Jacht über das Meer wieder und wieder mit dem Winkelmesser nachvollzogen und Computermodelle konsultiert, um sicherzugehen. Das Südchinesische Meer erstreckt sich über dreieinhalb Millionen Quadratkilometer. Hier in einer speziellen Nacht ein spezielles Schiff zu finden, das war etwa so, als wollte man mit verbundenen Augen das Bullseye eines Dartboards treffen, das zwei Häuserblocks entfernt hängt. Erst nach monatelanger Recherchearbeit war der Treffpunkt identifiziert, Längen- und Breitengrad waren präzise angegeben.
Noch drei Minuten.
Dann kam die Jacht über den Horizont, nicht auf einmal, sondern Stück für Stück, wie die aufgehende Wintersonne. Zuerst die Funkantennen, dann das Mastlicht, die grünen und roten Seitenlichter, das Deck und schließlich die reflektierenden Markierungen am Rumpf. Alle vier Lichter schienen in der Ferne zu flimmern – in der viereckigen Anordnung, die der Captain das Karo des Todes nannte. Bald schnitt sich das ganze Boot durch den Nebel über dem Horizont wie ein Miniaturmodell.
Es kam geradewegs auf sie zu.
Sabos Erregung wuchs. Jeder Augenblick, der verging, dauerte eine Ewigkeit. Als Kind hatte er nicht gewusst, wie er seinen Blutdurst im Zaum halten sollte. In Augenblicken wie diesen hatte er vor freudiger Erwartung gezappelt, bis er explodierte und seine Wut gegen jeden entfesselte, der das Pech hatte, in der Nähe zu sein. Inzwischen konnte er sich besser beherrschen, aber er spürte immer noch, wie es in ihm hochkochte. Zorn, Lust und Wut krochen an seiner Wirbelsäule herauf in seinen Nacken, und seine Haare sträubten sich. Er wusste, je länger er auf die Entladung wartete, desto besser würde sie werden. Es war einen Monat her, dass er einen Mann verletzt hatte, und seit sechs Monaten hatte er keinen mehr umgebracht. In seinem Kopf überschlugen sich die Berechnungen: Wind, Distanz, Knoten, Mündungsgeschwindigkeit. Bis zum Horizont waren es drei Meilen. Die Jacht bewegte sich mit fünfzehn Knoten auf sie zu. Die Geschwindigkeit der Kugel würde neunzehnhundert Meilen pro Stunde betragen. Natürlich brauchte Sabo solche Kalkulationen nicht anzustellen, denn er würde erst schießen, wenn das Ziel dicht vor ihnen wäre, aber pro forma tat er es trotzdem. Reine Gewohnheit. Hier ging es um sein ganz persönliches Vergnügen. Er wollte, dass der große Augenblick perfekt wurde. Nicht mehr lange jetzt. Sein Finger schob sich um den Abzug.
Noch eine Minute.
Die Jacht war jetzt so nah, dass Sabo an Bord zwei Mann erkennen konnte. Der im Bug war jung. Er saß auf einem Campingstuhl und trug ein Fernglas um den Hals. In der Mitte des Decks stand ein zweiter, älterer Mann und rauchte eine Zigarette.
Sabo entschied sich willkürlich für den Raucher, einen großen Asiaten, dürr bis auf die Knochen und kahl wie ein Baby. Er betrachtete ihn durch das Zielfernrohr. Tattoos zogen sich an seinem Hals hinunter und wuchsen an den Unterarmen aus den Ärmeln. Er stand an Steuerbord, rauchte seine Zigarette und spähte in den Nebel. An einem Schulterriemen hing eine Maschinenpistole, anscheinend eine ältere Ausgabe der MP5, aber aus dieser Perspektive konnte Sabo es nicht genau erkennen. Sie hatte einen Klappschaft und zwei Magazine, die im Dschungelstil mit Klebstreifen zusammengehalten wurden. Die Waffe würde ihm nicht viel helfen. Um den Verschluss herum waren lauter Schrammen; sie war offensichtlich jahrelang unsachgemäß behandelt worden.
Das zweite Ziel, der Junge auf dem Campingstuhl, war viel interessanter. Er konnte höchstens zwanzig Jahre alt sein. Das Fernglas, das er um den Hals trug, verriet, dass er der Ausguck war. Sabo musterte ihn kurz. Er sah nicht besonders eindrucksvoll aus, aber er hatte ein nettes Gewehr auf dem Schoß. Irgendeine Version des AR-15 – Sabo konnte nicht erkennen, welche. Aber angesichts des Jobs, den der Junge hatte, war es wahrscheinlich eine ostasiatische Kopie einer CQ oder einer Trailblazer. Auf jeden Fall eine sehr ordentliche Waffe. Zu schade, dass er nie die Chance haben würde, sie zu benutzen.
Die optische Vergrößerung gab Sabo das Gefühl, Blickkontakt mit ihm zu haben. Die Ziele sahen anders aus als die Burmesen, die Sabo bisher gesehen hatte. Ihre Gesichter waren flach und hellhäutig, was im heißen sonnigen Burma ungewöhnlich war. Aber das interessierte Sabo nicht. Er zielte auf den Älteren mit der Zigarette. Der rote Punkt wanderte wie von selbst nach oben und blieb in der Mitte des Kopfes stehen, dicht unter der Nasenwurzel. Der Sweet Spot. Ein guter Buttonman zielt nicht auf die Stirn, sondern in die Mitte des Gesichts. Wenn die Kugel durch die Zähne oder die Nase fährt, reißt sie die untere Gehirnhälfte mit. Der obere Teil enthält vielleicht alle Gefühle und Erinnerungen, aber im unteren sind sämtliche Leitungen. Die Medulla oblongata und das Mittelhirn, wo Herzschlag und Motorik gesteuert werden. Ein Schuss in den Hirnstamm schaltet einen Menschen aus wie ein Lichtschalter. Er ist so schnell tot, dass er es gar nicht mitbekommt.
Sabo hielt seinen Körper ruhig und im Gleichgewicht, um das leise Auf und Ab des Kutters auszugleichen, der unter ihm dümpelte. Mit angehaltenem Atem lauschte er den letzten Akkorden seiner Musik und wartete auf den richtigen Augenblick.
Drei Sekunden.
Zwei Sekunden.
Eine.
Und plötzlich lief die Zeit für Sabo im Kriechtempo. Er sah alles so, als wäre die Kugel sein Auge. Als der Abzug den Druckpunkt überwand, schnellte der Schlagbolzen nach vorn und traf das Herz der massiven .308-Messingpatrone. Der Zünder funkte, und Schießpulver und heiße Gase trieben die Kugel durch den Lauf und ließen sie mit einem Überschallknall aus der Mündung fliegen. Sie taumelte und rotierte im sanften Meereswind und schwenkte nach rechts und abwärts, als sie dem Ziel nah war. Aber damit hatte Sabo gerechnet – die Schwerkraft führte die Kugel ins Ziel. Sie traf dicht unter dem linken Auge, durchschlug den Kopf seitwärts und trat hinter dem rechten Ohr wieder aus. Der Kopf krachte auseinander. Große Schädelstücke flogen in alle Himmelsrichtungen. Die Austrittswunde versprühte einen dichten rosaroten Nebel. Und schließlich, wie ein verspäteter Einfall, erreichte der Knall des Schusses Sabos Ohren.
Peng.
Sabo zog den Verschlusshebel zurück und wandte sich dem zweiten Ziel im Bug des Bootes zu. Der Junge hatte nicht einmal mehr Zeit, die Waffe zu heben. Es war zu spät. Sabo zielte und schoss ihm das Gehirn weg, bevor er aufspringen konnte. Der Junge kippte nach hinten und rutschte halb von seinem Stuhl.
Die Schüsse hatten den Rest der Crew alarmiert. Sabo sah, wie die Maschine der Jacht einen Schwall Wasser ausspuckte und dann stotternd verstummte. Ein paar Sekunden später stürmte ein Mann in einem schlichten grauen Overall und einer Wollmütze aus der Kajüte. Er hielt eine Pistole schussbereit in der erhobenen Hand. Sabo sparte sich die Mühe eines dritten Kopfschusses. Er zielte, drückte ab und ließ die Kugel mitten durch das Brustbein fahren. Der Mann kippte vornüber, und seine Pistole rutschte über das Deck ins Meer. Ein kurzer Augenblick nur.
Sabo stand kurz vor einem Orgasmus. Das lustvolle Gefühl, das durch seine Adern strömte, war besser als alles andere auf der Welt. Sex und Drogen, Geld und Musik – das alles verblasste neben dem Glücksgefühl beim Töten. Er seufzte leise erschauernd und konnte sich kaum noch beherrschen. Er zog den Hebel zurück, warf die leere Patronenhülse aus und ließ die vierte Patrone in die Kammer springen.
Und wartete.
Seine Fantasie lief Amok. Er sah die übrigen Schmuggler in der Kabine vor sich, wie sie von den Schüssen aus dem Schlaf gerissen worden waren. Wenn sie schlau waren, würden sie sich Zeit lassen und vielleicht sogar versuchen, herauszufinden, woher die Schüsse gekommen waren, bevor sie an Deck kamen, um das Feuer zu erwidern. Aber irgendwann würden sie herauskommen müssen. Die Neugier würde sie treiben. Und dann wäre Sabo bereit. Er nahm die Tür der Kajüte in halber Höhe ins Fadenkreuz, fünfzehn Zentimeter über dem Türknauf, ungefähr drei Handbreit rechts davon. Jeder, der herauskam, musste durch diesen Zielbereich. Sabo atmete aus und wieder ein und hielt dann die Luft an. Das Einzige, was er hörte, war sein eigener Herzschlag.
Ein paar Schritte hinter ihm setzte Captain sich in Bewegung. Er schaltete den Strom wieder ein. Die dunklen Lichter an Antenne und Mast leuchteten flackernd auf und dann auch die roten und grünen Positionslichter. Der Motor stotterte kurz und lief dann rund. Er ließ ihn im Leerlauf brummen und wartete am Steuer, eine Hand auf dem Rad, die andere am Gashebel. Aber wenn alles nach Plan ginge, würde er nicht steuern müssen. Die restlichen Schmuggler würden herauskommen und sterben, und die Jacht würde ohne Steuermann der Trägheit folgen und herandriften, bis sie nur ein paar Meter weit entfernt wäre.
Sabo wartete und starrte konzentriert durch sein Zielfernrohr auf die Tür. Wieder atmete er aus und ein und hielt die Luft an. Das Warten war beinahe unerträglich. Er hatte eben drei Männer getötet, aber das war nicht genug. Sein Blutdurst war noch nicht gestillt. Ungeduldig trommelte sein Finger am Abzugsbügel.
Für Holmes dagegen konnte das alles nicht lange genug dauern. Das Krachen der Schüsse hatte ihn noch weiter durchgeschüttelt. Er war an der Bordwand zusammengesackt und hockte da wie gelähmt. Schlimmer noch, er hatte gewusst, dass so etwas passieren würde. Jeder Bankraub, den er beging, brachte ihn an den Rand des Nervenzusammenbruchs, weil er eine Höllenangst vor dem Gefängnis hatte. Er hatte angefangen, zwischen seinen Einsätzen ganze Händevoll angstlösende Tabletten mit Jack Daniels hinunterzuspülen, aber er hatte festgestellt, dass die Dosis, die er brauchte, um mit dem Stress fertigzuwerden, mehr als ausreichend war, um einen normalen Menschen besinnungslos zu machen. Er musste sich zusammenreißen. Wenn er das lange genug schaffte, um diesen einen letzten Job zu überstehen, würde er sich jahrelang in der Tschechischen Republik verstecken und so viel Xanax einwerfen können, wie er wollte. Er musste nur noch ein bisschen länger durchhalten.
Sabo ließ sein Gewehr sinken. Die Jacht war jetzt nur noch zwanzig Meter weit entfernt. Das bedeutete, sein Teil an dem Unternehmen war vorbei. Jetzt hieß es Showtime für Holmes. Sabo winkte ihm zu, aber Holmes reagierte nicht. Er hielt die Augen weiter geschlossen und umklammerte seine Schrotflinte so fest, dass die Fingerknöchel weiß waren.
»Hey«, sagte Sabo, »du bist dran.«
Holmes nickte, brauchte jedoch immer noch einen Augenblick, um sich zu fassen. Er holte tief Luft, ließ sie langsam wieder entweichen, stemmte sich dann hoch und kletterte zum Bug. Inzwischen war die Jacht bis auf zehn Meter herangekommen und lag voraus an Steuerbord. Lautlos trieb sie auf sie zu. Zum Springen war es noch zu weit. Holmes hob eine an die Bordwand genietete Kette auf, wartete, bis das Boot noch ein Stück näher gekommen war, und warf sie dann wie ein stählernes Lasso über den Bug der Jacht.
Ein paar Sekunden später straffte die Kette sich, und die Physik übernahm den Rest. Der Fischkutter diente als Anker. Er drehte die Jacht zur Seite und schwenkte selbst rückwärts herum. Eine Minute später hatten beide Boote den Bug in dieselbe Richtung gedreht. Der Abstand zwischen ihnen wurde immer kleiner, und dann stießen die beiden Boote mit einem dumpfen Schlag zusammen und kamen unbehaglich nebeneinander zur Ruhe.
Holmes sprang von einem Deck auf das andere.
Sofort hatte er das Schrotgewehr an der Schulter. Er musste sich zwingen, langsam zu arbeiten. Sein Instinkt drängte ihn, geradewegs in die Kabine zu stürmen und die Sache hinter sich zu bringen, aber die Jugmarker-Anweisungen lauteten anders. Zuerst sollte er jeden Winkel an Deck absuchen, um sicherzugehen, dass niemand sich unter freiem Himmel versteckte. Er schob sich um den toten Jungen auf dem Klappstuhl herum und stieg hinunter auf das Hauptdeck. Die Holzplanken unter seinen Füßen waren glitschig von Blut. Mit einem Auge beobachtete er die Kajütentür.
Er suchte methodisch. Mit federnden Knien bewegte er sich im Zickzack über das Deck und schwenkte die Schrotflinte hin und her, um alle Ecken abzudecken. Er hatte sich eine Checkliste von Stellen eingeprägt, die er absuchen musste. Der Schrank unter dem Brückendeck. Hinter dem Schandeck. An der Gangway. Nichts. Er atmete immer noch schnell. Wilde weiße Wölkchen wehten aus seinem Mund durch den Nebel. Er brauchte eine volle Minute, um das Deck abzusuchen und sich der Kabinentür zu nähern. Mit dem Rücken an das Schott daneben gepresst, nahm er sich einen Augenblick Zeit, um sich auszuruhen. Dies war der Augenblick der Wahrheit. Er nahm das Gewehr in die eine Hand und legte die andere auf den Türknauf. Zu seiner Überraschung ließ die Tür sich mühelos öffnen.
Und nichts passierte.
Holmes hatte mit einer Schießerei gerechnet – mit einem, zwei oder vielleicht sogar drei Schmugglern, die ihn hinter dieser Tür erwarteten, um ihn mit einer Sechzig-Schuss-Salve aus ihren Sturmgewehren zu erledigen. Aber das geschah nicht. Da war nichts. Keine behelfsmäßige Barrikade, kein Kugelhagel, keine Sprengfalle und vor allem: keine Spur von irgendwelchen Leuten. Holmes hörte keine Stimmen und sah nichts, das sich bewegte. Keine Schritte, kein leises Atmen. Die Kabine war anscheinend leer. Nur hinten leuchtete eine einzelne Glühlampe, die ihr Licht auf das Deck hinauswarf und einen großen rechteckigen Schatten auf das Schott malte. Holmes sah den Schatten, aber er hatte keine Ahnung, was ihn verursachte. Ein Teil des Schiffs war es nicht. Er zögerte.
Was zum Teufel war das?
Er blieb noch einen Moment lang stehen und wartete darauf, dass die übrig gebliebenen Schmuggler in Aktion traten. Dann gestattete er sich einen winzigen Augenblick der Hoffnung. Vielleicht waren keine mehr übrig. Vielleicht waren es überhaupt nur drei Männer gewesen. Aber der Augenblick ging vorüber. Holmes’ Arbeit war noch nicht getan. Er musste sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Als er so weit war, wirbelte er herum und in die Tür, das Gewehr zuerst, die eine Hälfte seines Körpers im Eingang, die andere Hälfte durch das Schott gedeckt. Er riss die Waffe hin und her und zielte in jede Ecke. Niemand zu Hause.
Er ging vollends hinein.
Und zum dritten Mal an diesem Morgen musste Sabo Park warten.
Es wäre schön, wenn man sagen könnte, dass Sabo Park sich Sorgen um seinen Kollegen machte, aber das tat er nicht. Sabo war ungeduldig. Halb hoffte er sogar, dass da noch ein Schmuggler war, der Holmes umbringen würde, damit er sich auf der Rückfahrt nicht das Gejammer des Jungen würde anhören müssen. Er hatte mitgekriegt, wie er zitterte. Weiche Knie hatte er gehabt. Bei dem Gedanken daran, dass ein so kläglicher Loser den gleichen Anteil kassieren würde wie er, drehte sich ihm der Magen um.
Sabo schälte sich die Skimaske vom Gesicht, nahm die Ohrstöpsel heraus und steckte sie in die Tasche. Er ließ das Gewehr liegen und ging an die andere Seite des Bootes, wo er besser sehen konnte. Die Leichen an Deck der Jacht schienen im Zwielicht grün zu leuchten. Sie waren perfekt. Sabo verzog einen Mundwinkel zu einem schrägen Lächeln. Der Kopf des ersten Schmugglers war genau in der Mitte in zwei Hälften zerrissen worden. Seine beste Arbeit seit langer, langer Zeit.
Er zog seine Beretta aus dem Holster, das unter seinem Gürtel verborgen war, und richtete sie auf die Kabinentür der Jacht. Eine Pistole war auf diese Distanz nicht besonders zielgenau, aber das brauchte sie auch nicht zu sein. Sabo konnte alle fünfzehn Patronen abfeuern, das Magazin auswerfen, nachladen und in weniger als fünfzehn Sekunden wieder schussbereit sein. Ein Gewehr braucht man für Präzisionsarbeit. Eine Pistole ist über kurze Distanzen ganz brauchbar, doch in einer Schießerei zielt niemand genau.
Holmes kam aus der Kabine und hob sein Schrotgewehr, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Alles klar?«, rief Sabo.
»Alles klar«, rief Holmes zurück. »Aber wir haben ein Problem.«
»Was ist?«
Holmes stotterte, als wisse er nicht, was er sagen sollte. »Komm lieber her und sieh es dir an.«
Sabo starrte ihn lange an. Dann schob er die Neun-Millimeter in das Holster, sprang hinüber auf die Jacht und trat behutsam um die Leichen herum. Als er nah genug herangekommen war, um normal zu sprechen, sah er in Holmes’ Gesicht eine Mischung aus Angst, Staunen und Entsetzen, aber da war noch etwas. Etwas anderes. Etwas, das Sabo nicht genau definieren konnte.
»Wo?«, fragte er.
»Gleich hinter der Tür.«
»Haben wir wenigstens die Saphire?«
»Ich glaube, du solltest dir das lieber ansehen.«
Sabo warf einen misstrauischen Blick auf Holmes und dann auf die Kabinentür. Holmes stieß sie auf, sodass Sabo hineinschauen konnte.
Und Sabo sah es.
Das Ding stand mitten in der Kabine unter einem kleinen Tisch, und er hatte noch nicht oft etwas so Erstaunliches gesehen. Es war würfelförmig mit einer Kantenlänge von etwas mehr als sechzig Zentimetern. Darauf, fast als sei jemand erst nachträglich darauf gekommen, lag der Beutel mit den blauen Saphiren, die plötzlich nichts mehr bedeuteten. Ihr Wert war trivial wie der einer Handvoll Pennys auf einem Stapel Hundert-Dollar-Scheine. Was Sabo sah, schockierte ihn so sehr, dass jeder andere Gedanke aus seinem auf Hochtouren laufenden Gehirn verschwand. Etwas Schöneres hatte er noch nie gesehen. Er war sprachlos und wie gelähmt. Was er sah, war gefährlicher als alle Pistolen und Messer, die er je gesehen hatte, wertvoller als alles Geld in allen Banken, die er je ausgeraubt hatte, und schöner als alles Blut, das er je vergossen hatte. Für einen Mann, der so abartig war wie Sabo Park, war es, als sehe er das Angesicht Gottes.
Holmes sprach ihn an. »Was zum Teufel sollen wir tun?«
Sabo antwortete nicht. Stattdessen zog er wortlos die Beretta aus dem Gürtel und schoss ihm ins Gesicht.
Holmes kippte hintenüber und war tot, bevor er auf dem Boden aufschlug. Der Schuss hallte über das Wasser wie ein ferner Donnerschlag. Die Messinghülse fiel klingelnd auf das Deck und rollte in die Kabine. Captain sah, was passierte, aber er brauchte zu lange, um zwei und zwei zusammenzuzählen. Starr vor Schrecken stand er in seinem Cockpit, bis Sabo sich umdrehte und auf ihn schoss.
Die Kugel riss spinnennetzförmige Risse in die Plexiglasscheibe, knapp drei Handbreit von seinem Kopf entfernt, und er ging geduckt in Deckung. Er trug keine Waffe. Er war schließlich nur der Fahrer. Der Wheelman. Die nächste erreichbare Waffe war Sabos Gewehr im Bug des Bootes, wo Sabo sie durchgeladen zurückgelassen hatte. Captain rannte verzweifelt darauf zu.
Sabo ging gelassen auf das Fischerboot zu und feuerte mit ausgestrecktem Arm eine Kugel nach der anderen auf den alten Mann ab. Die Kugeln zerschmetterten das Plexiglas, und Querschläger schwirrten auf dem Boot umher, zertrümmerten die Instrumente und bohrten sich in das Deck. Eine Kugel pfiff nur Zentimeter an Captains Kopf vorbei in den Nachthimmel.
Captains Spurt brachte ihn ungefähr fünf Meter weit, bevor ihn eine Kugel in die linke Brustseite traf, dem Herzen gegenüber. Er kam noch zwei Schritte weiter und stürzte dann nur wenige Zentimeter vor dem Gewehr auf die Decksplanken. Er wand sich und krallte die Finger in die Wunde, als seine Lunge kollabierte.
Sabo ließ sich Zeit. Er schob die Beretta in das Holster und sprang lässig auf den Fischkutter hinüber. Dann ging er in die Kabine, schaltete alle Instrumente ab und trat zu Captain hin. Der alte Mann verfolgte ihn mit seinen Blicken. Das Blut quoll durch seine Jacke und floss auf das Deck. Mit jedem kurzen, flachen Atemzug knisterte die Wunde leise. Hellroter Schaum kam mit einem gurgelnden Geräusch aus seinem Mund und tröpfelte an seinem Mundwinkel herunter. Sabo blieb vor ihm stehen, ließ sich in die Hocke sinken und legte eine gewölbte Hand hinter sein Ohr.
Captain versuchte mühsam, etwas zu sagen, aber kein Wort kam aus seinem Mund.
Sabo schüttelte den Kopf. »Kannst nicht sprechen, was? Bei einem Schuss in die Brust ist das so. Deine Lunge wird sich mit Blut füllen. Ich gebe dir noch zehn Minuten.«
Captain starrte ihn flehentlich an.
Sabo warf einen Blick auf die Uhr und schaute Captain dann in die Augen. »Leider habe ich keine zehn Minuten mehr.«
Er langte nach seinem Gewehr, drückte Captain die Mündung an den Kopf und erschoss ihn. Dann wischte er sich die Blutspritzer von der Jacke, zog das leere Magazin heraus und schob ein neues ein. Er feuerte alle vier Patronen unter der Wasserlinie in die Bordwand, sodass das Wasser ins Boot laufen konnte, und warf das Gewehr ins Meer. Die Pumpen würden mit dem eindringenden Wasser fertigwerden, aber nicht lange. In einer halben Stunde würde der Kutter auf halbem Weg zum Meeresgrund sein.
Sabo wusste, dass er nichts hinterlassen durfte. Nichts durfte ihn mit dem, was in dieser Nacht hier draußen passiert war, in Verbindung bringen. Bald würden mächtige Leute suchen, was er gestohlen hatte. Vielleicht würden sie niemals aufhören zu suchen. Manche würden an Altersschwäche sterben, bevor sie die Suche aufgäben. Sabo wusste, dass sie nicht nachlassen würden, aber er wusste auch, dass es sich lohnte. Wenn er ihnen entwischen könnte, würde er alles bekommen, was er jemals hatte haben wollen. Er würde das Luxusleben führen, von dem er immer geträumt hatte. Aber er durfte keine Zeugen hinterlassen. Keine Komplizen. Keine Spuren.
Er musste verschwinden.
Sabo sprang zurück auf die Jacht. Er sah, wie sich seine ganze Zukunft von diesem Augenblick an vor ihm ausdehnte. Er würde die Leichen über Bord werfen und dann die Jugmarkerin anrufen und darüber informieren, dass die andern bei einer Schießerei ums Leben gekommen waren. Er würde das Funkgerät und den Notfall-Positionsmelder der Jacht abschalten, sodass man ihn nicht würde orten können. Dann würde er den nächsten Hafen anlaufen, seinen Schatz von Bord bringen und das Boot versenken. Seine kostbare Beute war zu schwer, um damit zu reisen; also würde er sie irgendwo verstecken müssen. Die Jugmarkerin würde die Saphire verkaufen, und wenn Sabo seinen Anteil bekommen hätte, könnte er so weit wegfahren, wie er wollte. Er würde in einem entlegenen Winkel der Welt untertauchen, für ein paar Jahre, wenn es sein musste, bevor er zurückkäme, um sich zu holen, was ihm gehörte. Aber das war es wert. Das alles war es wert.
Denn von diesem Augenblick an war Sabo Park der reichste Mann, den er je gekannt hatte.