

CLIVE CUSSLER
&
DIRK CUSSLER
Die Kuba-
Verschwörung
Ein Dirk-Pitt-Roman
Deutsch von Michael Kubiak
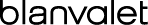
PROLOG
Verfolgt
15. Februar, 1898
Schweiß glänzte auf dem Gesicht des erschöpften Mannes, perlte über seine unrasierten Wangen und tropfte von seinem Kinn. Er zog die Innenhebel eines Paars schwerer Holzruder bis dicht an seine Brust, ließ die Ruderblätter für einen Moment neben dem Boot auf dem Wasser treiben und wischte sich mit einem ölverschmierten Hemdärmel den Schweiß von der Stirn. Während er die Schmerzen in seinen Armen und Schultern ignorierte, nahm er den langsamen, aber stetigen Ruderrhythmus wieder auf.
Die Anstrengung allein war nicht für sein Schwitzen verantwortlich, ebenso wenig die stickige tropische Schwüle. Die Sonne hatte sich kaum vom Horizont gelöst, und die stille Luft über dem Hafen von Havanna wirkte kühl und feucht. Es war die ständige Gefahr, verfolgt zu werden, die seinen Puls beschleunigte. Mit leerem Blick suchte er die Wasserfläche ab und gab dem Mann, der hinter ihm im Boot saß, mit einem Kopfnicken ein Zeichen.
Fast zwei Wochen war es her, dass die spanische Miliz versucht hatte, seinen Fund zu beschlagnahmen. Drei seiner Kameraden hatten bereits ihr Leben lassen müssen, als sie das wertvolle Stück verteidigt hatten. Was das Geschäft des Tötens betraf, so hatten die Spanier keinerlei Skrupel und würden ihn ohne zu zögern aus dem Weg räumen, um sich zu verschaffen, was sie unbedingt haben wollten. Er hätte schon längst den Tod gefunden, wäre er nicht zufällig einer bunt gemischten Truppe bewaffneter kubanischer Rebellen begegnet, die ihm bis in die Außenbezirke von Havanna sicheres Geleit gewährten.
Er blickte über die Schulter zu zwei Kriegsschiffen hinüber, die unweit des Handelshafens ankerten.
»Al estribor«, sagte er mit rauer Stimme. »Nach rechts.«
»Sí«, erwiderte der untersetzte Kubaner, der hinter ihm saß und sein eigenes Paar Ruder durch das Wasser zog. Auch er trug zerrissene und schmutzige Kleidung, und sein Gesicht befand sich dank eines verwitterten Strohhuts im Schatten.
Sie lenkten das große Boot in Richtung der modernen stählernen Kriegsschiffe. Der alte Mann suchte den Hafen nach möglichen Gefahren ab, hatte seine Verfolger jedoch, wie es schien, abschütteln können. Nun winkte ihm eine sichere Zuflucht.
Sie ruderten an dem kleineren Kriegsschiff vorbei, an dessen Heckmast eine spanische Flagge hing, und näherten sich dem zweiten Schiff. Es war ein Panzerkreuzer mit Zwillingsgeschütztürmen, deren Rohre auf beiden Seiten weit über die Reling hinausragten. Deck und Überwasserschiff waren in Hellgelb gehalten und setzten sich deutlich von dem schneeweißen Rumpf ab. Mit seinen weißen Positionslaternen, die das aufziehende Morgengrauen erhellten, funkelte das Schiff wie ein bernsteinfarbener Diamant.
Mehrere Wachtposten patrouillierten auf Vor- und Achterschiff und garantierten mit ihrer demonstrativ zur Schau gestellten Einsatzbereitschaft die Sicherheit des Kreuzers. Ein Offizier in dunkler Uniform erschien auf dem Laufgang eines Deckaufbaus und verfolgte den Kurs des sich nähernden Ruderboots.
Er hob ein Sprechrohr und hielt es vor den Mund. »Stoppen Sie und verraten Sie mir, was Sie wollen.«
»Ich bin Dr. Ellsworth Boyd von der Yale University«, antwortete der alte Mann mit schwankender Stimme. »Das amerikanische Konsulat in Havanna hat veranlasst, dass ich auf Ihrem Schiff Schutz suchen kann.«
»Einen Moment, bitte.«
Der Offizier begab sich zur Kommandobrücke und erschien wenige Minuten später zusammen mit mehreren Matrosen auf dem Hauptdeck. Eine Strickleiter wurde an der Rumpfseite herabgelassen, und der Offizier winkte das Ruderboot heran. Als das Boot am Rumpf des Kriegsschiffs entlangschrammte, stand Boyd auf und warf einem der Matrosen eine Leine zu.
»Zu meinem Gepäck gehört eine Kiste, die ich nicht zurücklassen darf. Sie ist außerordentlich wichtig.«
Mit dem Fuß schob Boyd ein paar Palmzweige beiseite, die einen stabilen Holzkasten bedeckten, der zwischen den Ruderbänken stand. Während die Matrosen weitere Seile herabließen, kontrollierte Boyd mit wachsamen Blicken die weitere Umgebung. Beruhigt, dass von dort offenbar keine Gefahr drohte, befestigten er und sein Gefährte die Seile an der Kiste und verfolgten, wie sie nach oben gehievt wurde.
»Die muss an Deck bleiben«, entschied der Offizier, während zwei Matrosen die schwere Kiste neben ein Belüftungsrohr mit Ventilator schoben und an massiven Stahlringen festzurrten, die mit dem Deck verschweißt waren.
Boyd reichte seinem Mitruderer eine Goldmünze und verabschiedete sich mit einem Händedruck von ihm, dann stieg er die Leiter hinauf. Mit knapp über fünfzig Jahren war Boyd erstaunlich fit und an das feuchtheiße Tropenklima gewöhnt, da ihn seine Arbeit alljährlich während der Wintersaison in die Karibik führte. Und doch war er nicht mehr jung, eine Tatsache, die er nur ungern zur Kenntnis nahm. Während er an Deck kletterte, ignorierte er die Schmerzen in seinen Gelenken – und auch die ständige Müdigkeit, die er nicht abschütteln konnte.
»Ich bin Lieutenant Holman«, stellte sich der Offizier vor. »Wir haben Sie bereits erwartet, Dr. Boyd. Ich zeige Ihnen eine Gästekabine, dort können Sie sich frisch machen. Aus Sicherheitsgründen muss ich Sie allerdings bitten, sich vorerst nur in Ihrer Kabine aufzuhalten. Wenn Sie wollen, führe ich Sie später durch das Schiff. Vielleicht können wir auch heute noch ein Treffen mit dem Kapitän für Sie arrangieren.«
Boyd streckte eine Hand aus. »Vielen Dank, Lieutenant. Ich weiß Ihre Gastfreundschaft zu schätzen.«
Holman ergriff seine Hand und drückte sie. »Im Namen des Kapitäns und der Mannschaft heiße ich Sie an Bord des Schlachtkreuzers USS Maine willkommen.«
Ein leichter Abendwind – Ausläufer des in diesen Breiten allgegenwärtigen Passats – bewegte die Maine an ihrem Ankerplatz so weit, dass ihr stumpfer Bug auf das Zentrum Havannas deutete. Die Wachtposten des Schiffes waren dankbar für die Brise, die den Gestank des schmutzigen Hafenwassers milderte.
Der Wind trug auch die vielstimmige Sinfonie der Straßen Havannas zu ihnen – die Musikfetzen aus den Hafenkneipen, das Lachen der Passanten auf dem nahe gelegenen Malecón und das Hufgeklapper und Rattern der Pferdefuhrwerke auf den Alleen. Die lebhaften Klänge erinnerten die Mannschaft der Maine auf schmerzhafte Weise daran, dass ihnen während der drei Wochen seit ihrer Ankunft jeglicher Landurlaub gestrichen worden war. Das Schiff war nach Kuba entsandt worden, um das amerikanische Konsulat nach einem Angriff spanischer Royalisten zu schützen, die der amerikanischen Regierung auf Grund ihrer Unterstützung kubanischer Rebellen, die sich gegen die spanische Gewaltherrschaft wehrten, den Kampf angesagt hatten.
Boyds Kabinentür erzitterte unter einem lauten Anklopfen. Er öffnete sie, und vor ihm stand Lieutenant Holman in einer messerscharf gebügelten blauen Uniform, die dem feuchtheißen Klima souverän trotzte.
Holman deutete eine Verbeugung an. »Der Kapitän nimmt erfreut zur Kenntnis, dass Sie seine Einladung zum Abendessen angenommen haben.«
»Vielen Dank, Lieutenant. Bitte, gehen Sie voraus.«
Ein heißes Bad und ein langer Nachmittagsschlaf hatten Boyds Lebensgeister aufgefrischt. Er folgte dem Schiffsoffizier mit den energischen Schritten eines Mannes, der aller Widrigkeiten zum Trotz sein angestrebtes Ziel erreicht hatte. Er trug seine Marschkleidung, mittlerweile frisch gewaschen und lediglich durch ein formelles Jackett vervollständigt, das er sich von Holman ausgeliehen hatte. Unbehaglich zog er an den Ärmeln, die für seine langen Arme mehrere Zentimeter zu kurz waren.
Sie gelangten zu einer kleinen Offiziersmesse kurz vor dem Achterdeck. In der Mitte des Raums stand ein mit weißem Geschirr und funkelndem Silberbesteck bedeckter Tisch, an dem der Kapitän der Maine bereits saß.
Charles Sigsbee war ein gebildeter Mann mit analytischem Verstand, der wegen seiner Führungsqualitäten hohes Ansehen in der Navy genoss. Mit runder Brille und buschigem Schnurrbart ähnelte er eher einem Bankangestellten als einem Schiffskapitän. Er erhob sich und begrüßte Boyd mit einem missbilligenden Blick, während Holman Gastgeber und Gast miteinander bekannt machte.
Die drei Männer nahmen ihre Plätze am Tisch ein, und ein Steward erschien und servierte eine Fleischbrühe. Boyd bemühte sich, den Schoßhund zu ignorieren, der neben dem Kapitän auf einem eigenen Stuhl lag.
Sigsbee wandte sich an Boyd. »Ich hoffe, Sie sind mit Ihrem Quartier an Bord der Maine zufrieden.«
»Mehr als das«, sagte Boyd. »Ich bin Ihnen zu tiefem Dank verpflichtet, dass Sie mir so kurzfristig Zuflucht auf Ihrem Schiff gewährt haben. Ich kann Ihnen kaum beschreiben, wie schön mir die Maine erschien, als ich sie heute Morgen das erste Mal zu Gesicht bekam.«
»Ich fürchte allerdings, wir haben an Komfort nur sehr wenig zu bieten, da wir auf Gäste gar nicht eingerichtet sind«, sagte Sigsbee. »Wir sind hierhergekommen, um gefährdeten Amerikanern die sichere Ausreise zu ermöglichen, aber seit unserer Ankunft hat sich die Lage anscheinend entspannt. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich überrascht war, als mich die Bitte des in Havanna ansässigen Konsuls erreichte, Sie an Bord aufzunehmen, um Sie in die Vereinigten Staaten zu bringen – und das ohne jede weitere Erklärung.«
Boyd seufzte. »Der Konsul ist ein Freund der Familie aus früheren Zeiten in Virginia und war so nett zu intervenieren. Es ist jedoch keine Übertreibung, wenn ich sage, dass mein Leben ernsthaft in Gefahr war.«
»Ich hörte von Lieutenant Holman, dass Sie als Anthropologe an der Universität von Yale tätig sind.«
»Ja, mein Spezialgebiet sind karibische Kulturen der Frühzeit. Ich habe gerade erst eine für das Wintersemester angesetzte Lehrgrabung in Jamaika abgeschlossen und wurde zu einem nicht geplanten Abstecher nach Kuba gezwungen.«
Der Steward trug die leeren Suppenteller davon und kehrte mit Servierplatten zurück, auf denen eine Auswahl an gegrilltem Fisch arrangiert war. »Die Kiste, die wir an Bord gehievt haben«, sagte Holman, »stammt sie von Ihrer Ausgrabung?«
Boyd nickte.
»Vielleicht«, sagte Sigsbee, »können Sie uns Ihr Fundstück nach dem Essen zeigen und uns seine Bedeutung ein wenig erläutern.«
Boyd reagierte sichtlich angespannt. »Damit würde ich lieber warten, bis wir auf See sind«, erwiderte er mit gepresster Stimme.
»Was hat Sie denn nach Havanna verschlagen?«, fragte Holman.
»Ich habe Montego Bay vor vierzehn Tagen auf dem Dampfer Orion mit dem Ziel New York verlassen. Kurz nach der Abfahrt gab es Probleme mit dem Dampfkessel, und wir waren gezwungen, Cárdenas anzulaufen, wo die Passagiere von Bord gehen mussten. Man erklärte uns, dass wir uns mindestens drei Wochen gedulden müssten, da die Reparatur des Schiffes so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Ich entschied, Havanna auf dem Landweg zu erreichen – in der Hoffnung, dort einen Platz auf einem Postschiff nach Key West zu ergattern. Dann begannen jedoch die Schwierigkeiten.«
Er trank einen Schluck Mineralwasser, während Holman und Sigsbee darauf warteten, dass er fortfuhr.
»Es war der Spanier – Rodriguez«, sagte Boyd, und Zorn blitzte in seinen Augen auf.
»Rodriguez?«, fragte Holman.
»Ein Archäologe aus Madrid. Er hielt sich zufälligerweise in Jamaika auf und besuchte unser Lager. Jemand musste ihm von meinem Fund erzählt haben, da er plötzlich auch an Bord der Orion auftauchte und mich auf Schritt und Tritt beobachtete. Es war ganz sicher kein Zufall.« Seine Stimme bebte. »Ich kann es zwar nicht beweisen, aber irgendwie muss er das Schiff lahmgelegt haben.«
Skeptisch runzelte der Kapitän die Stirn. »Was geschah denn nun, als Sie in Cárdenas eintrafen?«
»Begleitet wurde ich von zwei Studenten und meinem persönlichen Assistenten, Roy Burns, der mir bei meinen Lehrgrabungen stets zur Hand ging. Wir erwarben in Cárdenas ein Maultier und ein Fuhrwerk und beluden es mit der Kiste und unserem Gepäck. Am nächsten Tag brachen wir nach Havanna auf, wurden jedoch in der darauf folgenden Nacht, kurz nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, überfallen.«
Seine Augen wurden feucht, als er von der schmerzlichen Erinnerung eingeholt wurde.
»Eine Gruppe bewaffneter Reiter griff uns an. Sie mischten mich und Burns ziemlich heftig auf und schnappten sich das Fuhrwerk. Einer meiner Studenten verfolgte sie mit einem Messer. Sie stießen ihm eine Machete in die Brust, dann erschlugen sie seinen Kommilitonen. Die beiden hatten nicht die geringste Chance.«
»Waren die Männer spanische Soldaten?«, wollte Sigsbee wissen.
Boyd zuckte die Achseln. »Sie waren bewaffnet und trugen Uniformen, aber anscheinend gehörten sie zu einer Rebelleneinheit. Ihre Uniformen hatten weder Hoheits- noch Rangabzeichen.«
»Wahrscheinlich waren es Weyleristen«, sagte Holman. Die extremistische Splittergruppe war dem spanischen Gouverneur, General Valeriano Weyler, treu ergeben, der Kuba kurz zuvor nach einer Amtsperiode, die von der brutalen Verfolgung kubanischer Rebellen gekennzeichnet war, verlassen hatte.
»Durchaus möglich«, sagte Boyd. »Sie waren bestens ausgerüstet, aber offensichtlich Freischärler. Wir fanden heraus, dass sie in einem Dorf namens Picadura campierten. Burns und ich waren entschlossen, ihnen das Artefakt abzujagen, und folgten ihnen zu ihrem Lager. Burns zündete ein Feuer an, um sie abzulenken, während ich ihre Reitpferde verscheuchte und das Fuhrwerk zurückeroberte. Burns wurde von einer Gewehrkugel in der Brust getroffen. Ich musste ihn zurücklassen …« Vor Bitterkeit versagte seine Stimme.
»Ich habe das Fuhrwerk durch die Nacht gelenkt, während sie mich beharrlich verfolgten. Im Morgengrauen versteckte ich den Wagen dann im Dschungel und machte mich zu Fuß auf den Weg, um Nahrung für mich und das Maultier zu suchen. Ich konnte mich drei Tage lang von ihren Patrouillen fernhalten und war nur des Nachts auf Wegen unterwegs, von denen ich hoffte, dass sie mich nach Havanna führten.«
»Bemerkenswert, dass Sie ihnen entkommen konnten«, sagte Sigsbee.
»Letztlich habe ich es doch nicht geschafft.« Boyd schüttelte den Kopf. »Am vierten Tag haben sie mich schließlich gefunden. Das Maultier hatte mit seinem Wiehern meinen Standort verraten. Es war nur ein kleiner Trupp, vier Männer. Sie holten mich vom Fuhrwerk herunter und hielten mich mit ihren Gewehren in Schach, als eine Salve aus dem Dschungel abgefeuert wurde. Die Spanier gingen zu Boden, niedergemäht bis auf den letzten Mann. Es war eine Bande kubanischer Rebellen, die zufällig in der Nähe campiert und den Lärm gehört hatten.«
»Aber sie haben Ihnen die Kiste nicht abgenommen?«, fragte Holman.
»Ihr einziges Interesse galt den Waffen der toten Spanier. Mich behandelten sie wie einen compadre, da sie mich, wie ich annehme, für einen Feind der Spanier hielten. Sie begleiteten mich bis nach Havanna.«
»Ich hörte, dass die kubanischen Rebellen, wenn auch nicht sehr gut ausgebildet, ausgesprochen tapfere Kämpfer sind«, sagte Sigsbee.
»Das kann ich bestätigen«, sagte Boyd. »Nachdem ihre Patrouille getötet worden war, sammelte die restliche spanische Streitmacht ihre Leute und heftete sich an unsere Fersen, um die Opfer zu rächen. Die Rebellen belauerten und beschossen sie ständig und bremsten auf diese Weise ihren Vormarsch. Als wir die Außenbezirke von Havanna erreichten, blieben die Kubaner zurück und zerstreuten sich, aber einer von ihnen nahm Kontakt mit dem Konsulat auf. Ihr bester Kämpfer begleitete mich bis an die Küste, beschaffte ein Ruderboot und half mir, zur Maine zu gelangen.«
Sigsbee lächelte. »Für Sie war das sicherlich ein Glücksfall.«
»Die kubanischen Rebellen hassen die Spanier bis aufs Blut und wissen die Hilfe, die unsere Nation ihnen gewährt, zu schätzen. Sie baten um weitere Waffenlieferungen.«
»Zur Kenntnis genommen.«
»Captain«, sagte Boyd, »wann werden wir Havanna verlassen?«
»Das kann ich nicht sagen, aber wir befinden uns seit drei Wochen in Bereitschaft, und wie es aussieht, hat sich die angespannte Lage mittlerweile beruhigt. Ende des Monats ist ein Einsatz in New Orleans geplant, den wir, wie ich annehme, auch absolvieren werden. Entsprechend rechne ich während der nächsten Tage mit unserem Marschbefehl.«
Boyd nickte. »Um unser aller Wohlergehen willen hoffe ich, dass er schon bald kommt.«
Holman lachte. »Dr. Boyd, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Kein Ort in Havanna ist so sicher wie die Maine.«
Nach dem Abendessen rauchte Boyd mit den Offizieren auf dem Achterdeck eine Zigarre, dann kehrte er in seine Kabine zurück. Doch ein bohrendes Unbehagen ließ seine Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Er würde sich erst dann wirklich sicher fühlen, wenn der Hafen von Havanna weit hinter ihnen lag. In einem Winkel seines Bewusstseins glaubte er die Stimmen von Roy Burns und der zu Tode gekommenen Studenten hören zu können, die ihm aus dem Jenseits eine Warnung zuriefen.
Da er nicht einschlafen konnte, stieg er zum Hauptdeck hinauf. Tief atmete er die feuchte Nachtluft ein. Irgendwo in der Nähe der Kommandobrücke hörte er das Schlagen einer Glocke, die die Tageszeit verkündete. Halb zehn. Das ausgelassene Gelächter der Gäste in den Bodegas im Hafenviertel hallte durch die ganze Bucht. Boyd verdrängte die Geräusche jedoch und blickte in das stille schwarze Wasser hinab.
Ein kleines Boot näherte sich dem Schlachtschiff und veranlasste den diensthabenden Offizier, sich auf der Brückennock zu zeigen und einen lauten Warnruf auszustoßen. Der einzige Insasse des Bootes, ein Fischer in zerlumpter Kleidung, schwenkte eine halbvolle Flasche Rum und rief eine gelallte Antwort, ehe das kleine Boot wieder abdrehte.
Boyd beobachtete, wie es um den Bug der Maine herum glitt, dann hörte er ein metallisches Klirren und ein lautes Plätschern. Irgendetwas stieß gegen den Rumpf des Schlachtschiffs. Ein hölzernes Objekt schrammte am Schiff entlang, als ob es über einen eigenen Antrieb verfügte. Boyd nahm es genauer in Augenschein und erkannte, dass es sich im Schlepptau des Fischerboots befand.
Sein Magen verkrampfte sich. Er schaute zur Kommandobrücke und winkte der Gestalt auf der Brückennock zu. »Wachoffizier! Wachoffizier!«
Ein dumpfer Knall erklang irgendwo unterhalb des Schiffes, dann stieg eine kleine Wasserfontäne am Bug in die Höhe und zerfaserte in der Luft. Boyd zählte zwei Herzschläge, danach erfolgte eine gigantische Explosion.
Der Professor wurde rücklings gegen ein Schott geschleudert, als sich die vordere Hälfte des Schiffes in einen rasenden Vulkan verwandelte. Stahl, Rauch und Flammen – und dazwischen die zerfetzten Leiber Dutzender Soldaten – schossen in den Himmel hinauf. Boyd schüttelte die Schmerzen in seiner Schulter ab, während um ihn herum ein Trümmerregen niederging. Das Krähennest des Vorderschiffs erschien wie aus dem Nichts und krachte neben ihm auf das Deck.
Boyd kämpfte sich auf die Füße und stolperte vom Instinkt getrieben über das schräge Deck. In seinen Ohren war ein Rauschen, das die Schreie der Marinesoldaten, die unter Deck gefangen waren, übertönte. Alles, was jetzt noch für ihn zählte, war sein antikes Fundstück. Im roten Lichtschein des mittschiffs lodernden Flammeninfernos taumelte er darauf zu. Auf wunderbare Weise war die Kiste vor ernsten Schäden bewahrt worden und stand noch immer festgezurrt neben den Überresten des Ventilators.
Ein sich schnell nähernder Raddampfer erregte seine Aufmerksamkeit. Das dampfgetriebene Schiff ging neben dem sinkenden Kriegsschiff längsseits und stieß leicht gegen seinen Rumpf. Drei Männer in dunkler Kleidung sprangen an Bord.
Boyd hielt sie für Angehörige einer Rettungsmannschaft, bis einer der Matrosen der Maine, der während der Explosion im Maschinenraum seinen Dienst versehen hatte, ihnen in seiner qualmenden Uniform entgegenwankte. Einer der Männer vom Raddampfer stellte sich ihm in den Weg, rammte ihm ein Messer in die Seite und wuchtete seinen zuckenden Körper über die Reling.
Boyd war zu geschockt, um zu reagieren. Dann verarbeitete sein Geist das Gesehene. Die Männer waren nicht gekommen, um Hilfe zu leisten. Sie mussten von Rodriguez geschickt worden sein und wollten das Artefakt in ihre Gewalt bringen.
Der Archäologe erreichte die Kiste und wandte sich zu den Angreifern um. Eine verbogene Schaufel, die aus einem Kohlebunker an Deck geschleudert worden war, lehnte an einem Schott. Boyd ergriff sie.
Der erste Angreifer schwang ein blutiges Messer, dessen Klinge den Lichtschein der sich ausbreitenden Flammen reflektierte.
Boyd holte mit der Schaufel aus.
Der Eindringling wollte zurückweichen, aber das Wasser, das mittlerweile seine Füße umspülte, behinderte ihn. Boyd erwischte ihn an seinem Wangenknochen. Der Angreifer stieß einen Schmerzlaut aus und sackte auf die Knie. Aber seine beiden Komplizen zögerten keine Sekunde. Sie stürzten sich auf Boyd, ehe er erneut ausholen konnte, und schlugen seine Schaufel beiseite. In der Hand des einen Mannes lag plötzlich eine schwere Pistole, die er aus kürzester Entfernung auf Boyd abfeuerte.
Die Kugel bohrte sich in seine linke Schulter. Der Archäologe taumelte zurück, und die beiden Männer drängten sich an ihm vorbei und lösten die Stricke, die die Kiste an Ort und Stelle fixierten.
»Nein!«, rief Boyd, während sie sich anschickten, die Kiste über das schiefe Deck des sinkenden Schiffes zu ziehen.
Er kam auf die Füße und watete mit wackligen Beinen hinter ihnen her. Die Piraten ignorierten ihn jedoch, hievten die Kiste über die Reling und ließen sie in die Arme mehrerer Männer hinunter, die schon auf dem Raddampfer bereitstanden. Einer von ihnen trug einen Hut mit breiter Krempe, die sein Gesicht verbarg, aber Boyd wusste, dass er Rodriguez vor sich hatte.
Benommen vom hohen Blutverlust, sackte Boyd zusammen und kippte gegen den nächsten Eindringling. Der Pirat, ein untersetzter Mann mit kalten schwarzen Augen, packte Boyds Arm. Aber ehe er Boyd beiseitestoßen konnte, weiteten sich seine Augen. Ein Schatten glitt über sein Gesicht, und er richtete den Blick nach oben.
Einen Moment später verschwand der Pirat unter der Masse eines der Zwillingsschornsteine der Maine, der wie ein gefällter Redwoodbaum an der Basis geborsten und umgestürzt war. Während der Angreifer den Tod fand, wurde Boyd von dem Schornstein lediglich gestreift. Aber seine Beine lagen eingeklemmt unter der stählernen Masse, die ihn auf das mittlerweile vollständig überspülte Schiffsdeck nagelte.
Er warf sich hin und her, um sich zu befreien, doch die Last auf seinen Beinen war zu schwer. Unter Wasser gefangen, rang er nach Luft, reckte den Kopf über die zusammenströmenden Wellen und machte tiefe keuchende Atemzüge, während er an seinen Beinen zerrte.
Er spürte, wie unter ihm das Deck schwankte, während das Schiff absackte. Als die Flammen die Munitionskammern erreichten, flogen ihm vereinzelte Kugeln um die Ohren, sobald die Patronenkisten explodierten. Dann tauchte der Bug vollends unter.
Als er spürte, wie das Schiff unaufhaltsam in die Tiefe glitt, schaffte Boyd einen letzten tiefen Atemzug. Dabei sah er, wie der Raddampfer mit der gestohlenen Kiste auf dem Achterdeck in zügiger Fahrt auf die Hafenausfahrt zusteuerte.
Und dann zog die Maine den Archäologen mit in ihr schwarzes, nasses Grab hinab.
TEIL I
Geheimnisvolle Strömung
1
Juni 2016
Der Farbanstrich des plumpen Fischerboots bestand aus einer eigenwilligen Mischung von Lavendelblau und Zitronengelb. Als die Farben noch frisch waren, hatten sie dem Boot eine Aura von Unbeschwertheit und Fröhlichkeit verliehen. Von Sonne und See ausgelaugt, war von der Leuchtkraft nichts mehr übrig geblieben, und das kleine Schiff wirkte in der Weite des dunklen Ozeans bleich und kraftlos.
Die beiden jamaikanischen Fischer, die mit der Javina unterwegs waren, schenkten ihrem schäbigen Aussehen keine Beachtung. Ihre einzige Sorge war, ob die Maschine, die schwarzen Qualm ausstieß, sie nach Hause zur Insel zurückbringen würde, ehe das durch zahlreiche winzige Lecks eindringende Wasser die Förderleistung der Bilgenpumpe überstieg.
»Beeil dich mit dem Köder, solange die Thunfische noch beißen.« Der ältere Mann stand am Heck, wo er eine lange Angelleine über die Seitenreling ausbrachte. Neben seinen Füßen zappelten zwei große silberne Fische in einer Wasserpfütze auf dem Deck.
»Keine Sorge, Onkel Desmond.« Der jüngere Mann spießte kleine Stücke Makrelenfleisch auf eine Kette rostiger, von Hand zurechtgebogener Haken. »Die Sonne steht tief am Himmel, daher beißen die Fische auf der Sandbank noch für einige Zeit.«
»Es ist aber nicht die Sonne, für die der Köder gedacht ist.« Desmond ergriff den Rest der Angelschnur, warf sie ins Wasser und befestigte das Ende an einer Klampe am Bootsrand. Er wollte gerade zum Ruderhaus gehen, um den Kurs des Bootes zu korrigieren, blieb dann jedoch stehen und reckte lauschend den Hals. Ein dumpfes Grollen, wie rollender Donner, war über dem Rattern des alten Dieselmotors der Javina zu hören.
»Was ist das, Onkel?«
Desmond schüttelte ratlos den Kopf. Er bemerkte einen dunklen Kreis, der auf der Backbordseite im Wasser entstand.
Die Javina knarrte und ächzte, als sie von der unsichtbaren Hand der Schockwelle gepackt wurde. Eine schneeweiße Gischtwolke schoss in geringer Entfernung einige Meter in die Luft. Ihr folgte eine schäumende konzentrische Welle, die anscheinend wie ein kompakter Ring von der Wasseroberfläche abhob. Die Welle dehnte sich aus, erreichte das Fischerboot und ließ es zum Himmel aufsteigen. Desmond klammerte sich an das Ruder, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Sein Neffe stolperte mit weit aufgerissenen Augen ins Steuerhaus. »Was ist das?«
»Irgendetwas unter Wasser.« Desmond krampfte die Finger mit weißen Knöcheln um die Speichen des Ruders, während sich das Boot weit auf die Seite legte.
Für einen kurzen Moment schien es, als werde es kentern, doch dann, als sich die Welle verlief, richtete es sich wieder auf. Die Javina schaukelte sanft auf der nunmehr wieder ruhigen Wasseroberfläche, während sich der schäumende Ring endgültig auflöste.
»Das war doch verrückt«, stellte der Neffe fest und kratzte sich am Kopf. »Was ist hier draußen los?« Das kleine Schiff war mehr als zwanzig Meilen von Jamaika entfernt, dessen Küstenlinie am Horizont kaum zu erkennen war.
Desmond zuckte die Achseln, während er das Boot vom Zentrum der Eruption fortlenkte. Er deutete über den Bug hinweg. »Vermutlich kam das von den Schiffen vor uns. Anscheinend suchen sie nach Erdöl.«
Eine Meile voraus schleppte ein Forschungsschiff eine hoch aufragende Schwimmplattform hinter sich her. Ein orangefarbenes Mannschaftsschiff pflügte ein kurzes Stück vor dem Schiff durch die Wellen. Alle drei nahmen Kurs auf die Javina – oder genauer gesagt: auf das Zentrum der Unterwasserexplosion.
»Onkel, welches Recht haben sie, in unseren Gewässern zu kreuzen und Sprengungen durchzuführen?«
Desmond lächelte. »Mit einem Schiff von dieser Größe können sie kreuzen, wo sie wollen.«
Während sich die kleine Armada näherte, füllte sich die Wasserfläche rund um die Javina mit Treibgut, das aus der Tiefe aufstieg. Tote Fische und andere Meereslebewesen, zerfetzt von der Explosion, trieben im Ozean.
»Die Thunfische«, rief der Neffe. »Sie töten unsere Thunfische!«
»Wir finden woanders mehr davon.« Desmond beobachtete das Forschungsschiff, das auf sie zuhielt. »Ich glaube, wir sollten die Sandbank lieber verlassen.«
»Nicht bevor ich ihnen nicht gezeigt habe, was ich von ihnen halte.«
Der Neffe streckte die Hand nach dem Ruder aus und drehte es nach Backbord, so dass die Javina zu dem großen Schiff herumschwenkte. Das Mannschaftsboot registrierte die Kursänderung, kam in hohem Tempo herüber und ging wenige Minuten später längsseits. Die beiden braunhäutigen Männer auf dem Boot waren offenbar keine Jamaikaner, was sich durch ihr Englisch, das einen seltsamen Akzent hatte, bestätigte.
»Sie müssen dieses Gebiet sofort verlassen«, befahl der Lenker des Bootes.
»Dies sind unsere Fischgründe«, widersprach der Neffe. »Sehen Sie sich um. Sie haben unsere Fische getötet. Diesen Schaden müssen Sie uns ersetzen.«
Der Steuermann des Mannschaftsboots musterte die Jamaikaner ohne ein Anzeichen von Verständnis oder gar Anteilnahme. Er schaltete ein Sprechfunkgerät ein, sprach in ein Mikrofon und rief das Schiff. Ohne ein weiteres Wort zu den Fischern gab er Gas und lenkte das Mannschaftsboot von der Javina weg.
Der massige schwarze Rumpf des Forschungsschiffs rauschte wenig später heran und türmte sich vor der Javina auf. Unerschrocken wiederholten die Fischer ihre Beschwerde gegenüber den Matrosen, die auf den Decks beschäftigt waren.
Dort schenkte zunächst niemand dem verwitterten Fischerboot Beachtung, das unter ihnen auf den Wellen tanzte, bis endlich zwei Männer an die Reling traten. Sie waren mit leichten tarnfarbenen Kampfanzügen bekleidet, studierten einige Sekunden lang die Javina, dann brachten sie Sturmgewehre in Anschlag.
Desmond schob den Gashebel auf volle Kraft und riss das Ruder herum, während er hinter sich auf dem Deck seines Fischerboots ein Poltern hörte. Vor Entsetzen vollkommen gelähmt, starrte sein Neffe auf zwei 40-mm-Gewehrgranaten – abgefeuert von Abschussvorrichtungen an den Läufen der Sturmgewehre –, die über das Deck auf seine Füße zurollten.
Das Steuerhaus löste sich in einem grellroten Feuerball auf. Rauch und Flammen stiegen zu dem warmen karibischen Himmel empor, während sich die Javina tödlich getroffen hin und her wälzte. Das verblichene blau-gelbe Fischerboot, dessen Steuerhaus nur noch eine verkohlte, qualmende Ruine war, stellte sich träge auf den Bug.
Für einen kurzen Moment hielt es inne, zögerte anscheinend, doch dann hob sich das Heck wie zu einem Abschiedsgruß aus dem Wasser und folgte dem Bug auf seinem letzten Weg in die Tiefe.
2
Juli 2016
Mark Ramsey gestattete sich den Anflug eines Grinsens. Er konnte das euphorische Triumphgefühl kaum unterdrücken, während er an der Tribüne vorbeiraste. Der beißende Geruch von Benzin und verbranntem Gummi kitzelte in seiner Nase, während die Anfeuerungsrufe einer kleinen Gruppe Zuschauer neben der Rennbahn über dem Motorengeheul seines Wagens kaum zu hören waren. Es war nicht nur das berauschende Gefühl, über eine freie Piste jagen zu können, das ihn mit unbändiger Freude erfüllte. Es war auch die Führungsposition zwei Runden vor Ende des Rennens, die den reichen kanadischen Industriellen beflügelte.
Mit einem Bugatti-Type-35-Grand-Prix-Rennwagen, Baujahr 1928, war er bei diesem Oldtimer-Rundstreckenrennen als klarer Favorit gestartet. Der leichte und wendige blaue Bugatti mit seinem ikonenhaften hufeisenförmigen Kühlergrill war einer der erfolgreichsten Rennwagen seiner Zeit gewesen. Ramseys aufgeladener Achtzylinder-Reihenmotor verschaffte ihm einen soliden Vorteil gegenüber der Konkurrenz.
Frühzeitig hatte er das Feld mehrerer Oldtimer weit hinter sich gelassen – bis auf einen dunkelgrünen Bentley, der ihn mit einigen Längen Abstand hartnäckig verfolgte. Der schwere englische Wagen mit einer offenen viersitzigen Le-Mans-Karosserie war für den Bugatti in den Steilkurven des Old Dominion Speedway kein ernst zu nehmender Gegner.
Ramsey wusste, dass er es geschafft hatte. Die zweite Kurve hinter sich lassend, trat er das Gaspedal bis aufs Bodenblech durch, raste die Hauptgerade hinunter und überrundete einen Stutz Bearcat. Aus den Augenwinkeln nahm er eine weiße Flagge wahr, die der Starter, der auf einem erhöhten Podest stand, schwenkte, um die letzte Runde anzuzeigen. Ramsey warf einen kurzen Blick auf die Zuschauer und bemerkte nicht, dass der Bentley hinter ihm näher gekommen war.
Bremsend und mit dem bei Rennfahrern üblichen – mit Ferse und Fußspitze ausgeführten – Fußmanöver herunterschaltend, lenkte er den Bugatti auf einer tieferen, engeren Bahn durch die Kurve. Der schwerere Bentley musste eine höhere Bahn nehmen und verlor deutlich an Boden. Als er jedoch aus der Kurve herauskam, nutzte der Bentley das Gefälle der steilen Kurvenwand zum Beschleunigen und stieß auf die Gegengerade hinunter. Ausgerüstet mit einem Rootes-Kompressor, der wie ein Rammbock über den Kasten der Anlasserkurbel hinausragte, heulte der Bentley kampflustig auf, als sein Fahrer das Gaspedal für einen kurzen Moment bis zum Anschlag durchtrat, ehe er hochschaltete.
Ramsey blickte in den Rückspiegel, der in der Mitte des Armaturenbretts angebracht war. Der Bentley, der über einen leistungsstärkeren Motor verfügte, war bis auf zwei Wagenlängen zu dem Bugatti aufgerückt, und sein imposanter Kühlervorbau füllte den Spiegel nun vollständig aus. Auf der Gegengerade behielt Ramsey den Fuß so lange wie möglich auf dem Gaspedal und bremste erst spät und ziemlich hart, ehe er den Bugatti in die letzte Kurve lenkte.
Hinter ihm fiel der Bentley zurück, als dessen Fahrer etwas früher die Bremse betätigte und die Kurve in einem weiten Bogen anschnitt. Die Reifen kreischten und drohten seitlich wegzurutschen, während er den Bugatti durch die Biegung jagte. Der Fahrer des Bentley war kein Anfänger. Er kitzelte alles aus dem Auto heraus und bewegte den schweren Wagen dicht am Limit.
Ramsey umklammerte das Lenkrad mit festerem Griff und prügelte den Bugatti durch die Kurve. Sein spätes Bremsmanöver ließ ihn weit von der Ideallinie entfernt regelrecht durch die Kurve segeln. Während er leicht aufs Bremspedal tippte, um seinen Wagen auf Kurs zu halten, stieß er, als er hörte, wie der Bentley hinter ihm beschleunigte, einen wütenden Fluch aus.
Der Bentley befand sich hoch auf der Kurvenwand, aber sein Fahrer hatte ihn bereits auf einen Geradeauskurs gebracht. Ramsey hingegen hatte die Biegung noch nicht überwunden und konnte erst einen kurzen Moment später das Gaspedal voll durchtreten und dem Druck auf sein Lenkrad nachgeben. Der röhrende Bentley hatte die Lücke fast geschlossen und hing an seiner hinteren Stoßstange, während sie die Zielgerade in Angriff nahmen.
Es war ein klassisches Duell von raffinierter Fahrtechnik gegen brutale Motorkraft. Der 140-PS-Motor des Bugatti war um einhundert Pferdestärken schwächer als der Motor des Bentley, dafür brachte der englische Wagen etwa eine ganze Tonne mehr Gewicht auf die Waage.
Die Geschwindigkeit beider Autos näherte sich der Einhundert-Stunden-Meilen-Marke, als sie sich wie Rennpferde beim Endspurt der Ziellinie entgegenstreckten. Ramsey sah den Starter wild mit der Zielflagge winken und spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte. Der Bugatti hielt noch immer die Spitze, aber der Bentley schob sich Zentimeter für Zentimeter neben ihn. Kotflügel an Kotflügel rasten die beiden antiken Fahrzeuge die Piste hinunter, technische Dinosaurier aus einer eleganteren Epoche.
Die Ziellinie tauchte auf, und jetzt setzte sich die rohe Kraft durch. Der Bentley machte im letzten Moment einen Satz vorwärts und schlug den Bugatti um Kompressorlänge. Während der größere Wagen an ihm vorbeizog, schaute Ramsey zum Cockpit des Bentley hinüber. Der Fahrer, den Ellbogen lässig auf die Türkante gelegt, erschien im Augenblick seines Sieges völlig entspannt. Ramsey verstieß gegen die Benimmregeln und setzte sich an die Spitze des Feldes, als die Rennteilnehmer eine Abkühlrunde fuhren, ehe sie die Boxen aufsuchten.
Dann parkte Ramsey den Bugatti neben seinem luxuriösen Wohn- und Werkstattbus und beaufsichtigte seine Mechaniker-Truppe, während sie den Rennwagen überprüften und in einen geschlossenen Anhänger einluden. Daraufhin beobachtete er, wie der Bentley auf einem freien Boxenplatz in der Nähe ausrollte und anhielt.
Kein Werkstattwagen wartete dort, und kein Techniker-Team nahm den englischen Wagen in Empfang. Lediglich eine attraktive Frau mit zimtbraunem Haar wartete dort auf den Sieger. Sie saß in einem Klappsessel, neben ihren Füßen eine Werkzeugkiste und eine Kühlbox.
Ein großer schlanker Mann stieg aus dem Bentley und wurde von der Frau leidenschaftlich umarmt. Er nahm den Sturzhelm ab und fuhr sich mit den Fingern durch einen dichten, schwarzen Haarschopf, der sein braungebranntes, markantes Gesicht perfekt zur Geltung brachte. Er blickte sich um, während Ramsey auf ihn zuging und eine Hand ausstreckte.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Ramsey und kaschierte seine Enttäuschung. »Das war das erste Mal, dass mich jemand in meinem Bugatti geschlagen hat.«
»Dieses alte Schlachtross muss während der letzten Runde irgendwelche verborgenen Energien aktiviert haben.« Der Fahrer tätschelte den Kotflügel des Bentley. Seine seegrünen Augen hatten fast die gleiche Farbe wie der Bentley und versprühten eine Intelligenz, die Ramsey bisher nur selten bei einem Gesprächspartner vorgefunden hatte. Dieser Mann kostete das Leben in vollen Zügen aus und nahm jede Herausforderung an.
Ramsey lächelte. Ihm war klar, dass er eher von dem Mann und nicht von dem Wagen besiegt worden war.
»Mein Name ist Mark Ramsey.«
»Dirk Pitt«, stellte sich der Fahrer vor. »Dies ist meine Frau, Loren.«
Ramsey wechselte einen Händedruck mit Loren und stellte dabei fest, dass sie aus der Nähe betrachtet noch um einiges attraktiver war.
»Ich liebe Ihren Bugatti«, sagte sie. »Zu seiner Zeit war das ein Symbol für technische Perfektion und Eleganz.«
»Und ihn zu fahren ist ein einziges Vergnügen«, sagte Ramsey. »Dieser Wagen hat 1928 die Targa Florio gewonnen.«
Während er diese Information weitergab, schoben seine Mechaniker den französischen Boliden in den Laderaum eines Sattelschleppers. Loren erkannte das Logo auf der Seitenfläche des Lasters: ein roter Grizzly mit einer Spitzhacke zwischen den Zähnen.
»Mark Ramsey … Sie sind der Inhaber von Bruin Mining and Exploration.«
Ramsey musterte Loren misstrauisch. »In den Vereinigten Staaten kennen mich nicht sehr viele Leute.«
»Ich gehörte zu einer Delegation, die vor kurzem Ihre Goldmine am Thompson River in British Columbia besichtigt hat. Wir waren von dem Umweltbewusstsein, mit dem diese Anlage betrieben wird, tief beeindruckt.«
»Der Bergbau hat von jeher einen schlechten Ruf, aber es spricht nichts gegen den Versuch, das zu ändern. Sitzen Sie im Kongress?«
»Ich vertrete den Seventh District of Colorado.«
»Natürlich, Congresswoman Loren Smith. Ich bedaure, ich war nicht in der Stadt, als die Kongressdelegation ihre Rundreise machte. Mein Pech, darf ich wohl sagen. Weshalb haben Sie sich ausgerechnet für mein Unternehmen interessiert, wenn ich fragen darf.«
»Ich arbeite im Unterausschuss für Umweltfragen. Dort suchen wir zurzeit nach neuen Wegen zur schonenden Nutzung unserer natürlichen Ressourcen.«
»Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann. Wir stehen umweltfreundlichen Methoden des Bergbaus stets aufgeschlossen gegenüber.«
»Das ist sehr lobenswert.«
Pitt klappte Lorens Sessel zusammen und verstaute ihn im Kofferraum des Bentley. »Mr. Ramsey, dürfen wir Sie heute Abend zum Dinner einladen?«
»Darauf werde ich wohl verzichten müssen, da ich mit der nächsten Maschine nach Miami zurückkehren muss, um ein paar Kunden zu treffen. Vielleicht klappt es, wenn ich das nächste Mal in Washington bin.« Er sah Pitt herausfordernd an. »Ich würde es gern noch einmal mit Ihnen und Ihrem Bentley aufnehmen.«
Pitt lächelte. »Warum nicht? Zu einem anständigen Wettrennen bin ich jederzeit bereit.«
Pitt stieg ein und startete den Bentley. Gleichzeitig machte es sich Loren auf dem Beifahrersitz bequem.
Irritiert schüttelte Ramsey den Kopf. »Haben Sie keinen Transporter?«
»Der Bentley ist im normalen Straßenverkehr genauso gut wie auf der Rennpiste«, meinte Pitt grinsend und gab Gas. Beide Insassen winkten zum Abschied, während Ramsey ihnen mit einem Anflug von Neid nachblickte.
Loren sah Pitt belustigt von der Seite an. »Ich glaube nicht, dass Mr. Ramsey von deiner Boxentruppe besonders beeindruckt war.«
Pitt streckte eine Hand aus und tätschelte ein Knie seiner Frau. »Was redest du da? Ich habe schließlich die aufregendste Chefingenieurin auf dem Planeten.«
An der Einfahrt holte er den Siegerpokal ab, dann verließen sie das Rennbahngelände in Manassas, Virginia. Nachdem sie ein als Gedenkstätte hergerichtetes Bürgerkriegsschlachtfeld passiert hatten, bogen sie auf die Interstate 66 in Richtung Washington, D. C., ein. Der Sonntagnachmittagsverkehr hielt sich in Grenzen, und Pitt konnte den Wagen die meiste Zeit bis auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beschleunigen.
»Ich hab völlig vergessen, dir Bescheid zu sagen«, rief Loren, um den Lärm des Fahrtwinds in dem offenen Wagen zu übertönen. »Während du auf der Piste warst, hat Rudi Gunn angerufen. Er muss über etwas mit dir reden, das er zurzeit in der Karibik beobachtet.«
»Kann es bis morgen warten?«
»Er hat aus dem Büro angerufen, also habe ich ihm versprochen, wir würden auf der Heimfahrt vorbeikommen.« Loren lächelte versonnen. Sie wusste, dass sein zur Schau gestelltes Desinteresse ein Bluff war.
»Dein Wort ist mir Befehl.«
Als Pitt den Vorort Rosslyn erreichte, bog er auf den George Washington Parkway ab und folgte ihm nach Süden am Potomac entlang. Der weiße Marmorbau des Lincoln Memorial schimmerte im verblassenden Sonnenschein, während er den Bentley in die Einfahrt eines imposanten Gebäudes mit grün verglasten Fronten lenkte. Er passierte die Wächterloge und parkte in einer Tiefgarage in der Nähe eines nur mit Magnetkarte benutzbaren Fahrstuhls, mit dem er und seine Frau in den zehnten Stock hinauffuhren.
Sie befanden sich in der Hauptverwaltung der National Underwater and Marine Agency, jener staatlichen Behörde, deren Aufgabe in der Überwachung und dem Schutz der Ozeane bestand. Als Direktor der NUMA unterstand Dirk Pitt ein umfangreicher Stab von Meeresbiologen, Ozeanografen und Geologen, die die Weltmeere mit Hilfe einer rund um den Globus stationierten Flotte von Forschungsschiffen kontrollierten. Die Agency benutzte außerdem Bojen, Tonnen, bewegliche oder stationäre Unterwasserfahrzeuge und sogar ein kleines Flugzeuggeschwader. Sie alle waren mit einem leistungsfähigen Satellitennetzwerk verbunden, das eine fast realzeitgetreue ständige Beobachtung des Wettergeschehens, des Seegangs und sogar von Ölteppichen gestattete.
Die Fahrstuhltüren öffneten sich zu einer mit Hightech gefüllten Halle, die das Hochleistungs-Computerzentrum der Agency beherbergte. Ein leise summender IBM-Blue-Gene-Supercomputer verbarg sich hinter einer hohen gekrümmten Wand, vor der Loren und Pitt stehen blieben. Die Wand selbst war ein riesiger Videoschirm, auf dem ein Dutzend Farbgrafiken und Bilder zu sehen waren.
Zwei Männer saßen an einem zentralen Kontrolltisch vor der Videowand. Der kleinere der beiden, ein drahtiger Mann mit Hornbrille, bemerkte Loren und Dirk Pitt und ging eilig zu ihnen hinüber, um sie zu begrüßen.
»Schön, dass ihr kommen konntet«, sagte Rudi Gunn lächelnd. Er war ein ehemaliger Navy-Commander, der als Bester seiner Klasse die United States Naval Academy absolviert hatte und den Posten des stellvertretenden Direktors der von Dirk Pitt geleiteten NUMA bekleidete. »Wie war das Rennen?«
»Ich glaube, wenn W. O. Bentley noch leben würde, würde er heute sehr stolz auf mich sein«, sagte Pitt mit einem Siegerlächeln. »Was hat euch beide denn an einem Sonntag ins Büro gelockt?«
»Ein Umweltproblem im Karibischen Meer. Südlich von Kuba sind wir auf eine ungewöhnliche Ansammlung toter Zonen im Ozean gestoßen, aber Hiram kann dir das genauer erläutern.«
Die drei gingen zu einem Arbeitstisch hinüber, an dem Hiram Yaeger, der Chef des Computernetzwerks der NUMA, saß und auf einer Tastatur tippte.
»Hallo«, sagte er, ohne aufzuschauen. »Nehmt Platz.«
Yaeger, der den Nonkonformismus offenbar zu seinem Lebensmotto gemacht hatte, hatte sein langes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengerafft. Seiner Kleidung nach zu urteilen war er direkt aus einer Biker Bar an seinen Arbeitsplatz geeilt. »Tut mir leid, euer Wochenende zu stören, aber Rudi und ich dachten, dass du sofort erfahren solltest, was wir auf den jüngsten Satellitenbildern entdeckt haben.«
BP
»Genau das ist unsere Sorge«, sagte Rudi Gunn. »Wenn sich diese toten Zonen mit dem Tempo im Golf von Mexiko ausbreiten, wie wir es auf den Bildern beobachten können, dürften die Folgen verheerend sein.«
Pitt nickte. »Wir müssen schnellstens in Erfahrung bringen, wodurch sie entstehen. Was melden denn unsere hydrographischen Bojen?«
Yaeger öffnete ein neues Fenster auf der Videowand, in dem eine schematische Darstellung des Globus erschien. Hunderte von blinkenden Lichtpunkten waren auf der Karte verstreut und zeigten die Positionen der Forschungsbojen an, die die NUMA auf den Weltmeeren verteilt hatte. Die Bojen maßen Wassertemperatur, Salzgehalt und Seegang, sendeten die Daten an die jeweils nächsten Satelliten, von wo aus sie in Yaegers Computerzentrum hinuntergeladen wurden. Er vergrößerte das Karibische Meer mit den dort stationierten Bojen. Keine befand sich in der Nähe der toten Zonen.
»Ich fürchte, aus diesem Bereich stehen uns keine Daten zur Verfügung«, sagte Yaeger. »Ich habe die Messungen der Bojen überprüft, die dem Gebiet am nächsten sind, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen.«
»Wir müssen uns also an Ort und Stelle informieren«, sagte Pitt. »Was ist mit unseren Forschungsschiffen?«
»Ich könnte die Sargasso Sea anbieten.« Yaeger rief eine Seekarte auf, die die jeweiligen Positionen der NUMA-Forschungsschiffe zeigte.
»Sie liegt in Key West und dient als Basis für ein Unterwasser-Technologie-Projekt, das Al Giordino leitet«, sagte Gunn. »Soll ich ihn anrufen und mit dem Schiff in Marsch setzen?«
Yaeger verdrehte die Augen. »Al wird begeistert sein.«
Pitt betrachtete die Seekarte. »Nein, das wird nicht nötig sein.«
Loren sah den Ausdruck in den Augen ihres Mannes und wusste genau, was in diesem Moment in seinem Kopf vorging.
»O nein.« Sie verzog das Gesicht und schüttelte verzweifelt den Kopf. »Nicht schon wieder dieser Lockruf der Tiefe.«
Pitt sah seine Frau an, als wüsste er nicht, was sie meinte, und lächelte unschuldig.