

Lust auf mehr?
www.dressler-verlag.de
www.dressler-verlag.de/ebooks
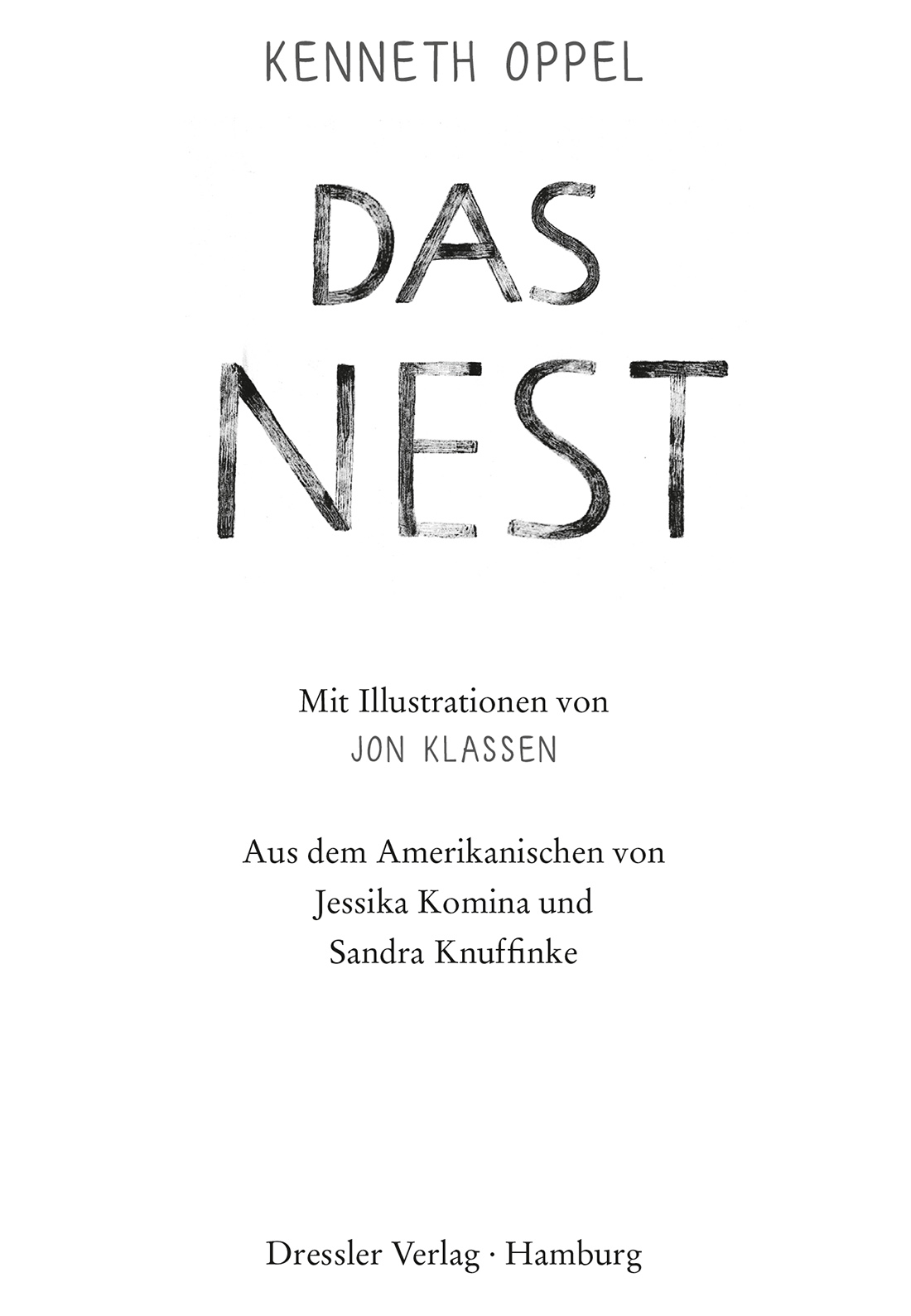
Für Julia, Nathaniel und Sophia


Als ich sie zum ersten Mal sah, hielt ich sie für Engel. Was hätten sie auch sonst sein sollen, mit diesen bleichen, durchscheinenden Flügeln, der sonderbaren Musik, die von ihnen ausging, und dem hellen Licht, das sie umgab? Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass sie auf etwas warteten, dass sie mich beobachteten, mich kannten. Sie erschienen mir im Traum, in der zehnten Nacht nach der Geburt des Babys.
Alles wirkte ein bisschen unscharf. Ich stand in einer wunderschönen Höhle mit schimmernden Wänden wie aus weißem, von außen beleuchtetem Stoff. Die Engel blickten auf mich herab, schwebten über mir in der Luft. Nur einer von ihnen kam näher, grell und strahlend. Ich weiß nicht, warum, aber mir war sofort klar, dass es eine Sie war. Die Helligkeit strömte aus ihr heraus, sie wirkte verschwommen und irgendwie kein bisschen menschlich. Ich erkannte riesige, dunkle Augen und eine Art Mähne aus Licht, und als sie sprach, sah ich nicht, wie sich ihr Mund bewegte. Stattdessen spürte ich ihre Stimme wie einen Windhauch im Gesicht und ich verstand jedes Wort.
»Wir sind wegen des Babys gekommen«, sagte sie. »Wir sind hier, um zu helfen.«

Mit dem Baby stimmte etwas nicht, aber keiner konnte sagen, was es war. Wir nicht, und die Ärzte auch nicht. Nach einer Woche durften Mom und Dad es mit nach Hause nehmen, aber sie mussten fast jeden Tag wegen irgendwelcher Untersuchungen wieder mit ihm ins Krankenhaus. Wenn sie danach zurückkamen, gab es immer ein paar neue Informationen, immer neue Theorien.
Es war kein Virus oder irgendwas, wovon sich das Baby früher oder später erholen würde. So eine Krankheit war das nicht. Vielleicht würde sie nie weggehen. Vielleicht würde der Kleine nie sprechen. Nie laufen. Nie ohne Hilfe essen. Vielleicht würde er nicht mal überleben.
Kurz nach der Geburt des Babys war Dad nach Hause gekommen und hatte mir erklärt, was mit ihm los war. Dass etwas mit seinem Herzen und seinen Augen und seinem Gehirn nicht stimmte und es wahrscheinlich operiert werden musste. Es schien eine ganze Menge nicht zu stimmen mit dem Baby.
Vermutlich waren da noch andere Sachen, die Mom und Dad mir nicht erzählten – und Nicole erzählten sie erst recht nichts. Nicole dachte einfach, dass das Baby alle seine Impfungen auf einmal bekam und alles ganz normal war – dass alle Babys jeden Tag ins Krankenhaus und auch immer mal wieder über Nacht bleiben mussten.
Abends, wenn meine Eltern sich leise unterhielten, schnappte ich manchmal einzelne Wörter und Satzfetzen auf.
»… sehr selten …«
»… schlechte Prognose … wissen sie nicht …«
»… degenerativ?«
»… kann niemand mit Sicherheit sagen …«
»… genetisch bedingt …«
»… waren wir zu alt, hätten es nicht versuchen sollen …«
»… nichts damit zu tun …«
»… die Ärzte können es nicht genau sagen …«
»… sicher nicht normal entwickeln …«
»… können wir nicht wissen … niemand weiß …«
Tagsüber schlugen Mom und Dad ständig irgendwas in Büchern nach oder suchten im Internet und lasen und lasen. Manchmal schien sie das glücklicher zu machen, andere Male trauriger. Ich hätte gern gewusst, was sie dabei so Spannendes erfuhren, aber sie redeten fast nie darüber.

Ich dachte oft an meinen Traum mit den Engeln, aber ich erzählte niemandem davon. Schließlich wusste ich selbst, dass der Traum Unsinn war, aber irgendwie fühlte ich mich dadurch auch besser.
Es war ein schlimmer Wespensommer. Das sagte jeder. Normalerweise kamen sie erst im August, aber dieses Jahr waren sie früh dran. Dad hatte noch nicht mal seine künstlichen Nester aus Papier aufgehängt. Nicht, dass die jemals viel gebracht hatten. In einem Jahr hatten wir mal so eine Falle ausprobiert. Sie war zur Hälfte mit Limonade gefüllt und lockte die Wespen an, die dann nicht mehr herauskamen und ertranken. Drinnen stapelten sich die toten Tiere nur so. Ich hasste Wespen, aber selbst ich fand dieses klebrige Wespengrab gruselig, mit den paar Überlebenden, die über die anderen krabbelten und vergeblich nach einem Ausgang suchten. Ich musste dabei immer an dieses alte Gemälde mit einem Bild aus der Hölle denken, das ich mal im Museum gesehen und nie wieder vergessen hatte. Jedenfalls surrten in diesem Sommer haufenweise gelb-schwarz gestreifte Plagegeister um unseren Tisch, hauptsächlich um die Kanne mit Eistee. Ich behielt sie sorgsam im Auge.
Es war Sonntag und wir saßen auf der Veranda hinter dem Haus. Alle waren müde. Keiner redete viel. Das Baby schlief oben in seinem Zimmer, und auf dem Tisch zwischen uns stand das Babyfon, die Lautstärke voll aufgedreht, damit wir jeden Atemzug, jedes Glucksen hören konnten. Im Schatten des Sonnenschirms tranken wir unseren Eistee. Nicole spielte auf dem Rasen, wo Mom eine große Decke für sie ausgebreitet hatte. Gerade ließ sie eine Armee aus Actionfiguren eine LEGO-Burg stürmen. Um sie herum lagen ihre Ritter, eine große Kiste mit LEGO-Steinen und ihr Spielzeugtelefon. Sie liebte dieses Telefon. Es war altmodisch und aus Plastik und zum Wählen musste man tatsächlich noch so eine durchsichtige Plastikscheibe drehen. Es hatte mal Dad gehört, als er noch klein gewesen war, aber es war kein bisschen kaputt oder so. Dad sagte immer, er sei früher sehr gut mit seinen Spielsachen umgegangen.
Auf einmal stoppte Nicole mitten in ihrer Burgeroberung und nahm den Hörer ab, als hätte das Telefon geklingelt. Sie redete kurz, lachte einmal und runzelte dann die Stirn, wie ein Arzt, der ernste Neuigkeiten übermittelt bekommt. Dann sagte sie »Okay« und legte auf.
»Wie geht’s Herrn Niemand?«, rief ich ihr zu.
»Gut«, antwortete Nicole.
Herr Niemand war eine Art Insiderwitz in unserer Familie. Vor ungefähr einem Jahr, kurz bevor Mom schwanger geworden war, bekamen wir jeden Tag mindestens einen Anruf, bei dem am anderen Ende der Leitung nur Schweigen zu hören war. Wenn wir abnahmen, war einfach keiner dran. Wer war das? Niemand. Dad beschwerte sich bei den Leuten von der Telefongesellschaft, die ihm versprachen, sich um die Sache zu kümmern. Aber die Anrufe hörten nicht auf, also wechselten wir irgendwann unsere Telefonnummer, woraufhin eine Weile Ruhe war. Ein paar Wochen später jedoch ging es von vorne los.
Nicole nannte ihn Herr Niemand. Herr Niemand finde es halt lustig, uns anzurufen und nichts zu sagen. Herr Niemand sei einfach ein bisschen einsam. Und spiele gern Streiche. Er brauche Freunde. Nicole betete sogar abends für ihn. »Und segne auch Herrn Niemand«, sagte sie dann immer.
»Und, hat er was Lustiges erzählt, Nicole?«, fragte ich von der Veranda aus. »Gibt’s was Neues?«
Nicole verdrehte die Augen, als wäre ich völlig bescheuert.
Zwei Wespen schwirrten um den Rand meines Glases. Ich schob es zur Seite, doch die Tiere ließen sich nicht abwimmeln; sie liebten süße Getränke. Ich war noch nie gestochen worden, aber Wespen versetzten mich in totale Panik, das war schon immer so gewesen. Ich wusste, dass das total albern war, aber sobald sie in meine Nähe kamen, füllte sich mein Kopf mit einem lauten Rauschen und ich konnte nur noch wild um mich schlagen.
Einmal, bevor das Baby auf der Welt war, hatten wir eine Wandertour auf den Mount Maxwell gemacht und gerade die Aussicht bestaunt, als mir plötzlich eine Wespe um den Kopf summte und einfach nicht von mir wegwollte. Ich war einfach losgerannt, schnurstracks auf den Abgrund zu. Dad hatte mich im letzten Moment gepackt und mich angeschrien, ich hätte tot sein können. »Jetzt reiß dich mal zusammen«, hatte er geschimpft. Diese Worte schossen mir nun jedes Mal durch den Kopf, wenn ich eine Wespe sah. Reiß dich zusammen. Es gab eine Menge Situationen in meinem Leben, in denen ich mich besser zusammengerissen hätte. Aber in so was war ich nun mal einfach nicht besonders gut.
Eine dritte Wespe kam angeflogen und diese sah völlig anders aus. Statt schwarz-gelb war sie hauptsächlich weiß mit ein paar silbrig-grauen Streifen. Sie hatte die gleiche Form wie die anderen, nur ein kleines bisschen größer war sie vielleicht. Die beiden schwarz-gelben brummten davon und die weiß-silberne setzte sich auf den Rand von meinem Glas.
Als ich versuchte, sie zu verscheuchen, schwirrte sie plötzlich direkt auf mein Gesicht zu, und ich sprang so blitzartig von meinen Stuhl auf, dass er krachend hinter mir umfiel.
»Lass sie einfach in Ruhe, Steve«, sagte mein Vater. »Wenn du so ein Theater machst, sticht sie dich nur.«
Aber ich konnte nicht anders. Besonders schlimm fand ich es, wenn sie meinem Gesicht zu nahe kamen.
»Wo ist sie?«, rief ich.
»Sie ist längst wieder weg«, sagte Mom.
War sie nicht. Ich konnte spüren, wie sie mir über die Haare krabbelte.
Schreiend schlug ich nach ihr und mit einem Mal breitete sich eine brennende Hitze in meiner Handfläche aus. Ich zog die Hand zurück. Unterhalb des Daumens prangte ein leuchtend roter Punkt und die Haut dort fühlte sich heiß an.
»Hat sie dich gestochen?«, fragte meine Mutter.
Ich konnte nicht antworten. Ich konnte bloß starren.
»Das kommt davon«, brummte Dad, der hinter mich getreten war, um einen Blick auf meine Hand zu werfen. »Na los, wir gehen rein und lassen erst mal Wasser drüberlaufen.«
Die untere Hälfte meiner Hand begann, sich taub anzufühlen, so wie an einem eiskalten Wintertag, wenn man nach Hause kam und einem auf einen Schlag warm wurde.
»Sieht ein bisschen geschwollen aus«, sagte Dad.
Wie benommen verglich ich meine beiden Hände miteinander. »Die ist viel röter als die andere.«
»Das wird schon wieder.«
Danach fühlte es sich aber nicht an. Brennende Hitze durchzuckte mich. Es begann mitten auf meinem Rücken und strahlte dann aus bis in meine Schultern und Arme. Ich spürte, wie mein Herz zu rasen anfing.
»Mir ist ganz komisch.« Ich setzte mich hin.
»Meinst du, er ist vielleicht allergisch?«, hörte ich meine Mutter besorgt fragen. Sie deutete mit dem Finger. »Schau mal.«
Unter meinem T-Shirt-Ärmel war ein fleckiger Ausschlag zu sehen.
»Juckt das?«, fragte Dad.
»Ich weiß nicht«, antwortete ich schwach.
»Juckt es oder nicht?«, hakte er ungeduldig nach.
»Ja! Es juckt!«
»Seine Hand ist auch ganz schön dick geworden«, bemerkte Mom. »Vielleicht sollten wir ihn lieber untersuchen lassen.«
»Du meinst, im Krankenhaus?« Allein das Wort auszusprechen, fühlte sich an, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. Mein Herz wummerte. Mir war schrecklich heiß. »Muss ich jetzt sterben?«
Dad seufzte. »Nein, Steve, du musst nicht sterben. Du bist in Panik, das ist alles. Jetzt mal ganz tief durchatmen, Kumpel, okay?«
Ich war froh, dass Dad sich nicht allzu viele Sorgen zu machen schien, er wirkte eher erschöpft. Wenn er genauso ängstlich ausgesehen hätte wie Mom, wäre ich wahrscheinlich komplett durchgedreht.
»Warum mieten wir uns nicht gleich fest im Krankenhaus ein?«, seufzte er.
Bis zum Krankenhaus war es nicht weit, und die Schwester, bei der wir uns anmeldeten, hielt mich anscheinend für keinen sonderlich dringenden Fall. Sie gab mir ein Antiallergikum und wir suchten uns einen Platz im überfüllten Wartezimmer. Dad las eine Zeitschrift, aber ich fasste lieber nichts an, für den Fall, dass irgendwo Keime lauerten. Ich sah die anderen Wartenden an. Die meisten machten keinen besonders kranken Eindruck, aber sie mussten krank sein, warum hätten sie sonst hier sein sollen? Und dann war es auch gut möglich, dass sie etwas hatten, womit ich mich anstecken konnte. Ungefähr alle fünfzehn Minuten ging ich auf die Toilette, um mir die Hände zu waschen. Anschließend rieb ich sie mir gründlich mit Desinfektionsmittel aus dem Spender an der Wand ein. Ich versuchte, ganz flach zu atmen, um nicht zu viel von der Krankenhausluft in mich aufzunehmen. Wir mussten ein paar Stunden warten, und als mich schließlich ein Arzt untersuchte, war der Ausschlag auf meinem Arm schon fast weg und meine Hand nicht mehr ganz so dick.
»Du hattest eine leichte bis mittelschwere allergische Reaktion«, erklärte er. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen und sah mich beim Reden kaum an; wahrscheinlich hatte er an diesem Tag einfach schon genug Leute angesehen. »Aber wenn du das nächste Mal gestochen wirst, könnte es schlimmer werden. Darum verschreibe ich dir jetzt einen EpiPen, das ist eine Allergiespritze für den Notfall.«
Ich wusste, was ein EpiPen war. Ich war mal im Lehrerzimmer meiner Schule gewesen und hatte dort eine ganze Pinnwand voll mit durchsichtigen Plastiktüten gesehen, jede mit dem Namen und dem Foto eines Schülers und dessen EpiPen darin.
»Sie sollten vielleicht auch eine Reihe von Hyposensibilisierungs-Impfungen für ihn in Erwägung ziehen, dann bräuchten Sie den EpiPen bald gar nicht mehr.«
Draußen auf dem Parkplatz, als Dad hinter dem Lenkrad saß, seufzte er tief, bevor er den Schlüssel ins Zündschloss steckte. Das hier war das Krankenhaus, in dem auch das Baby geboren war. Das Krankenhaus, zu dem Mom und Dad immer noch fast jeden Tag mit ihm fahren mussten.
Auf dem Heimweg redeten wir nicht viel. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich gestochen worden war und Dad mich ins Krankenhaus hatte bringen müssen. Er sah so müde aus. Ein paarmal drehte er sich zu mir um und fragte, wie es mir gehe, und ich sagte, alles in Ordnung und er nickte und lächelte. Schließlich tätschelte er mir das Knie.
»Tut mir leid, dass ich vorhin so ungeduldig war«, sagte er.
»Schon okay.«
»Wir machen so bald wie möglich einen Termin für diese Hyposensibilisierungs-Geschichte aus.«
Ich war zwar nicht gerade wild darauf, mich regelmäßig von Spritzen piksen zu lassen, aber ich sagte trotzdem: »Danke.«
In dieser Nacht schlief ich tief – und sah zum ersten Mal die Engel.
Ich habe immer noch Angst im Dunkeln. Wenn ich ins Bett gehe, ziehe ich mir die Decke bis über den Kopf und lasse nur ein winziges Loch frei, durch das ich atmen, aber nicht nach draußen sehen kann. Ich will gar nicht wissen, was es da zu sehen gibt. So schlafe ich schon, solange ich denken kann. Es ist mir ein bisschen peinlich und ich erzähle niemandem davon. Ich habe auch oft Albträume. Zu den schlimmsten gehört der, bei dem ich mitten in der Nacht aufwache, immer noch unter der Decke verkrochen, aber genau weiß, dass jemand am Fußende meines Betts steht. Ich habe zu viel Angst, um mich zu bewegen oder zu schreien, und dann höre ich jedes Mal ein Geräusch wie von zerreißendem Papier und jemand zieht mir mit einem Ruck die Decke weg. Ich spüre, wie sich ihr Gewicht von mir hebt, den plötzlichen kalten Luftzug, und ich weiß, dass ich dem, wer oder was auch immer da draußen lauert, hilflos ausgeliefert bin. Und dann wache ich endlich richtig auf.
Als ich noch klein war, habe ich sofort nach meiner Mom gerufen. Immer nur Mom, und sie ist gekommen, hat sich an mein Bett gesetzt und mich getröstet. Manchmal blieb sie so lange sitzen, bis ich wieder eingeschlafen war. Manchmal aber ging sie auch schon nach ein paar Minuten zurück in ihr eigenes Bett und sagte, ich solle sie rufen, wenn noch etwas sei. Dann kroch ich zurück unter meine Decke und gab mir richtig viel Mühe, wieder einzuschlafen.
Damals lief im Fernsehen eine Sendung, die ich sehr mochte, da ging es um eine Gruppe Agenten mit einem Geheimlabor. Um hineinzukommen, zogen sie an einem Hebel, woraufhin sich ein Teil des Bodens langsam nach unten senkte und sie in ihr unterirdisches Versteck brachte. Ich wünschte mir, mein Bett würde genauso funktionieren. Dass ich, immer wenn ich Angst hatte, einfach einen Knopf drücken müsste, mein Bett abwärtsfahren und der Boden sich über mir schließen würde, sodass niemand zu mir durchkam. Niemand mir etwas tun konnte. Sodass ich sicher und unerreichbar in meinem kleinen Nest saß.
Aber ich hatte kein solches Bett. Also lauschte ich auf das Knarzen und Knacken des Hauses, das jede Nacht seine Arbeiten erledigte – die Heizung in Gang halten, den Kühlschrank kühl und all das andere geheime Zeugs. Ich versuchte, wieder einzuschlafen. Aber manchmal klappte es einfach nicht. Dann spürte ich sie wieder, diese Gestalt in meinem Zimmer, dieses Wesen, das mich vom anderen Ende meines Betts aus beobachtete, und rief nach Mom. Und wenn Mom dann ins Zimmer geeilt kam, tat sie endlich das, worauf ich schon die ganze Zeit gewartet hatte – sie fragte mich, ob ich bei ihnen schlafen wolle. Als ich noch kleiner war, schlief ich ziemlich oft bei ihnen im Bett. Ich lag neben Mom, ganz am Rand der Matratze, und versuchte, so wenig Platz wie möglich einzunehmen, damit sie bloß nicht auf die Idee kamen, mich zurück in mein Zimmer zu schicken.
Meinen Freunden erzählte ich nie davon, natürlich nicht. Davon, dass ich Angst im Dunkeln hatte. Von meinen Albträumen. Davon, wie oft ich im Bett meiner Eltern geschlafen hatte.
In der Nacht nach dem Wespenstich spürte ich im Schlaf den Albtraum heraufziehen wie eine Gewitterwolke am Horizont. Eine dunkle Gestalt erschien am Fußende meines Betts. Sie stand einfach da und beobachtete mich.
Aber dann geschah etwas Seltsames. Ich hörte ein Geräusch, eine Art leises, melodisches Trillern, und im selben Moment leuchteten kleine Lichtpunkte auf. Und das wusste ich, weil ich hinsah – weil ich zum allerersten Mal in meinem Traum den Kopf gehoben hatte und hinsah. Immer mehr winzige Lichtpunkte umringten die Gestalt, sie landeten auf ihr, bis sich die Dunkelheit auflöste und verschwand. Ich war so erleichtert.
Plötzlich war ich in einem hellen, höhlenartigen Raum. Ich lag auf dem Bauch und vor mir erklang ihre Stimme.
»Wir sind wegen des Babys gekommen«, sagte sie. »Wir sind hier, um zu helfen.«
»Wer ist denn wir?«, fragte ich.
»Wir kommen immer dann, wenn Menschen Angst oder Probleme haben. Wir kommen, wenn sie traurig sind.«
Ich sah mich um und betrachtete all die schimmernden Wesen an den Wänden und in der Luft.
»Seid ihr Engel?«
»Du kannst uns ruhig so nennen.«
Ich stand auf und versuchte, einen genaueren Blick auf die Gestalt direkt vor mir zu erhaschen. Ihr Kopf allein schien genauso groß zu sein wie ich. Sie war gigantisch. Sie erinnerte mich an den ausgestopften Löwen im Naturkundemuseum, nur dass ihre Mähne und Schnurrhaare aus Licht bestanden, ihre Augen riesig waren und sie keinen Mund zu haben schien. Ich wusste nur, dass jedes Mal, wenn sie sprach, etwas mein Gesicht streifte, und es roch nach frisch gemähtem Gras.
»Also«, sagte sie dann, »was mich als Erstes interessieren würde: Wie geht es dir?«
»Ganz gut, glaube ich.«
Sie nickte geduldig und wartete.
»Alle machen sich Sorgen um das Baby«, fügte ich hinzu.
»Es ist schlimm, wenn so etwas passiert«, erwiderte sie. »Aber tröste dich, das ist nicht ungewöhnlich. Ihr seid nicht allein damit.«
»Nein, kann sein.«
»Und deine kleine Schwester? Wie geht es der?«
»Die nervt, wie immer.« Langsam entspannte ich mich ein wenig.
»Ach ja. Typisch kleine Schwestern.«
»Ich glaube, sie versteht gar nicht, dass das Baby krank ist. Wirklich krank.«
»Das kann gut sein. Und was ist mit deinen Eltern?«
»Die machen sich ganz dolle Sorgen.«
»Verständlich.«
»Und sie haben Angst.«
»Kein Wunder. Nichts ist beängstigender, als ein krankes Kind zu haben, noch dazu wenn es so klein ist, so hilflos. Es ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Und darum wollen wir euch helfen. Wir bringen Dinge in Ordnung.«
»Wie denn? Könnt ihr das Baby etwa heilmachen?«
»Sozusagen.«
»Aber es weiß doch keiner, was genau mit ihm nicht stimmt.«
»Wir schon.«
»Wissen Engel denn alles?«
Sie lachte. »›Alles‹ ist vielleicht ein bisschen übertrieben! Aber wir wissen auf jeden Fall genug, um sagen zu können, was mit dem Baby nicht stimmt. Es hat einen genetischen Defekt.«
»Was heißt das?«
»Dass es schon krank auf die Welt gekommen ist. Und jetzt mach dir nicht gleich wieder Sorgen – ich weiß, du bist ein kleiner Grübler –, es ist nichts, womit du dich anstecken kannst oder was irgendwann auch bei dir ausbrechen könnte.«
Ich fragte mich, woher sie wohl wusste, dass ich ein Grübler war. Aber wahrscheinlich wussten Engel einfach alles Mögliche, ohne dass man es ihnen erst erzählen musste.
Sie sagte: »In ihm steckt ein winzig kleiner Fehler und den können wir beheben.«
»Das könnt ihr?«, stieß ich erleichtert hervor.
»Du weißt doch bestimmt, was eine DNA ist, oder?«
Davon hatte ich im Biounterricht gehört: Das waren diese winzigen Teile im Inneren unserer Zellen, die aussahen wie in sich gedrehte Leitern und uns zu dem machten, was wir waren.
»Nun«, fuhr sie fort, »manchmal geraten diese Teilchen ein bisschen durcheinander. Schon der kleinste Fehler kann zu riesigen Problemen führen. Menschen sind innen ganz schön kompliziert.«
»Wann?«, fragte ich. »Wann könnt ihr das machen?«
»Bald. Du wirst schon sehen.«
Und dann wachte ich auf.

Ich wartete drei Tage, bevor ich Mom von dem Traum erzählte.
Zuerst hatte ich es gar nicht vor, weil ich nämlich ziemlich oft komisch träumte und sie sich manchmal Sorgen deswegen machte, also hatte ich irgendwann aufgehört, ihr davon zu erzählen. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machte. Ich wollte nicht, dass sie mich für merkwürdig hielt. Aber heute sah sie so müde aus, als sie das Baby fütterte, und ich dachte, vielleicht würde sie dieser eine Traum ja ein bisschen trösten. Sie lächelte, als ich darüber redete, aber es war ein trauriges Lächeln. »Du hattest schon immer die wunderlichsten Träume«, sagte sie.
»Vielleicht bedeutet er ja aber, dass alles gut wird.«