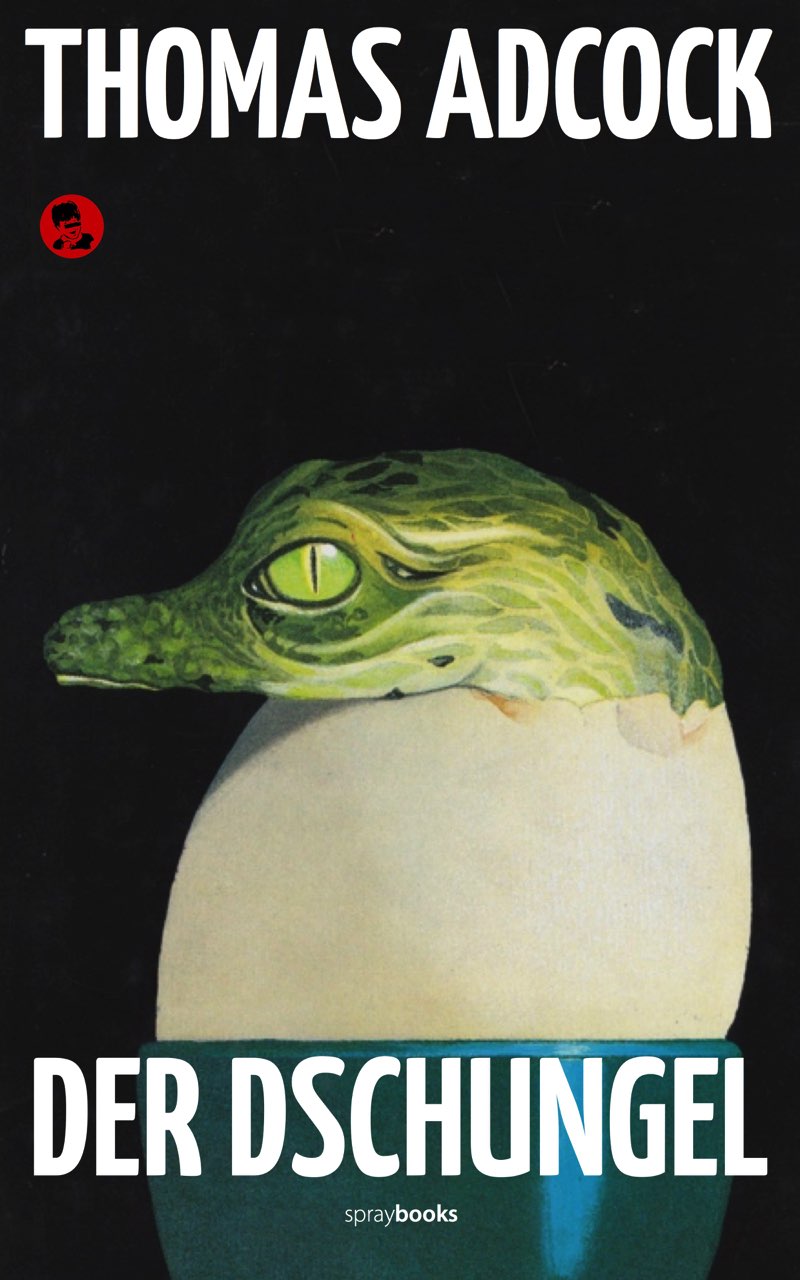Es war Freitagnachmittag, der 9. November, um Viertel nach vier und einer dieser trüben, grauen Tage, an denen die Stadt wie eine Sammlung von Schnappschüssen aus den vierziger Jahren aussieht – diese quadratischen Dinger mit den gebogenen Rändern. Ich hatte mich in meiner neuen Wohnung eingerichtet, war seit etwa zehn Tagen wieder im Dienst. Ich saß gerade vor einem großen Stapel Festnahmeprotokollen in einem winzigen Büro, in dem man Platzangst kriegen konnte, im ersten Stock des Midtown-North Reviers, zu dem ich bis Silvester abkommandiert war.
Auf der einen Seite befand sich die Toilette, auf der anderen der Aufenthaltsraum, in dem ungefähr zwei Dutzend uniformierte Cops Sandwiches aus Papiertüten vertilgten und sich einen Film auf WOR-TV ansahen – Gorilla at Large, mit Lee J. Cobb, Cameron Mitchell, Raymond Burr und Lee Marvin. Bei dem Film ging es um einen mutierten Zirkusgorilla, der gern Menschen biss und auf sie eindrosch, und um die Dreiecksbeziehung zwischen der schönen Trapezartistin, dem zwielichtigen Zirkusdirektor und einem ernsten jungen Hauptdarsteller, der offenbar als einziger Mensch auf der Welt glaubte, dass der Gorilla im Grunde seines Herzens ein liebenswürdiges und sanftmütiges Wesen war.
Die Wand war so dünn, dass ich alles über den Film mitkriegte. Mein Büro war in geschmackvollem Amtsgrün gehalten – inklusive der Scheibe des einzigen Fensters, das sonst eine schöne Aussicht auf den zentralen Lichtschacht geboten hätte. In dem Büro standen zwei kleine, beigefarbene Schreibtische, ich arbeitete an dem mit dem Telefon darauf.
Ich hatte ein Hero Sandwich von Blimpie gegessen und dachte über Truthahnbrust und Thanksgiving und Weihnachtsbäume nach und darüber, dass meine Ex-Frau die Zeit des Friedens und der Nächstenliebe und ziemlich schwerer Depressionen das erste Mal mit ihrer neuen Flamme verbringen würde, einem Burschen, dessen Name sich wie eine Erkrankung der Atemwege anhört – Pflam. Sie und Pflam, der nicht mal Cop war, planten, die Feiertage in einem rechteckigen Staat irgendwo im Westen zu verbringen, wo all die anderen Pflams Rüben oder weiß der Teufel was anbauten. Außerdem versuchte ich einen Bericht über die amüsanten Details einer Festnahme zu tippen, die mir in der Nacht zuvor gelungen war und bei der es um einen der ältesten Schwindel in New York City gegangen war – die Nummer mit dem sprechenden Hund. Das Tippen war nicht ganz einfach, da die Buchstaben t, b und h auf der alten Remington Standard fehlten, die Worte Trottel, Blödian oder Holzkopf konnte ich daher nicht verwenden.
Die Festnahme geschah in einer Kaschemme in der Nähe des Port Authority Bus Terminals an der Ecke zum Times Square. Der Busbahnhof selbst liegt an der Ecke West Forty-second Street und Eighth Avenue, einer Kreuzung, die bei den Leuten, die dort beruflich verkehren, als Ecke Deuce und Stroll bekannt ist. Die Bar liegt hinter dem Bahnhofsgebäude, und zieht eine minimal bessere Klientel an als die Etablissements in der Nähe.
Wie bei solchen Schuppen üblich, ist die Bar meistens halbehrlich und hält sich nicht für etwas Besseres, als sie ist – eine miese Matrosenspelunke. Ein Bursche im Dreiteiler kommt herein, und sofort versucht jemand, ihn an einen der Tische am Bühnenrand zu setzen. Wenn der Bursche schon häufiger dort war und diese Masche kennt, besteht er auf einem Barhocker an der Theke – und zwar allein. Da sitzt er dann vor einem Glas Bier für sechs Dollar, schaltet nach einem harten Arbeitstage erst mal ab, bevor er nach Hause zu Frau und Gören fährt. Er genießt die Show auf der anderen Seite des überfüllten Raumes. Ein halbes Dutzend perückter und parfümierter Frauen, deutlich über vierzig, verdienen sich zehn Dollar die Stunde plus Trinkgeld, indem sie auf Bühne und Laufsteg zu Rock and Roll mit dem Hintern wackeln. Sie verstehen es ausgezeichnet, Schwangerschaftsstreifen auf Bäuchen und Hüften mit Camouflagecreme und ein paar Prisen Körperpuder zu kaschieren. Dann tritt vielleicht eine Frau, die gerade Pause hat, hinter den Burschen an die Theke, und ihr Atem ist ganz süß und ihre Stimme allerliebst, und sie versucht, ihm ein Gläschen abzuschmeicheln, und die Flasche unechter Champagner kostet zwanzig Dollar. Falls er sie ihr nicht spendiert, ist sie schnell wieder weg – Grundsatz des Hauses, nichts Persönliches –, und wenn er es doch macht, ist sie ungefähr fünf Minuten ungeheuer an seiner Lebensgeschichte interessiert, bevor sie ihn einlädt, doch mit nach hinten in eines dieser netten, gemütlichen Separees zu kommen, wo die größere Champagnerflasche auf lockere hundert Dollar kommt. Der Mann tut, was er tun muss.
Aber dieser spezielle Mann im Dreiteiler hatte nichts mit dieser Champagnersache am Hut, nicht mal für zwanzig Bucks. Er wusste, wie Leute in solchen Schuppen abgezockt werden. Ein verdammt harter Kunde, dieser Typ mit den teuren Schuhen und dem Collegering.
Und so kam es, dass der Hund redete. Es ist eine krumme Tour, die in den letzten fünfzig Jahren nur sehr wenige New Yorker erlebt und von der die meisten noch nie etwas gehört haben.
Ich hockte an dieser Theke, weil ich mit Buddy-O reden musste. Er hatte das Lokal vorgeschlagen, weil es für uns beide günstig lag. Schließlich lebte ich jetzt in der Wohnung, die er direkt gegenüber seiner eigenen Bude für mich aufgetrieben hatte – und praktisch keiner, den wir kannten, war dumm genug, ausgerechnet hier zu trinken. Wie auch immer, Buddy-O hatte mich auf dem Revier angerufen und gefragt, ob ich wissen wollte, was in gewissen Kreisen von Hell’s Kitchen über einen kräftigen schwarzen Burschen geredet wurde, den kein Mensch kannte und der in letzter Zeit eine Menge richtige Fragen an einigen der richtigen Orte nach günstigsten Preisen für Wunden stellte, die nicht heilen. Ich sagte, ja, möglicherweise wäre ich interessiert.
Also wartete ich, dass Buddy-O aufkreuzte, als ein Bursche langsam hereingehumpelt kam. Er trug Mantel, schwarzen Rollkragenpullover und Sonnenbrille und hatte einen gutmütig aussehenden Golden Retriever mit einem Geschirr an der Leine, wie es für Blindenhunde benutzt wird. Er ging zu dem schwierigen Kunden im Dreiteiler an der Theke und fragte: »Würde es Ihnen sehr viel ausmachen, wenn ich mich neben Sie auf diesen freien Hocker setze?«
Irgendwas sagte mir, dass der Typ mit dem Hund gerade sein Opfer geködert hatte, das zu der Bitte des armen, unglücklichen, verkrüppelten Blinden natürlich ja sagte und ihm sogar auf den Barhocker half, den die Animierdame verlassen hatte. Im Allgemeinen beachte ich nicht weiter, was in miesen Schuppen wie diesem abgeht. Ich finde, jeder dort ist erwachsen genug und sollte auch ohne meine Hilfe wissen, wo er sich befindet, und dass der Times Square nicht Kansas ist. Allerdings gibt es gewisse Dinge, die ich als Cop nicht ignorieren darf. Daher fühlte ich mich verpflichtet, auf diesen Trottel aufzupassen.
»Darf ich Sie zu einem Drink einladen?«, fragte der Trottel den Blinden.
»Okay, das wäre nett, junger Mann. Ich bestelle dann den für meinen Hund.«
»Ihr Hund trinkt?«
»Schrecklich, nicht wahr? Und außerdem ist er im Dienst. Aber er ist ein guter alter Hund, und deshalb lasse ich ihm seine Sauferei durchgehen.«
Der Barkeeper füllte eine Schale mit Wasser und kippte einen Schuss Duggan’s Dew Scotch dazu, stellte sie dann vor den Blinden, der sich bedankte und den Trottel bat, die Schale dem Hund auf den Boden zu stellen. Was der Trottel natürlich machte. Und dann schlabberte der Hund das Zeug weg.
Der Trottel zuckte mit den Achseln und schien glücklich, weil er am nächsten Morgen eine tolle Geschichte im Büro zu erzählen hätte. Dann setzte er sich wieder auf seinen Barhocker, schaute dem Hund beim Trinken und den Tänzerinnen beim Tanzen zu. Und dann wurde er neugierig.
»Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?«, sagte er zu dem blinden Mann.
»Fragen Sie.«
»Also, ich will nicht unhöflich oder taktlos erscheinen, aber wieso kommen Sie her, wenn Sie doch … also, wenn Sie gar nicht sehen können, was da oben auf der Bühne passiert? Ich meine, wieso kommt jemand her und zahlt, was hier für die miesen Drinks verlangt wird, wenn er nicht wenigstens Titten zu sehen kriegt?«
»Heiliger Strohsack, ich war nicht immer blind, mein Junge! Früher war ich dauernd hier. War in dem Laden mal Conférencier. Heute bin ich Rentner. Ab und an schaue ich noch mal mit Rex hier vorbei, mit meinem Wunderhund, und besuche die Mädchen.«
Und tatsächlich drängten sich dann die Animierdamen und die Tänzerinnen, die gerade Pause hatten, um den blinden Mann, gurrten und gaben Küsschen hier und Küsschen da. Und er zwickte ihnen in den Po, und sie quiekten, und die anderen Trottel rückten ein Stück näher. Zwei Typen, die selbst ich zuvor nicht bemerkt hatte, schoben sich dicht an die Trottel. Schmale, kleine, unauffällige Typen mit langen, flinken Fingern.
Und dann sprach der Hund.
»Ich will noch einen«, sagte Rex.
Der Blinde und sämtliche Animierdamen sahen zu Rex hinunter, der zu ihnen aufschaute. Die Zunge des Hundes hing heraus. Komisch, dass der blinde Mann zu dem Hund hinunterschaut, dachte ich.
Dann warf der Trottel direkt neben dem Blinden einen Blick auf Rex, und alle anderen Trottel ebenfalls.
Rex senkte den Kopf und sagte: »Ich hab gesagt, ich will noch einen, bitte.«
Niemand außer den Trotteln war überrascht, Rex sprechen zu hören. Eines der Mädchen beugte sich vor, hob die Schale vom Boden und reichte sie dem Barkeeper, der einen neuen Drink mixte.
»Was zum Teufel …?«, meinte der Trottel, der neben dem Blinden stand.
Und mehrere der anderen Blödmänner sagten ungefähr das gleiche und drängten sich um den sprechenden Hund und die allgemeine Aufregung.
»Oh, die sind wegen Rex überrascht«, sagte der Blinde zu einem der Mädchen. Dann zu den Trotteln: »Gentlemen, das hier ist ein sprechender Hund. Einer der wenigen auf dieser Welt.«
Als wenn’s noch ein paar gäbe, dachte ich. Ich bemerkte, wie die Mädchen den schmalen, kleinen Typen mehr Platz machten, die die dicht gedrängt stehenden Trottel anrempelten.
»He, sind Sie Bauchredner oder was?«, krähte der schwierige Kunde.
Der blinde Knabe lächelte, streckte die Hand aus und sagte: »Tja, mein Junge, Ihnen kann ich nichts vormachen, was?. Sie sind ein helles Köpfchen, das ist mal klar. Waldo ist mein Name. Hab früher auf Jahrmärkten im ganzen Land gearbeitet, bis ich einen schrecklichen Unfall hatte und dabei meine Gucker verlor. Heute mache ich nur noch Tricks in Bars, einfach so zum Spaß. Wie zum Beispiel meine Stimme so zu verstellen, dass es aussieht, als würde Rex reden. Jedenfalls, ich gebe Ihnen einen aus, okay?«
Und so fiel der Trottel, der sich nicht mit unechtem Champagner austricksen ließ, auf die Nummer mit dem sprechenden Hund rein. Die Langfinger, die die Taschen des Trottels und seiner Kollegen ausgeräumt hatten, verdrückten sich schnell zu einem Seitenausgang. Waldo, der falsche Blinde, würde sein Opfer mit einem Drink beschäftigt halten, damit er nicht sofort bemerkte, dass aus seinen Taschen das eine oder andere verschwunden war. Und das Haus bekam zweifellos einen Anteil. Ich beschloss, dass ich so was unmöglich guten Gewissens Nase tolerieren konnte.
Trotzdem hätte ich vielleicht nichts unternommen, wäre Buddy-O pünktlich gewesen, was er aber nicht war. Ich warf einen Blick auf meine Uhr und sah, dass er schon fast dreißig Minuten überfällig war. Also, dachte ich mir, ist es jetzt Zeit für ein paar Festnahmen. Zuerst schnappte ich mir einen der Langfinger, der, wie sich herausstellte, die Brieftasche des ursprünglichen Trottels mit hundertfünfzig in bar, der besseren Sorte Kreditkarten, Schnappschüssen einer übergewichtigen Frau und zweier sommersprossiger Kids sowie zwei verschiedenfarbige Trojan-Pariser bei sich hatte. Als nächstes verhaftete ich Waldo und den Barkeeper.
Der Trottel, dessen Brieftasche ich gerettet hatte, fing an, mir auf die Nerven zu gehen, weil er nicht in die Geschichte hineingezogen werden wollte. Also sagte ich, dass ich seine Brieftasche als Beweismittel sicherstellen müsse, was ich für ungefähr einen Tag durfte, bis die Spurensicherung den Inhalt erfasst und fotografiert hatte. Normalerweise gebe ich dem Opfer das Bargeld ganz oder doch wenigstens einen Teil davon zurück, damit er ohne größere Unannehmlichkeiten abziehen kann. Aber wenn jemand anfängt, mir das Leben schwerzumachen, halte ich mich streng an die Vorschriften. Daher rief ich in diesem Fall, und auf eigene Kosten, seine Frau drüben in Jersey an und erzählte ihr, sie solle ihn abholen, weil er gerade in einem Bumslokal ausgeraubt worden sei.
Anschließend verständigte ich das Revier und forderte uniformierte Verstärkung an, die meine Festnahmen übernehmen sollte, weil ich immer noch warten musste, dass Buddy-O, mein Spitzel, endlich aufkreuzte.
Was er nie tat.
Das alles versuchte ich also ohne Hilfe der drei wichtigen Buchstaben zu Papier zu bringen, als mein Telefon klingelte.
»Hock, Neglio hier«, sagte mein Chef.
»Was haben Sie auf dem Herzen?«
»Was auch Sie bald beschäftigen wird, wenn Sie überlegen, was Sie tun sollen, wenn Sie in Rente sind. Draußen am Sound einen Laden für Anglerbedarf aufmachen? Für irgendeinen Verlag Ihre Memoiren schreiben? So was. Außerdem will ich Sie morgen sehen.«
»Um was geht’s?«
»Um eine heikle Sache«, sagte Neglio. »Seien Sie einfach morgen früh Punkt neun in meinem Büro.«
In Midtown-North stationiert zu sein, ist angenehm, weil ich zu Fuß zur Arbeit gehen kann. Und das schönste am Weg zwischen Wohnung und Arbeit ist, dass ich auf dem Heimweg Zwischenstation in Angelo’s Ebb Tide auf der Ninth Avenue machen kann.
Es ist ein Laden, der schon bessere, aber auch schlechtere Zeiten gesehen hat und sich im Augenblick irgendwo dazwischen befindet.
Vor nicht mal einem Jahr hat kein Mensch irgendwas im Ebb Tide gegessen, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ. Damals gab’s entweder etwas undefinierbar Fleischiges und Matschiges, das in einer Soße herumschwamm und aus der Warmhaltetheke kam, oder aber muffige Erdnüsse in Zellophantüten zu einem Bier vom Fass, das vierzig Cents kostete.
Noch vor ein paar Jahrzehnten wimmelte es am Bordstein von Packards und Lincolns und Frazer Manhattans, und die Besitzer lieferten ihre Handfeuerwaffen am Eingang ab und betraten dann ein dunkelrot beleuchtetes Lokal mit vielen uneinsehbaren Nischen. Die Gäste tranken französischen Wein und zwölf Jahre alten Scotch, aßen gut abgehangene Porterhouse-Steaks und rauchten anschließend dunkelbraune Macanudos aus dem vorrevolutionären Kuba. Als ich ein kleiner Junge war, gehörte Joey Adonis, der große West-Side-Gangster, zu den Stammgästen.
Heute erlebt der Laden gerade seine dritte Inkarnation.
Unmengen von Weinschorlen werden vielen schönen Menschen serviert, die sich um das hintere Ende der Theke scharen und mit Plastikgeld zahlen. Im nach hinten hinaus gelegenen Restaurant bestellen lauter Gäste eine Menge Sachen, die laut ihrer Lieblingsillustrierten als in gelten. Wenn sie sich nicht gerade suchend umschauen, um zu sehen, wer noch da ist, kreisen ihre Unterhaltungen um Fitnessstudios oder Therapien oder andere Restaurants. Mir ist aufgefallen, dass praktisch alle jüngeren Frauen Zigaretten rauchen, manchmal sogar zu ihrem Essen. Das liegt daran, weil sie es ganz schön weit gebracht haben, Baby.
Trotz des neuen Schickimicki-Pöbels gehe ich bis heute ziemlich oft in Angelo’s Ebb Tide. Grund dafür ist Angelo Cifelli, beständiger Namensgeber und Barkeeper des Ebb Tide. Seit den Fünfzigerjahren ist er in seinem gestärkten weißen Hemd, der schwarzen Fliege, schwarzer Weste und roter Schürze treu im Dienst. Und seit damals legt er für seine Gäste Jazzplatten auf und gibt seine stets erstaunte Sicht einer Welt zum besten, die zumeist von den dunkleren Engeln der Menschen beherrscht wird. Angelo hat heutzutage eine Schwäche für den vorderen Teil der Theke, wo ich mit den anderen alten Getreuen sitze, Johnnie Walker Red Label und ein Molson zum Nachspülen trinke und vielleicht ein gekochtes Ei esse.
Als ich an diesem Freitag Anfang November nach dem Dienst vorbeischaute, spielte Angelo Aufnahmen von Lester Young, Mabel Mercer, Jack Teagarden, George Shearing und John Coltrane, zusammengeschnitten auf einem einzigen herrlichen Band. Er brachte mir einen Red und ein Molson, ohne dass ich auch nur ein Wort sagen musste. Dazu legte er außerdem die Abendausgabe der New York Post.
»Durch die Zeitung weiß ich, dass wir wieder einen richtig schönen Tag in den U. S. of A. hatten«, sagte er. »Tolles Jahr für Nachrichten, häh?«
»Das Beste«, stimmte ich zu. »Mencken hätt’s geliebt.«
»Kann man wohl sagen. Jeden zweiten Tag sind Wall-Street-Typen im Gänsemarsch und aneinander gekettet in den Bundesknast gekarrt worden, weil sie Koks genossen wie wir anderen Bares. Eine Ex-Miss-America hat sich durch Skandalgeschichten um ihren Job bei der Stadt gebracht. In der Bronx steht inzwischen jeder mit dem Namen Stanley unter Anklage. Und obendrein müssen wir erfahren, dass einer dieser Fernsehevangelisten schließlich ein Mäuschen in seiner Herde gefunden hat, das einen Griff in die Hose wert ist, und dass er nun zu Gott betet, damit er in Zukunft seinen Hosenstall geschlossen hält, da das Schweigegeld, das er der Kleinen gegeben hat, anscheinend doch nicht so gut wirkt.«
»Ja, wir leben in einer wirklich wunderbaren Zeit«, sagte ich.
Angelo schenkte sich einen Red ein und leerte das Glas in einem Zug. Er sagte: »Also, ich frage dich … wie kommt’s, dass überhaupt noch einer wählen geht?«
»Ich wähle nie«, sagte ich. »Ich sehe keinen Grund, Überflüssiges auch noch zu unterstützen.«
Weil ich Angelo zum Lachen brachte, bekam ich einen weiteren Red und ein Molson aufs Haus.
Am anderen Ende der Theke begann jemand in Zopfmusterpullover und Kaschmirjacke mit den Fingern zu schnippen. Angelo drehte sich um, sah mich dann wieder an und verdrehte die Augen.
»Ich muss jetzt los. Der Typ da unten? Acht zu eins, dass er für sich und seine Freunde einen Pitcher Margaritas bestellt … und wir haben November! Was soll ich sagen? Die haben alle die Konservativen gewählt, und das gleich zweimal – und sie sind so blöd, dass es ihnen nicht mal peinlich ist. Aber was noch schlimmer ist: Die haben auch keinen Schimmer, wie man richtig trinkt. Ich sage dir, wir sind verloren.«
Angelo ging, und ich saß da und hörte dem Jazz zu, trank meinen zweiten Scotch, nippte an dem Molson und blätterte in der Zeitung. Allerdings las ich nicht wirklich. Ich ließ einfach nur die fetten Schlagzeilen, die Mädchenfotos und die Werbebotschaften in mein Blickfeld driften …
Freitag?
Wenn man wie ich allein lebt, sind die Tage lang und leer genug, dass die Wochenenden nicht zu hochfliegenden Erwartungen ermutigen. Aber an diesem speziellen Freitag hatte Inspector Neglio angerufen und mich zu einer Besprechung am nächsten Morgen bestellt – was natürlich Samstag sein würde. Was nach meinem Dienstplan ganz klar ein freier Tag war; Samstag genau wie Sonntag. Anscheinend hatte Neglio tatsächlich einen heiklen Fall, wenn er mich an einem Tag kommen ließ, der die Stadt das Doppelte an Überstunden kosten würde.
Ich konnte das zusätzliche Geld gebrauchen. Judy, meine Ex, hatte ihrem Pflam noch nicht »Ich will« gesagt, daher war mein Bankkonto immer noch fest im Würgegriff des Gerichtes.
Ich ging den Rest der Zeitung durch, trank mein Bier aus und fühlte mich wohl und ausgeglichen. Ich wollte nach Hause und ein Nickerchen machen, bevor ich mich wie üblich mit einem chinesischen Imbiss vor meinen Philco, einen alten Schwarzweißfernseher, setzte, um mir Dan Rather und einen seiner unsäglichen Pullover reinzuziehen. Plötzlich hatte ich so etwas wie eine Vorahnung und dachte angestrengt über Buddy-O und darüber nach, dass er gestern Abend nicht aufgetaucht war, was durchaus vorkommen kann. Aber er hatte mich auch später nicht angerufen. Was niemals passiert, wenn ein Informant etwas so Gutes zu verkaufen hat, wie Buddy-O behauptete.
Dachte mir, du solltest es wissen, Hock – dieser Nigger rennt in der Gegend rum und fragt, wo er gewaltsame Problemlösungen der dauerhaften Art kaufen kann. Genau wie früher, du erinnerst dich?
Ich meine, das macht er genau hier, in unserem Viertel. Die Leute, mit denen ich so rede, die kennen den Nigger nicht. Aber todsicher weiß er, wo er die richtige Art Fragen stellen muss.
Unter uns, Hock, und – lach jetzt nicht, aber wenigstens dieses eine Mal meine ich’s auch genau so – als guter Bürger von New York, ich hab mich selbst ein bisschen umgehört.
Was ich dir zu erzählen habe, wird meiner Meinung nach für alle Beteiligten äußerst nützlich sein – außer für ein paar gewisse, ziemlich große Tiere. Und am Telefon werde ich jetzt nicht noch mehr sagen, okay ?
Also, wenn du mehr wissen willst, musst du dich schon mit mir treffen. Und bring dein großzügig gefülltes Spesenportemonnaie mit, Hock. Ich werde das dann als Anzahlung verstehen. Ich bin ziemlich sicher, dass du mehr dafür bezahlen wirst, als je zuvor für irgendwas.
Und das ist jetzt kein Quatsch, Hock, hier geht’s um 1A-Material …
Wenn ich die Informationen, die ich brauche, um meinen Job zu erledigen, von der League of Women Voters bekommen kann, dann würde ich sie mir auch genau dort besorgen. Das würde der Stadt eine Menge Geld sparen, und ich würde mich auch nicht so mies fühlen, wie ich mich oft fühle, wenn ich mit meinen Spitzeln rede. Ich mag Spitzel nicht besonders und wollte nicht neben einem von denen wohnen. Natürlich Grund genug, um Buddy-O nicht zu mögen, wo wir ja, wie die Dinge nun mal liegen, Nachbarn sind.
Trotzdem, da saß ich und dachte über einen Spitzel nach, als wäre er ein normaler Mensch. Vielleicht weil er mir zur Abwechslung mal einen Gefallen getan und eine billige Wohnung vermittelt hatte; vielleicht, weil wir zusammen in Hell’s Kitchen aufgewachsen sind.
Manchmal war Buddy-O im Ebb Tide, wenn ich dort war. Doch bei diesen Gelegenheiten wechselten wir kein Wort. Das war Buddy-Os Entscheidung, er wollte nicht mit einem allgemein bekannten Cop gesehen werden. Außerdem, wenn er im Ebb Tide war, hockte er praktisch immer in einer Nische und versuchte, keine feuchten Hände zu kriegen, während er ganz cool einem Fremden, den er hierher geschleift hatte, erzählte, dass er die Zeit erübrigen könne, bei gewissen treuhänderischen Angelegenheiten zu helfen, weil er sich vorübergehend zwischen zwei sehr lukrativen Geschäften befinde.
Ich hätte diese stillschweigende Übereinkunft gebrochen und ihn angesprochen, wenn er an diesem späten Freitagnachmittag hereingekommen wäre. Stattdessen fragte ich Angelo, ob er in letzter Zeit Buddy-O gesehen hätte.
»Ja, vor ungefähr zwei Tagen «, antwortete Angelo. »Genau, Mittwoch war’s. Er ist auf ein Kalbfleischsandwich und ein Moosebead reingekommen, zusammen mit einem Schwarzen, der das gleiche bestellt hat. Was ich schon ziemlich komisch fand …
Ich meine nicht, dass das mit dem Kalbfleisch und dem Bier komisch war. Ich meine, das mit dem schwarzen Typen war komisch. Buddy-O hat ja nicht besonders viele Freunde außerhalb seiner eigenen Erbmasse, und er war auch nicht gerade zahlendes Mitglied der N-Doppel-A-C-P.«
»Ja, ich weiß, was du meinst«, sagte ich.
Angelo drehte sich um und wechselte das Tonband. Nach ein paar Takten »Bloos for Louise« von Zoot Sims erinnerte er sich an etwas, das er mir über Buddy-O erzählen konnte.
»Also, gerade fällt’s mir wieder ein«, sagte er. »Irgendwer hat gesagt, die Cops würden in seiner Bude rumschwirren. Vor ungefähr einer Stunde.«